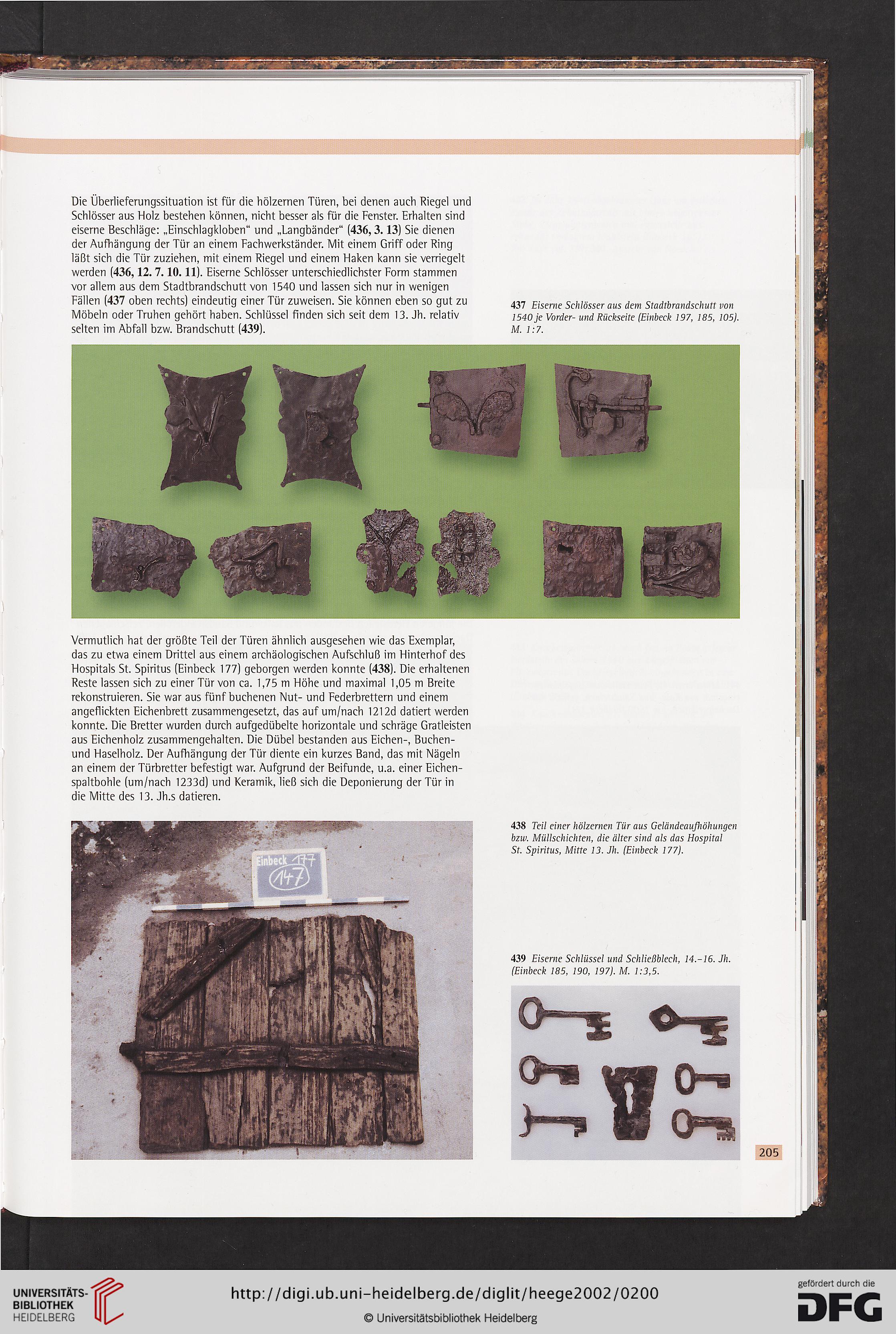Die Uberlieferungssituation ist für die hölzernen Türen, bei denen auch Riegel und
Schlösser aus Holz bestehen können, nicht besser als für die Fenster. Erhalten sind
eiserne Beschläge: „Einschlagkloben“ und „Langbänder“ (436,3.13) Sie dienen
der Aufhängung der Tür an einem Fachwerkständer. Mit einem Griff oder Ring
läßt sich die Tür zuziehen, mit einem Riegel und einem Haken kann sie verriegelt
werden (436,12. 7.10.11). Eiserne Schlösser unterschiedlichster Form stammen
vor allem aus dem Stadtbrandschutt von 1540 und lassen sich nur in wenigen
Fällen (437 oben rechts) eindeutig einer Tür zuweisen. Sie können eben so gut zu
Möbeln oder Truhen gehört haben. Schlüssel finden sich seit dem 13. Jh. relativ
selten im Abfall bzw. Brandschutt (439).
437 Eiserne Schlösser aus dem Stadtbrandschutt von
1540 je Vorder- und Rückseite (Einbeck 197, 185, 105).
M. 1:7.
Vermutlich hat der größte Teil der Türen ähnlich ausgesehen wie das Exemplar,
das zu etwa einem Drittel aus einem archäologischen Aufschluß im Hinterhof des
Hospitals St. Spiritus (Einbeck 177) geborgen werden konnte (438). Die erhaltenen
Reste lassen sich zu einer Tür von ca. 1,75 m Höhe und maximal 1,05 m Breite
rekonstruieren. Sie war aus fünf buchenen Nut- und Federbrettern und einem
angeflickten Eichenbrett zusammengesetzt, das auf um/nach 1212d datiert werden
konnte. Die Bretter wurden durch aufgedübelte horizontale und schräge Gratleisten
aus Eichenholz zusammengehalten. Die Dübel bestanden aus Eichen-, Buchen-
und Haselholz. Der Aufhängung der Tür diente ein kurzes Band, das mit Nägeln
an einem der Türbretter befestigt war. Aufgrund der Beifunde, u.a. einer Eichen-
spaltbohle (um/nach 1233d) und Keramik, ließ sich die Deponierung der Tür in
die Mitte des 13. Jh.s datieren.
'.“