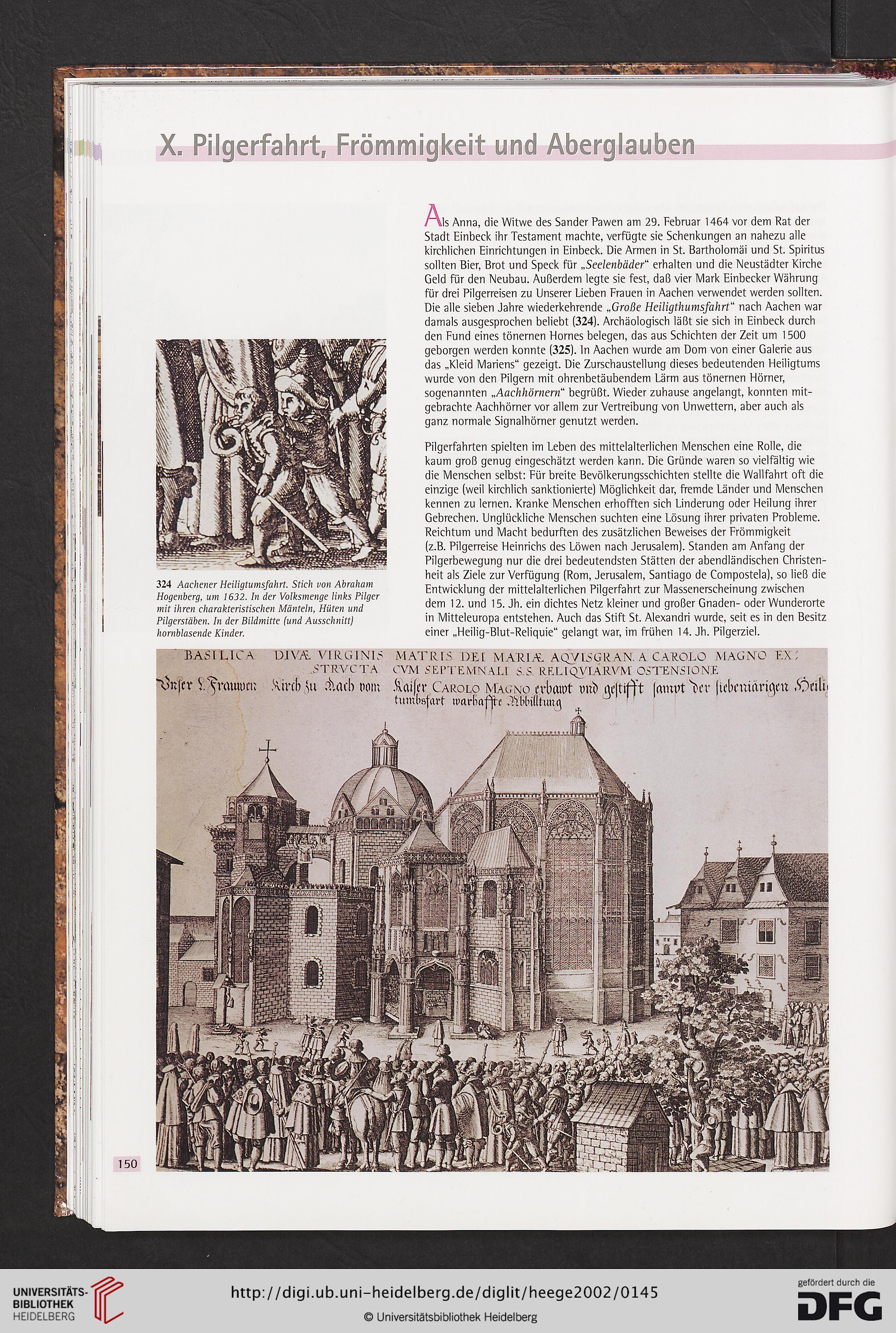X. Pilgerfahrt, Frömmigkeit und Aberglauben
Ah
Vis Anna, die Witwe des Sander Pawen am 29. Februar 1464 vor dem Rat der
Stadt Einbeck ihr Testament machte, verfügte sie Schenkungen an nahezu alle
kirchlichen Einrichtungen in Einbeck. Die Armen in St. Bartholomäi und St. Spiritus
sollten Bier, Brot und Speck für „Seelenbäder“ erhalten und die Neustädter Kirche
Geld für den Neubau. Außerdem legte sie fest, daß vier Mark Einbecker Währung
für drei Pilgerreisen zu Unserer Lieben Frauen in Aachen verwendet werden sollten.
Die alle sieben Jahre wiederkehrende „Große Heiligthumsfahrt“ nach Aachen war
damals ausgesprochen beliebt (324). Archäologisch läßt sie sich in Einbeck durch
den Fund eines tönernen Flornes belegen, das aus Schichten der Zeit um 1500
geborgen werden konnte (325). ln Aachen wurde am Dom von einer Galerie aus
das „Kleid Mariens“ gezeigt. Die Zurschaustellung dieses bedeutenden Heiligtums
wurde von den Pilgern mit ohrenbetäubendem Lärm aus tönernen Hörner,
sogenannten „Aachhörnern“ begrüßt. Wieder zuhause angelangt, konnten mit-
gebrachte Aachhörner vor allem zur Vertreibung von Unwettern, aber auch als
ganz normale Signalhörner genutzt werden.
Pilgerfahrten spielten im Leben des mittelalterlichen Menschen eine Rolle, die
kaum groß genug eingeschätzt werden kann. Die Gründe waren so vielfältig wie
die Menschen selbst: Für breite Bevölkerungsschichten stellte die Wallfahrt oft die
einzige (weil kirchlich sanktionierte) Möglichkeit dar, fremde Länder und Menschen
kennen zu lernen. Kranke Menschen erhofften sich Linderung oder Heilung ihrer
Gebrechen. Unglückliche Menschen suchten eine Lösung ihrer privaten Probleme.
Reichtum und Macht bedurften des zusätzlichen Beweises der Frömmigkeit
(z.B. Pilgerreise Heinrichs des Löwen nach Jerusalem). Standen am Anfang der
Pilgerbewegung nur die drei bedeutendsten Stätten der abendländischen Christen-
heit als Ziele zur Verfügung (Rom, Jerusalem, Santiago de Compostela), so ließ die
Entwicklung der mittelalterlichen Pilgerfahrt zur Massenerscheinung zwischen
dem 12. und 15. Jh. ein dichtes Netz kleiner und großer Gnaden- oder Wunderorte
in Mitteleuropa entstehen. Auch das Stift St. Alexandri wurde, seit es in den Besitz
einer „Heilig-Blut-Reliquie“ gelangt war, im frühen 14. Jh. Pilgerziel.
DJV/L VTRGINI5 MAT R IS DEI MARIÄ AQVTSGRAN. A CAROLO MAGNO F.X 1
^ .STRVCTA CVM SEPTEMNALI S.S. REL1QVIARVM OSTE NS 10 NT.
\>n|n* V ^nuuiH’R Ainb Ui .t.rtcb tnnn Äaifcr Carolo Magno rrbarot tmfe lU’ltifft [anuit 'feer licbnürtrify'U fQt\%
tumbsvfarf warfidfftt Cfibbilltuurj
324 Aachener Heiligtumsfahrt. Stich von Abraham
Hogenberg, um 1632. In der Volksmenge links Pilger
mit ihren charakteristischen Mänteln, Hüten und
Pilgerstäben. In der Bildmitte (und Ausschnitt)
homblasende Kinder.
BASI LIGA
Ah
Vis Anna, die Witwe des Sander Pawen am 29. Februar 1464 vor dem Rat der
Stadt Einbeck ihr Testament machte, verfügte sie Schenkungen an nahezu alle
kirchlichen Einrichtungen in Einbeck. Die Armen in St. Bartholomäi und St. Spiritus
sollten Bier, Brot und Speck für „Seelenbäder“ erhalten und die Neustädter Kirche
Geld für den Neubau. Außerdem legte sie fest, daß vier Mark Einbecker Währung
für drei Pilgerreisen zu Unserer Lieben Frauen in Aachen verwendet werden sollten.
Die alle sieben Jahre wiederkehrende „Große Heiligthumsfahrt“ nach Aachen war
damals ausgesprochen beliebt (324). Archäologisch läßt sie sich in Einbeck durch
den Fund eines tönernen Flornes belegen, das aus Schichten der Zeit um 1500
geborgen werden konnte (325). ln Aachen wurde am Dom von einer Galerie aus
das „Kleid Mariens“ gezeigt. Die Zurschaustellung dieses bedeutenden Heiligtums
wurde von den Pilgern mit ohrenbetäubendem Lärm aus tönernen Hörner,
sogenannten „Aachhörnern“ begrüßt. Wieder zuhause angelangt, konnten mit-
gebrachte Aachhörner vor allem zur Vertreibung von Unwettern, aber auch als
ganz normale Signalhörner genutzt werden.
Pilgerfahrten spielten im Leben des mittelalterlichen Menschen eine Rolle, die
kaum groß genug eingeschätzt werden kann. Die Gründe waren so vielfältig wie
die Menschen selbst: Für breite Bevölkerungsschichten stellte die Wallfahrt oft die
einzige (weil kirchlich sanktionierte) Möglichkeit dar, fremde Länder und Menschen
kennen zu lernen. Kranke Menschen erhofften sich Linderung oder Heilung ihrer
Gebrechen. Unglückliche Menschen suchten eine Lösung ihrer privaten Probleme.
Reichtum und Macht bedurften des zusätzlichen Beweises der Frömmigkeit
(z.B. Pilgerreise Heinrichs des Löwen nach Jerusalem). Standen am Anfang der
Pilgerbewegung nur die drei bedeutendsten Stätten der abendländischen Christen-
heit als Ziele zur Verfügung (Rom, Jerusalem, Santiago de Compostela), so ließ die
Entwicklung der mittelalterlichen Pilgerfahrt zur Massenerscheinung zwischen
dem 12. und 15. Jh. ein dichtes Netz kleiner und großer Gnaden- oder Wunderorte
in Mitteleuropa entstehen. Auch das Stift St. Alexandri wurde, seit es in den Besitz
einer „Heilig-Blut-Reliquie“ gelangt war, im frühen 14. Jh. Pilgerziel.
DJV/L VTRGINI5 MAT R IS DEI MARIÄ AQVTSGRAN. A CAROLO MAGNO F.X 1
^ .STRVCTA CVM SEPTEMNALI S.S. REL1QVIARVM OSTE NS 10 NT.
\>n|n* V ^nuuiH’R Ainb Ui .t.rtcb tnnn Äaifcr Carolo Magno rrbarot tmfe lU’ltifft [anuit 'feer licbnürtrify'U fQt\%
tumbsvfarf warfidfftt Cfibbilltuurj
324 Aachener Heiligtumsfahrt. Stich von Abraham
Hogenberg, um 1632. In der Volksmenge links Pilger
mit ihren charakteristischen Mänteln, Hüten und
Pilgerstäben. In der Bildmitte (und Ausschnitt)
homblasende Kinder.
BASI LIGA