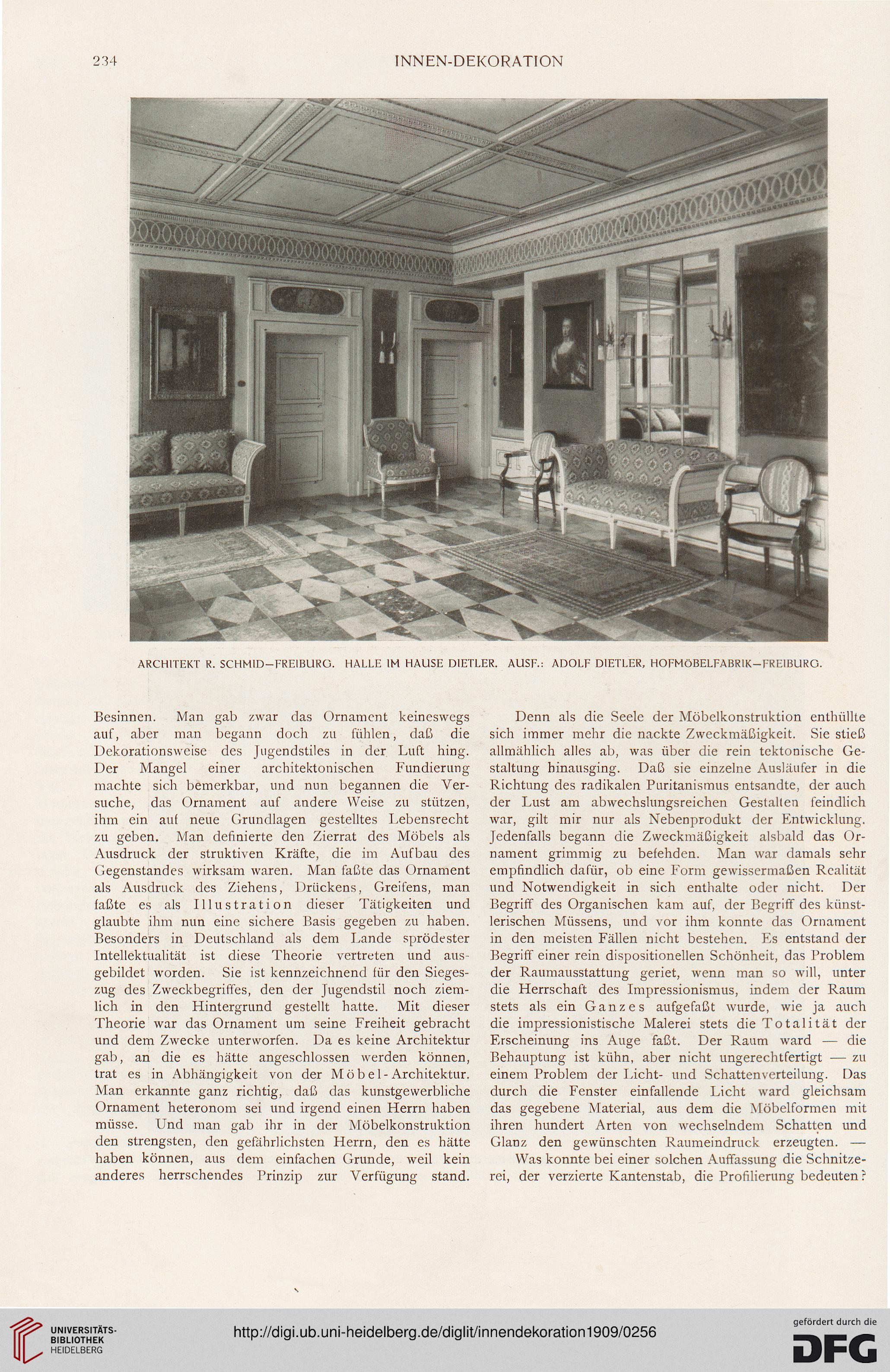234
INNEN-DEKORATION
ARCHITEKT R. SCHM1D—FREIBURü. HALLE IM HAUSE D1ETLER. AUSF.: ADOLF D1ETLER, HOFMÖBELFABRIK —FREIBURO.
Besinnen. Man gab zwar das Ornament keineswegs
auf, aber man begann doch zu fühlen, daß die
Dekorationsweise des Jugendstiles in der Luft hing.
Der Mangel einer architektonischen Fundierung
machte sich bemerkbar, und nun begannen die Ver-
suche, das Ornament auf andere Weise zu stützen,
ihm ein auf neue Grundlagen gestelltes Lebensrecht
zu geben. Man definierte den Zierrat des Möbels als
Ausdruck der struktiven Kräfte, die im Aufbau des
Gegenstandes wirksam waren. Man faßte das Ornament
als Ausdruck des Ziehens, Drückens, Greifens, man
faßte es als Illustration dieser Tätigkeiten und
glaubte ihm nun eine sichere Basis gegeben zu haben.
Besonders in Deutschland als dem Lande sprödester
Intellektualität ist diese Theorie vertreten und aus-
gebildet worden. Sie ist kennzeichnend für den Sieges-
zug des Zweckbegriffes, den der Jugendstil noch ziem-
lich in den Hintergrund gestellt hatte. Mit dieser
Theorie war das Ornament um seine Freiheit gebracht
und dem Zwecke unterworfen. Da es keine Architektur
gab, an die es hätte angeschlossen werden können,
trat es in Abhängigkeit von der Möbel-Architektur.
Man erkannte ganz richtig, daß das kunstgewerbliche
Ornament heteronom sei und irgend einen Herrn haben
müsse. Und man gab ihr in der Möbelkonstruktion
den strengsten, den gefährlichsten Herrn, den es hätte
haben können, aus dem einfachen Grunde, weil kein
anderes herrschendes Prinzip zur Verfügung stand.
Denn als die Seele der Möbelkonstruktion enthüllte
sich immer mehr die nackte Zweckmäßigkeit. Sie stieß
allmählich alles ab, was über die rein tektonische Ge-
staltung hinausging. Daß sie einzelne Ausläufer in die
Richtung des radikalen Puritanismus entsandte, der auch
der Lust am abwechslungsreichen Gestallen feindlich
war, gilt mir nur als Nebenprodukt der Entwicklung.
Jedenfalls begann die Zweckmäßigkeit alsbald das Or-
nament grimmig zu befehden. Man war damals sehr
empfindlich dafür, ob eine Form gewissermaßen Realität
und Notwendigkeit in sich enthalte oder nicht. Der
Begriff des Organischen kam auf, der Begriff des künst-
lerischen Müssens, und vor ihm konnte das Ornament
in den meisten Fällen nicht bestehen. Es entstand der
Begriff einer rein dispositionellen Schönheit, das Problem
der Raumausstattung geriet, wenn man so will, unter
die Herrschaft des Impressionismus, indem der Raum
stets als ein Ganzes aufgefaßt wurde, wie ja auch
die impressionistische Malerei stets die Totalität der
Erscheinung ins Auge faßt. Der Raum ward — die
Behauptung ist kühn, aber nicht ungerechtfertigt — zu
einem Problem der Licht- und Schattenverteilung. Das
durch die Fenster einfallende Licht ward gleichsam
das gegebene Material, aus dem die Möbelformen mit
ihren hundert Arten von wechselndem Schatten und
Glanz den gewünschten Raumeindruck erzeugten. —
Was konnte bei einer solchen Auffassung die Schnitze-
rei, der verzierte Kantenstab, die Profilierung bedeuten?
INNEN-DEKORATION
ARCHITEKT R. SCHM1D—FREIBURü. HALLE IM HAUSE D1ETLER. AUSF.: ADOLF D1ETLER, HOFMÖBELFABRIK —FREIBURO.
Besinnen. Man gab zwar das Ornament keineswegs
auf, aber man begann doch zu fühlen, daß die
Dekorationsweise des Jugendstiles in der Luft hing.
Der Mangel einer architektonischen Fundierung
machte sich bemerkbar, und nun begannen die Ver-
suche, das Ornament auf andere Weise zu stützen,
ihm ein auf neue Grundlagen gestelltes Lebensrecht
zu geben. Man definierte den Zierrat des Möbels als
Ausdruck der struktiven Kräfte, die im Aufbau des
Gegenstandes wirksam waren. Man faßte das Ornament
als Ausdruck des Ziehens, Drückens, Greifens, man
faßte es als Illustration dieser Tätigkeiten und
glaubte ihm nun eine sichere Basis gegeben zu haben.
Besonders in Deutschland als dem Lande sprödester
Intellektualität ist diese Theorie vertreten und aus-
gebildet worden. Sie ist kennzeichnend für den Sieges-
zug des Zweckbegriffes, den der Jugendstil noch ziem-
lich in den Hintergrund gestellt hatte. Mit dieser
Theorie war das Ornament um seine Freiheit gebracht
und dem Zwecke unterworfen. Da es keine Architektur
gab, an die es hätte angeschlossen werden können,
trat es in Abhängigkeit von der Möbel-Architektur.
Man erkannte ganz richtig, daß das kunstgewerbliche
Ornament heteronom sei und irgend einen Herrn haben
müsse. Und man gab ihr in der Möbelkonstruktion
den strengsten, den gefährlichsten Herrn, den es hätte
haben können, aus dem einfachen Grunde, weil kein
anderes herrschendes Prinzip zur Verfügung stand.
Denn als die Seele der Möbelkonstruktion enthüllte
sich immer mehr die nackte Zweckmäßigkeit. Sie stieß
allmählich alles ab, was über die rein tektonische Ge-
staltung hinausging. Daß sie einzelne Ausläufer in die
Richtung des radikalen Puritanismus entsandte, der auch
der Lust am abwechslungsreichen Gestallen feindlich
war, gilt mir nur als Nebenprodukt der Entwicklung.
Jedenfalls begann die Zweckmäßigkeit alsbald das Or-
nament grimmig zu befehden. Man war damals sehr
empfindlich dafür, ob eine Form gewissermaßen Realität
und Notwendigkeit in sich enthalte oder nicht. Der
Begriff des Organischen kam auf, der Begriff des künst-
lerischen Müssens, und vor ihm konnte das Ornament
in den meisten Fällen nicht bestehen. Es entstand der
Begriff einer rein dispositionellen Schönheit, das Problem
der Raumausstattung geriet, wenn man so will, unter
die Herrschaft des Impressionismus, indem der Raum
stets als ein Ganzes aufgefaßt wurde, wie ja auch
die impressionistische Malerei stets die Totalität der
Erscheinung ins Auge faßt. Der Raum ward — die
Behauptung ist kühn, aber nicht ungerechtfertigt — zu
einem Problem der Licht- und Schattenverteilung. Das
durch die Fenster einfallende Licht ward gleichsam
das gegebene Material, aus dem die Möbelformen mit
ihren hundert Arten von wechselndem Schatten und
Glanz den gewünschten Raumeindruck erzeugten. —
Was konnte bei einer solchen Auffassung die Schnitze-
rei, der verzierte Kantenstab, die Profilierung bedeuten?