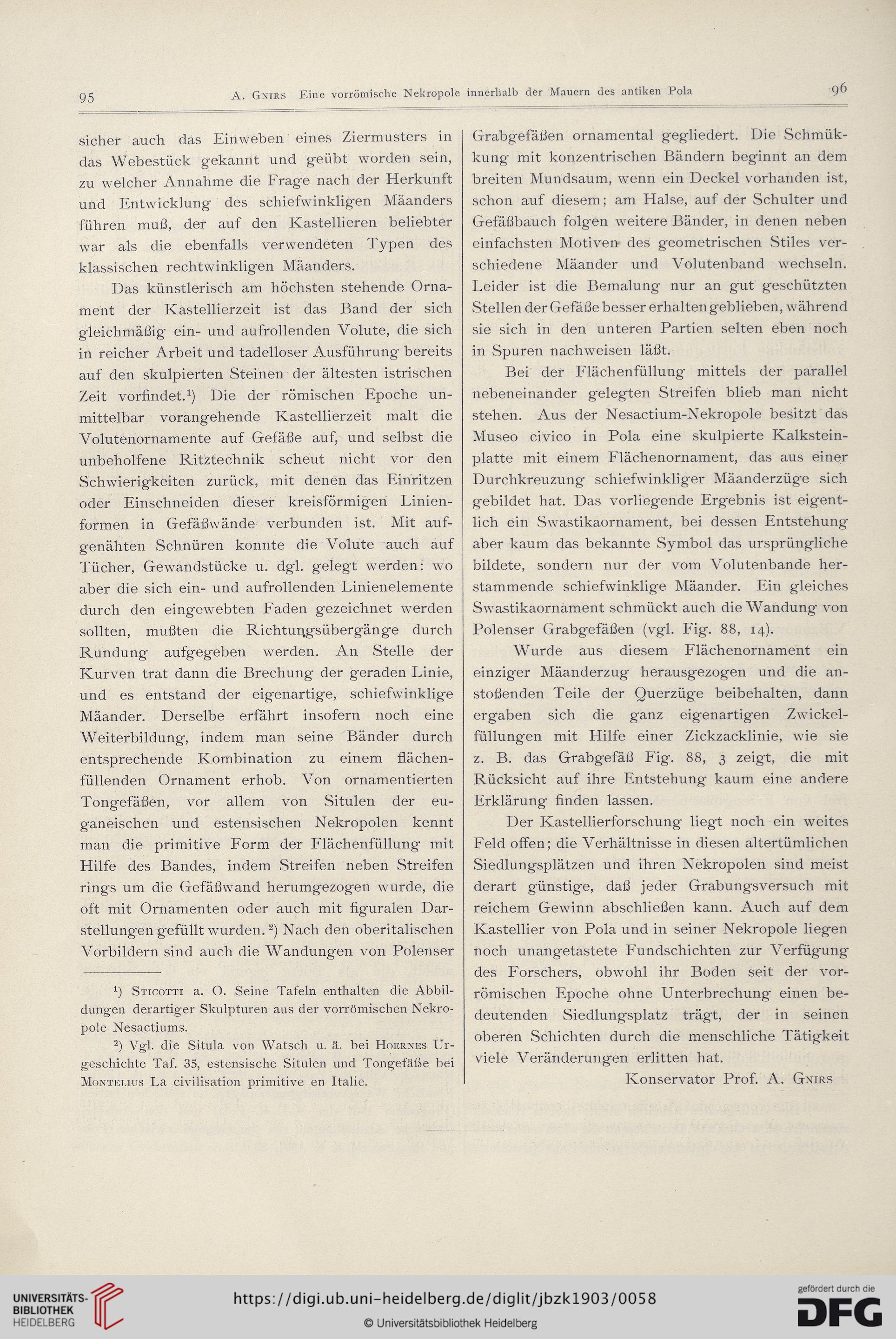95
A. GniRS Eine vorrömische Nekropole innerhalb der Mauern des antiken Pola
96
sicher auch das Einweben eines Ziermusters in
das Webestück gekannt und geübt worden sein,
zu welcher Annahme die Frage nach der Herkunft
und Entwicklung des schiefwinkligen Mäanders
führen muß, der auf den Kastellieren beliebter
war als die ebenfalls verwendeten Typen des
klassischen rechtwinkligen Mäanders.
Das künstlerisch am höchsten stehende Orna-
ment der Kastellierzeit ist das Band der sich
gleichmäßig' ein- und aufrollenden Volute, die sich
in reicher Arbeit und tadelloser Ausführung bereits
auf den skulpierten Steinen der ältesten istrischen
Zeit vorfindet.1) Die der römischen Epoche un-
mittelbar vorangehende Kastellierzeit malt die
Volutenornamente auf Gefäße auf, und selbst die
unbeholfene Ritztechnik scheut nicht vor den
Schwierigkeiten zurück, mit denen das Einritzen
oder Einschneiden dieser kreisförmigen Linien-
formen in Gefäßwände verbunden ist. Mit auf-
genähten Schnüren konnte die Volute auch auf
Tücher, Gewandstücke u. dgl. gelegt werden: wo
aber die sich ein- und aufrollenden Linienelemente
durch den eingewebten Faden gezeichnet werden
sollten, mußten die Richtungsübergänge durch
Rundung aufgegeben werden. An Stelle der
Kurven trat dann die Brechung der geraden Linie,
und es entstand der eigenartige, schiefwinklige
Mäander. Derselbe erfährt insofern noch eine
Weiterbildung, indem man seine Bänder durch
entsprechende Kombination zu einem flächen-
füllenden Ornament erhob. Von ornamentierten
Tongefäßen, vor allem von Situlen der eu-
ganeischen und estensischen Nekropolen kennt
man die primitive Form der Flächenfüllung mit
Hilfe des Bandes, indem Streifen neben Streifen
rings um die Gefäßwand herumgezogen wurde, die
oft mit Ornamenten oder auch mit figuralen Dar-
stellungen g'efüllt wurden.2) Nach den oberitalischen
Vorbildern sind auch die Wandungen von Polenser
b Sticotti a. O. Seine Tafeln enthalten die Abbil-
dungen derartiger Skulpturen aus der vorrömischen Nekro-
pole Nesactiums.
2) Vgl. die Situla von Watsch u. ä. bei Hoernes Ur-
geschichte Taf. 35, estensische Situlen und Tongefäße bei
Montetjus La civilisation primitive en Italie.
Grabgefäßen ornamental gegliedert. Die Schmük-
kung mit konzentrischen Bändern beginnt an dem
breiten Mundsaum, wenn ein Deckel vorhanden ist,
schon auf diesem; am Halse, auf der Schulter und
Gefäßbauch folgen weitere Bänder, in denen neben
einfachsten Motiven des geometrischen Stiles ver-
schiedene Mäander und Volutenband wechseln.
Leider ist die Bemalung nur an gut geschützten
Stellen der Gefäße besser erhalten geblieben, während
sie sich in den unteren Partien selten eben noch
in Spuren nachweisen läßt.
Bei der Flächenfüllung mittels der parallel
nebeneinander gelegten Streifen blieb man nicht
stehen. Aus der Nesactium-Nekropole besitzt das
Museo civico in Pola eine skulpierte Kalkstein-
platte mit einem Flächenornament, das aus einer
Durchkreuzung schiefwinkliger Mäanderzüge sich
gebildet hat. Das vorliegende Ergebnis ist eigent-
lich ein Swastikaornament, bei dessen Entstehung
aber kaum das bekannte Symbol das ursprüngliche
bildete, sondern nur der vom Volutenbande her-
stammende schiefwinklige Mäander. Ein gleiches
Swastikaornament schmückt auch die Wandung von
Polenser Grabgefäßen (vgl. Fig. 88, 14).
Wurde aus diesem Flächenornament ein
einziger Mäanderzug herausgezogen und die an-
stoßenden Teile der Querzüge beibehalten, dann
ergaben sich die ganz eigenartigen Zwickel-
füllungen mit Hilfe einer Zickzacklinie, wie sie
z. B. das Grabgefäß Fig. 88, 3 zeigt, die mit
Rücksicht auf ihre Entstehung kaum eine andere
Erklärung finden lassen.
Der Kasteliierforschung liegt noch ein weites
Feld offen; die Verhältnisse in diesen altertümlichen
Siedlungsplätzen und ihren Nekropolen sind meist
derart günstige, daß jeder Grabungsversuch mit
reichem Gewinn abschließen kann. Auch auf dem
Kastellier von Pola und in seiner Nekropole liegen
noch unangetastete Fundschichten zur Verfügung
des Forschers, obwohl ihr Boden seit der vor-
römischen Epoche ohne Unterbrechung einen be-
deutenden Siedlungsplatz trägt, der in seinen
oberen Schichten durch die menschliche Tätigkeit
viele Veränderungen erlitten hat.
Konservator Prof. A. Gnirs
A. GniRS Eine vorrömische Nekropole innerhalb der Mauern des antiken Pola
96
sicher auch das Einweben eines Ziermusters in
das Webestück gekannt und geübt worden sein,
zu welcher Annahme die Frage nach der Herkunft
und Entwicklung des schiefwinkligen Mäanders
führen muß, der auf den Kastellieren beliebter
war als die ebenfalls verwendeten Typen des
klassischen rechtwinkligen Mäanders.
Das künstlerisch am höchsten stehende Orna-
ment der Kastellierzeit ist das Band der sich
gleichmäßig' ein- und aufrollenden Volute, die sich
in reicher Arbeit und tadelloser Ausführung bereits
auf den skulpierten Steinen der ältesten istrischen
Zeit vorfindet.1) Die der römischen Epoche un-
mittelbar vorangehende Kastellierzeit malt die
Volutenornamente auf Gefäße auf, und selbst die
unbeholfene Ritztechnik scheut nicht vor den
Schwierigkeiten zurück, mit denen das Einritzen
oder Einschneiden dieser kreisförmigen Linien-
formen in Gefäßwände verbunden ist. Mit auf-
genähten Schnüren konnte die Volute auch auf
Tücher, Gewandstücke u. dgl. gelegt werden: wo
aber die sich ein- und aufrollenden Linienelemente
durch den eingewebten Faden gezeichnet werden
sollten, mußten die Richtungsübergänge durch
Rundung aufgegeben werden. An Stelle der
Kurven trat dann die Brechung der geraden Linie,
und es entstand der eigenartige, schiefwinklige
Mäander. Derselbe erfährt insofern noch eine
Weiterbildung, indem man seine Bänder durch
entsprechende Kombination zu einem flächen-
füllenden Ornament erhob. Von ornamentierten
Tongefäßen, vor allem von Situlen der eu-
ganeischen und estensischen Nekropolen kennt
man die primitive Form der Flächenfüllung mit
Hilfe des Bandes, indem Streifen neben Streifen
rings um die Gefäßwand herumgezogen wurde, die
oft mit Ornamenten oder auch mit figuralen Dar-
stellungen g'efüllt wurden.2) Nach den oberitalischen
Vorbildern sind auch die Wandungen von Polenser
b Sticotti a. O. Seine Tafeln enthalten die Abbil-
dungen derartiger Skulpturen aus der vorrömischen Nekro-
pole Nesactiums.
2) Vgl. die Situla von Watsch u. ä. bei Hoernes Ur-
geschichte Taf. 35, estensische Situlen und Tongefäße bei
Montetjus La civilisation primitive en Italie.
Grabgefäßen ornamental gegliedert. Die Schmük-
kung mit konzentrischen Bändern beginnt an dem
breiten Mundsaum, wenn ein Deckel vorhanden ist,
schon auf diesem; am Halse, auf der Schulter und
Gefäßbauch folgen weitere Bänder, in denen neben
einfachsten Motiven des geometrischen Stiles ver-
schiedene Mäander und Volutenband wechseln.
Leider ist die Bemalung nur an gut geschützten
Stellen der Gefäße besser erhalten geblieben, während
sie sich in den unteren Partien selten eben noch
in Spuren nachweisen läßt.
Bei der Flächenfüllung mittels der parallel
nebeneinander gelegten Streifen blieb man nicht
stehen. Aus der Nesactium-Nekropole besitzt das
Museo civico in Pola eine skulpierte Kalkstein-
platte mit einem Flächenornament, das aus einer
Durchkreuzung schiefwinkliger Mäanderzüge sich
gebildet hat. Das vorliegende Ergebnis ist eigent-
lich ein Swastikaornament, bei dessen Entstehung
aber kaum das bekannte Symbol das ursprüngliche
bildete, sondern nur der vom Volutenbande her-
stammende schiefwinklige Mäander. Ein gleiches
Swastikaornament schmückt auch die Wandung von
Polenser Grabgefäßen (vgl. Fig. 88, 14).
Wurde aus diesem Flächenornament ein
einziger Mäanderzug herausgezogen und die an-
stoßenden Teile der Querzüge beibehalten, dann
ergaben sich die ganz eigenartigen Zwickel-
füllungen mit Hilfe einer Zickzacklinie, wie sie
z. B. das Grabgefäß Fig. 88, 3 zeigt, die mit
Rücksicht auf ihre Entstehung kaum eine andere
Erklärung finden lassen.
Der Kasteliierforschung liegt noch ein weites
Feld offen; die Verhältnisse in diesen altertümlichen
Siedlungsplätzen und ihren Nekropolen sind meist
derart günstige, daß jeder Grabungsversuch mit
reichem Gewinn abschließen kann. Auch auf dem
Kastellier von Pola und in seiner Nekropole liegen
noch unangetastete Fundschichten zur Verfügung
des Forschers, obwohl ihr Boden seit der vor-
römischen Epoche ohne Unterbrechung einen be-
deutenden Siedlungsplatz trägt, der in seinen
oberen Schichten durch die menschliche Tätigkeit
viele Veränderungen erlitten hat.
Konservator Prof. A. Gnirs