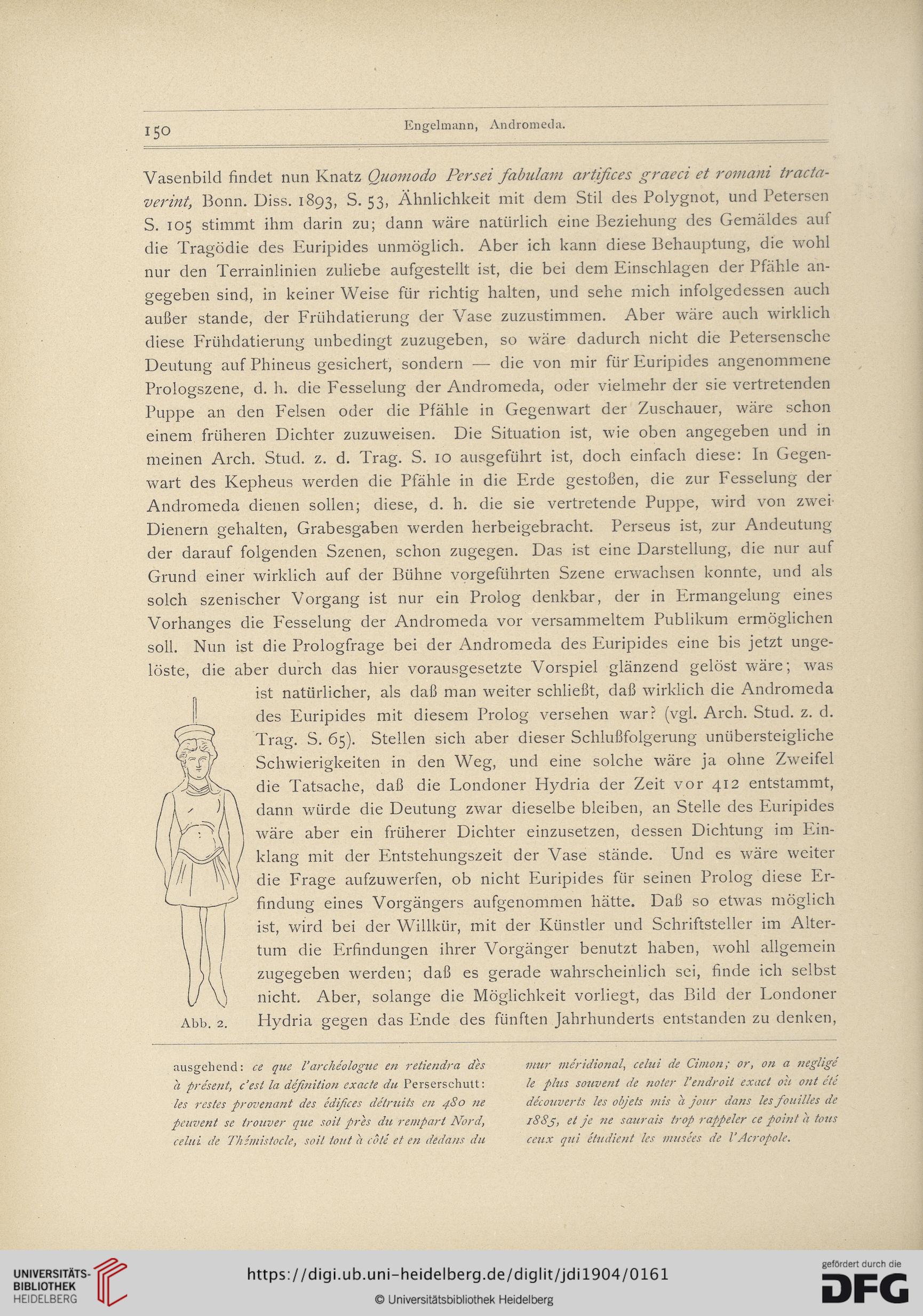Engelmann, Andromeda.
150
Vasenbild findet nun Knatz Quomodo Per sei fabulam artifices graeci et romani tracta-
verint, Bonn. Diss. 1893, S. 53, Ähnlichkeit mit dem Stil des Polygnot, und Petersen
S. 105 stimmt ihm darin zu; dann wäre natürlich eine Beziehung des Gemäldes auf
die Tragödie des Euripides unmöglich. Aber ich kann diese Behauptung, die wohl
nur den Terrainlinien zuliebe aufgestellt ist, die bei dem Einschlagen der Pfähle an-
gegeben sind, in keiner Weise für richtig halten, und sehe mich infolgedessen auch
außer stände, der Frühdatierung der Vase zuzustimmen. Aber wäre auch wirklich
diese Frühdatierung unbedingt zuzugeben, so wäre dadurch nicht die Petersensche
Deutung auf Phineus gesichert, sondern — die von mir für'Euripides angenommene
Prologszene, d. h. die Fesselung der Andromeda, oder vielmehr der sie vertretenden
Puppe an den Felsen oder die Pfähle in Gegenwart der Zuschauer, wäre schon
einem früheren Dichter zuzuweisen. Die Situation ist, wie oben angegeben und in
meinen Arch. Stud. z. d. Trag. S. 10 ausgeführt ist, doch einfach diese: In Gegen-
wart des Kepheus werden die Pfähle in die Erde gestoßen, die zur Fesselung der
Andromeda dienen sollen; diese, d. h. die sie vertretende Puppe, wird von zwei
Dienern gehalten, Grabesgaben werden herbeigebracht. Perseus ist, zur Andeutung
der darauf folgenden Szenen, schon zugegen. Das ist eine Darstellung, die nur auf
Grund einer wirklich auf der Bühne vorgeführten Szene erwachsen konnte, und als
solch szenischer Vorgang ist nur ein Prolog denkbar, der in Ermangelung eines
Vorhanges die Fesselung der Andromeda vor versammeltem Publikum ermöglichen
soll. Nun ist die Prologfrage bei der Andromeda des Euripides eine bis jetzt unge-
löste, die aber durch das hier vorausgesetzte Vorspiel glänzend gelöst wäre; was
ist natürlicher, als daß man weiter schließt, daß wirklich die Andromeda
des Euripides mit diesem Prolog versehen war? (vgl. Arch. Stud. z. d.
Trag. S. 65). Stellen sich aber dieser Schlußfolgerung unübersteigliche
Schwierigkeiten in den Weg, und eine solche wäre ja ohne Zweifel
die Tatsache, daß die Londoner Hydria der Zeit vor 412 entstammt,
dann würde die Deutung zwar dieselbe bleiben, an Stelle des Euripides
wäre aber ein früherer Dichter einzusetzen, dessen Dichtung im Ein-
klang mit der Entstehungszeit der Vase stände. Und es wäre weiter
die Frage aufzuwerfen, ob nicht Euripides für seinen Prolog diese Er-
findung eines Vorgängers aufgenommen hätte. Daß so etwas möglich
ist, wird bei der Willkür, mit der Künstler und Schriftsteller im Alter-
tum die Erfindungen ihrer Vorgänger benutzt haben, wohl allgemein
zugegeben werden; daß es gerade wahrscheinlich sei, finde ich selbst
nicht. Aber, solange die Möglichkeit vorliegt, das Bild der Londoner
Abb. 2. Hydria gegen das Binde des fünften Jahrhunderts entstanden zu denken,
ausgehend: ce que l’archeologue en retiendra des
a present, c’est la definition exacte du Perserschutt:
les restes provenant des edifices detruits en 480 ne
peuvent se irouver que seit pres du rempart Nord,
celui de Themistocle, soit lout a cote et en dedans du
mur meridional, celui de Ciinon; or, on a neglige
le plus souvent de noter l’endroit exact ou ont ete
deccnruerts les objets mis a jour dans les fouilles de
1885, et je ne saurais trop rappeler ce point a totis
ceux qtii etudient les musees de ΓAcropole.
150
Vasenbild findet nun Knatz Quomodo Per sei fabulam artifices graeci et romani tracta-
verint, Bonn. Diss. 1893, S. 53, Ähnlichkeit mit dem Stil des Polygnot, und Petersen
S. 105 stimmt ihm darin zu; dann wäre natürlich eine Beziehung des Gemäldes auf
die Tragödie des Euripides unmöglich. Aber ich kann diese Behauptung, die wohl
nur den Terrainlinien zuliebe aufgestellt ist, die bei dem Einschlagen der Pfähle an-
gegeben sind, in keiner Weise für richtig halten, und sehe mich infolgedessen auch
außer stände, der Frühdatierung der Vase zuzustimmen. Aber wäre auch wirklich
diese Frühdatierung unbedingt zuzugeben, so wäre dadurch nicht die Petersensche
Deutung auf Phineus gesichert, sondern — die von mir für'Euripides angenommene
Prologszene, d. h. die Fesselung der Andromeda, oder vielmehr der sie vertretenden
Puppe an den Felsen oder die Pfähle in Gegenwart der Zuschauer, wäre schon
einem früheren Dichter zuzuweisen. Die Situation ist, wie oben angegeben und in
meinen Arch. Stud. z. d. Trag. S. 10 ausgeführt ist, doch einfach diese: In Gegen-
wart des Kepheus werden die Pfähle in die Erde gestoßen, die zur Fesselung der
Andromeda dienen sollen; diese, d. h. die sie vertretende Puppe, wird von zwei
Dienern gehalten, Grabesgaben werden herbeigebracht. Perseus ist, zur Andeutung
der darauf folgenden Szenen, schon zugegen. Das ist eine Darstellung, die nur auf
Grund einer wirklich auf der Bühne vorgeführten Szene erwachsen konnte, und als
solch szenischer Vorgang ist nur ein Prolog denkbar, der in Ermangelung eines
Vorhanges die Fesselung der Andromeda vor versammeltem Publikum ermöglichen
soll. Nun ist die Prologfrage bei der Andromeda des Euripides eine bis jetzt unge-
löste, die aber durch das hier vorausgesetzte Vorspiel glänzend gelöst wäre; was
ist natürlicher, als daß man weiter schließt, daß wirklich die Andromeda
des Euripides mit diesem Prolog versehen war? (vgl. Arch. Stud. z. d.
Trag. S. 65). Stellen sich aber dieser Schlußfolgerung unübersteigliche
Schwierigkeiten in den Weg, und eine solche wäre ja ohne Zweifel
die Tatsache, daß die Londoner Hydria der Zeit vor 412 entstammt,
dann würde die Deutung zwar dieselbe bleiben, an Stelle des Euripides
wäre aber ein früherer Dichter einzusetzen, dessen Dichtung im Ein-
klang mit der Entstehungszeit der Vase stände. Und es wäre weiter
die Frage aufzuwerfen, ob nicht Euripides für seinen Prolog diese Er-
findung eines Vorgängers aufgenommen hätte. Daß so etwas möglich
ist, wird bei der Willkür, mit der Künstler und Schriftsteller im Alter-
tum die Erfindungen ihrer Vorgänger benutzt haben, wohl allgemein
zugegeben werden; daß es gerade wahrscheinlich sei, finde ich selbst
nicht. Aber, solange die Möglichkeit vorliegt, das Bild der Londoner
Abb. 2. Hydria gegen das Binde des fünften Jahrhunderts entstanden zu denken,
ausgehend: ce que l’archeologue en retiendra des
a present, c’est la definition exacte du Perserschutt:
les restes provenant des edifices detruits en 480 ne
peuvent se irouver que seit pres du rempart Nord,
celui de Themistocle, soit lout a cote et en dedans du
mur meridional, celui de Ciinon; or, on a neglige
le plus souvent de noter l’endroit exact ou ont ete
deccnruerts les objets mis a jour dans les fouilles de
1885, et je ne saurais trop rappeler ce point a totis
ceux qtii etudient les musees de ΓAcropole.