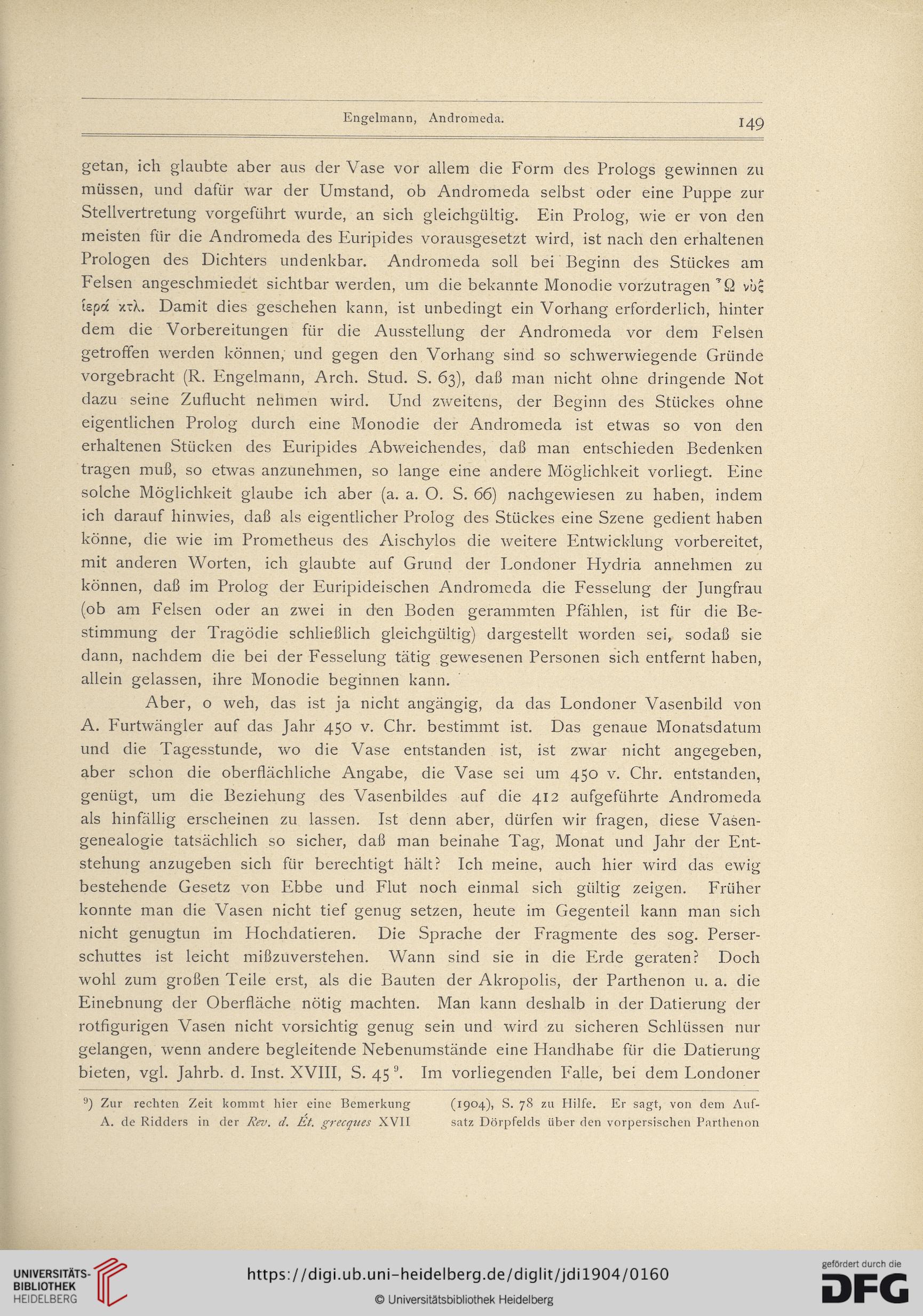Engelmann, Andromeda.
149
getan, ich glaubte aber aus der Vase vor allem die Form des Prologs gewinnen zu
müssen, und dafür war der Umstand, ob Andromeda selbst oder eine Puppe zur
Stellvertretung vorgeführt wurde, an sich gleichgültig. Ein Prolog, wie er von den
meisten für die Andromeda des Euripides vorausgesetzt wird, ist nach den erhaltenen
Prologen des Dichters undenkbar. Andromeda soll bei Beginn des Stückes am
Preisen angeschmiedet sichtbar werden, um die bekannte Monodie vorzutragen ~Ω ν'υς
ίερά κτλ. Damit dies geschehen kann, ist unbedingt ein Vorhang erforderlich, hinter
dem die Vorbereitungen für die Ausstellung der Andromeda vor dem Felsen
getroffen werden können, und gegen den Vorhang sind so schwerwiegende Gründe
vorgebracht (R. Engelmann, Arch. Stud. S. 63), daß man nicht ohne dringende Not
dazu seine Zuflucht nehmen wird. Und zweitens, der Beginn des Stückes ohne
eigentlichen Prolog durch eine Monodie der Andromeda ist etwas so von den
erhaltenen Stücken des Euripides Abweichendes, daß man entschieden Bedenken
tragen muß, so etwas anzunehmen, so lange eine andere Möglichkeit vorliegt. Eine
solche Möglichkeit glaube ich aber (a. a. O. S. 66) nachgewiesen zu haben, indem
ich darauf hinwies, daß als eigentlicher Prolog des Stückes eine Szene gedient haben
könne, die wie im Prometheus des Aischylos die weitere Entwicklung vorbereitet,
mit anderen Worten, ich glaubte auf Grund der Londoner Hydria annehmen zu
können, daß im Prolog der Euripideischen Andromeda die Fesselung der Jungfrau
(ob am Felsen oder an zwei in den Boden gerammten Pfählen, ist für die Be-
stimmung der Tragödie schließlich gleichgültig) dargestellt worden sei, sodaß sie
dann, nachdem die bei der Fesselung tätig gewesenen Personen sich entfernt haben,
allein gelassen, ihre Monodie beginnen kann.
Aber, o weh, das ist ja nicht angängig, da das Londoner Vasenbild von
A. Furtwängler auf das Jahr 450 v. Chr. bestimmt ist. Das genaue Monatsdatum
und die Tagesstunde, wo die Vase entstanden ist, ist zwar nicht angegeben,
aber schon die oberflächliche Angabe, die Vase sei um 450 v. Chr. entstanden,
genügt, um die Beziehung des Vasenbildes auf die 412 aufgeführte Andromeda
als hinfällig erscheinen zu lassen. Ist denn aber, dürfen wir fragen, diese Vasen-
genealogie tatsächlich so sicher, daß man beinahe Tag, Monat und Jahr der Ent-
stehung anzugeben sich für berechtigt hält? Ich meine, auch hier wird das ewig
bestehende Gesetz von Ebbe und Flut noch einmal sich gültig zeigen. Früher
konnte man die Vasen nicht tief genug setzen, heute im Gegenteil kann man sich
nicht genugtun im Hochdatieren. Die Sprache der Fragmente des sog. Perser-
schuttes ist leicht mißzuverstehen. Wann sind sie in die Erde geraten? Doch
wohl zum großen Teile erst, als die Bauten der Akropolis, der Parthenon u. a. die
Einebnung der Oberfläche nötig machten. Man kann deshalb in der Datierung der
rotfigurigen Vasen nicht vorsichtig genug sein und wird zu sicheren Schlüssen nur
gelangen, wenn andere begleitende Nebenumstände eine Handhabe für die Datierung
bieten, vgl. Jahrb. d. Inst. XVIII, S. 45°. Im vorliegenden Falle, bei dem Londoner
9) Zur rechten Zeit kommt hier eine Bemerkung
A. de Ridders in der Rev. d. Et. grecques XVII
(1904), S. 78 zu Hilfe. Er sagt, von dem Auf-
satz Dörpfelds über den vorpersischen Parthenon
149
getan, ich glaubte aber aus der Vase vor allem die Form des Prologs gewinnen zu
müssen, und dafür war der Umstand, ob Andromeda selbst oder eine Puppe zur
Stellvertretung vorgeführt wurde, an sich gleichgültig. Ein Prolog, wie er von den
meisten für die Andromeda des Euripides vorausgesetzt wird, ist nach den erhaltenen
Prologen des Dichters undenkbar. Andromeda soll bei Beginn des Stückes am
Preisen angeschmiedet sichtbar werden, um die bekannte Monodie vorzutragen ~Ω ν'υς
ίερά κτλ. Damit dies geschehen kann, ist unbedingt ein Vorhang erforderlich, hinter
dem die Vorbereitungen für die Ausstellung der Andromeda vor dem Felsen
getroffen werden können, und gegen den Vorhang sind so schwerwiegende Gründe
vorgebracht (R. Engelmann, Arch. Stud. S. 63), daß man nicht ohne dringende Not
dazu seine Zuflucht nehmen wird. Und zweitens, der Beginn des Stückes ohne
eigentlichen Prolog durch eine Monodie der Andromeda ist etwas so von den
erhaltenen Stücken des Euripides Abweichendes, daß man entschieden Bedenken
tragen muß, so etwas anzunehmen, so lange eine andere Möglichkeit vorliegt. Eine
solche Möglichkeit glaube ich aber (a. a. O. S. 66) nachgewiesen zu haben, indem
ich darauf hinwies, daß als eigentlicher Prolog des Stückes eine Szene gedient haben
könne, die wie im Prometheus des Aischylos die weitere Entwicklung vorbereitet,
mit anderen Worten, ich glaubte auf Grund der Londoner Hydria annehmen zu
können, daß im Prolog der Euripideischen Andromeda die Fesselung der Jungfrau
(ob am Felsen oder an zwei in den Boden gerammten Pfählen, ist für die Be-
stimmung der Tragödie schließlich gleichgültig) dargestellt worden sei, sodaß sie
dann, nachdem die bei der Fesselung tätig gewesenen Personen sich entfernt haben,
allein gelassen, ihre Monodie beginnen kann.
Aber, o weh, das ist ja nicht angängig, da das Londoner Vasenbild von
A. Furtwängler auf das Jahr 450 v. Chr. bestimmt ist. Das genaue Monatsdatum
und die Tagesstunde, wo die Vase entstanden ist, ist zwar nicht angegeben,
aber schon die oberflächliche Angabe, die Vase sei um 450 v. Chr. entstanden,
genügt, um die Beziehung des Vasenbildes auf die 412 aufgeführte Andromeda
als hinfällig erscheinen zu lassen. Ist denn aber, dürfen wir fragen, diese Vasen-
genealogie tatsächlich so sicher, daß man beinahe Tag, Monat und Jahr der Ent-
stehung anzugeben sich für berechtigt hält? Ich meine, auch hier wird das ewig
bestehende Gesetz von Ebbe und Flut noch einmal sich gültig zeigen. Früher
konnte man die Vasen nicht tief genug setzen, heute im Gegenteil kann man sich
nicht genugtun im Hochdatieren. Die Sprache der Fragmente des sog. Perser-
schuttes ist leicht mißzuverstehen. Wann sind sie in die Erde geraten? Doch
wohl zum großen Teile erst, als die Bauten der Akropolis, der Parthenon u. a. die
Einebnung der Oberfläche nötig machten. Man kann deshalb in der Datierung der
rotfigurigen Vasen nicht vorsichtig genug sein und wird zu sicheren Schlüssen nur
gelangen, wenn andere begleitende Nebenumstände eine Handhabe für die Datierung
bieten, vgl. Jahrb. d. Inst. XVIII, S. 45°. Im vorliegenden Falle, bei dem Londoner
9) Zur rechten Zeit kommt hier eine Bemerkung
A. de Ridders in der Rev. d. Et. grecques XVII
(1904), S. 78 zu Hilfe. Er sagt, von dem Auf-
satz Dörpfelds über den vorpersischen Parthenon