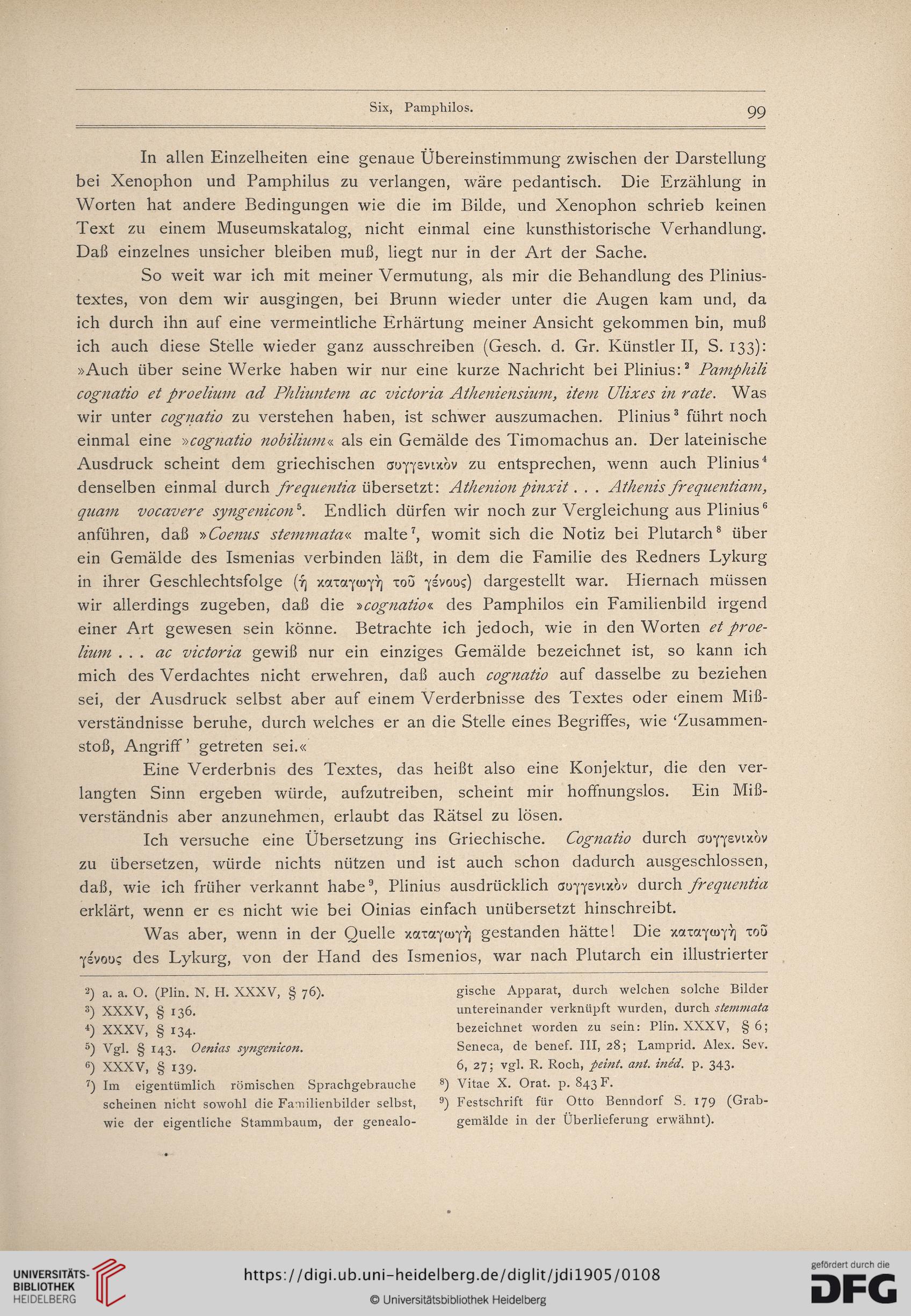Six, Pamphilos.
In allen Einzelheiten eine genaue Übereinstimmung zwischen der Darstellung
bei Xenophon und Pamphilus zu verlangen, wäre pedantisch. Die Erzählung in
Worten hat andere Bedingungen wie die im Bilde, und Xenophon schrieb keinen
Text zu einem Museumskatalog, nicht einmal eine kunsthistorische Verhandlung.
Daß einzelnes unsicher bleiben muß, liegt nur in der Art der Sache.
So weit war ich mit meiner Vermutung, als mir die Behandlung des Plinius-
textes, von dem wir ausgingen, bei Brunn wieder unter die Augen kam und, da
ich durch ihn auf eine vermeintliche Erhärtung meiner Ansicht gekommen bin, muß
ich auch diese Stelle wieder ganz ausschreiben (Gesch. d. Gr. Künstler II, S. 133):
»Auch über seine Werke haben wir nur eine kurze Nachricht bei Plinius:2 3 Pamphili
cognatio et proelium ad Phliuntem ac victoria Atheniensium, item Ulixes in rate. Was
wir unter cognatio zu verstehen haben, ist schwer auszumachen. Plinius3 führt noch
einmal eine '»cognatio nobilium«. als ein Gemälde des Timomachus an. Der lateinische
Ausdruck scheint dem griechischen συγγενικόν zu entsprechen, wenn auch Plinius4 *
denselben einmal durch frequentia übersetzt: Athenionpinxit. . . Athenis frequentiam,
quam vocavere syngenicond. Endlich dürfen wir noch zur Vergleichung aus Plinius6
anführen, daß »Coenus stemmata«. malte7, womit sich die Notiz bei Plutarch8 über
ein Gemälde des Ismenias verbinden läßt, in dem die Familie des Redners Lykurg
in ihrer Geschlechtsfolge (ή καταγωγή του γένους) dargestellt war. Hiernach müssen
wir allerdings zugeben, daß die cognatio« des Pamphilos ein Familienbild irgend
einer Art gewesen sein könne. Betrachte ich jedoch, wie in den Worten et proe-
lium . . . ac victoria gewiß nur ein einziges Gemälde bezeichnet ist, so kann ich
mich des Verdachtes nicht erwehren, daß auch cognatio auf dasselbe zu beziehen
sei, der Ausdruck selbst aber auf einem Verderbnisse des Textes oder einem Miß-
verständnisse beruhe, durch welches er an die Stelle eines Begriffes, wie ‘Zusammen-
stoß, Angriff’ getreten sei.«
Eine Verderbnis des Textes, das heißt also eine Konjektur, die den ver-
langten Sinn ergeben würde, aufzutreiben, scheint mir hoffnungslos. Ein Miß-
verständnis aber anzunehmen, erlaubt das Rätsel zu lösen.
Ich versuche eine Übersetzung ins Griechische. Cognatio durch συγγενικόν
zu übersetzen, würde nichts nützen und ist auch schon dadurch ausgeschlossen,
daß, wie ich früher verkannt habe9, Plinius ausdrücklich συγγενικόν durch frequentia
erklärt, wenn er es nicht wie bei Oinias einfach unübersetzt hinschreibt.
Was aber, wenn in der Quelle καταγωγή gestanden hätte! Die καταγωγή του
γένους des Lykurg, von der Hand des Ismenios, war nach Plutarch ein illustrierter
2) a. a. O. (Plin. N. PI. XXXV, § 76).
3) XXXV, § 136.
4) XXXV, § 134.
5) Vgl. § 143. Oenias syngenicon.
6) XXXV, § 139.
7) Im eigentümlich römischen Sprachgebrauche
scheinen nicht sowohl die Familienbilder selbst,
wie der eigentliche Stammbaum, der genealo¬
gische Apparat, durch welchen solche Bilder
untereinander verknüpft wurden, durch stemmata
bezeichnet worden zu sein: Plin. XXXV, § 6;
Seneca, de benef. III, 28; Lamprid. Alex. Sev.
6, 27; vgl. R. Roch, feint. ant. ined. p. 343.
8) Vitae X. Orat. p. 843 F.
9) Festschrift für Otto Benndorf S. 179 (Grab-
gemälde in der Überlieferung erwähnt).
In allen Einzelheiten eine genaue Übereinstimmung zwischen der Darstellung
bei Xenophon und Pamphilus zu verlangen, wäre pedantisch. Die Erzählung in
Worten hat andere Bedingungen wie die im Bilde, und Xenophon schrieb keinen
Text zu einem Museumskatalog, nicht einmal eine kunsthistorische Verhandlung.
Daß einzelnes unsicher bleiben muß, liegt nur in der Art der Sache.
So weit war ich mit meiner Vermutung, als mir die Behandlung des Plinius-
textes, von dem wir ausgingen, bei Brunn wieder unter die Augen kam und, da
ich durch ihn auf eine vermeintliche Erhärtung meiner Ansicht gekommen bin, muß
ich auch diese Stelle wieder ganz ausschreiben (Gesch. d. Gr. Künstler II, S. 133):
»Auch über seine Werke haben wir nur eine kurze Nachricht bei Plinius:2 3 Pamphili
cognatio et proelium ad Phliuntem ac victoria Atheniensium, item Ulixes in rate. Was
wir unter cognatio zu verstehen haben, ist schwer auszumachen. Plinius3 führt noch
einmal eine '»cognatio nobilium«. als ein Gemälde des Timomachus an. Der lateinische
Ausdruck scheint dem griechischen συγγενικόν zu entsprechen, wenn auch Plinius4 *
denselben einmal durch frequentia übersetzt: Athenionpinxit. . . Athenis frequentiam,
quam vocavere syngenicond. Endlich dürfen wir noch zur Vergleichung aus Plinius6
anführen, daß »Coenus stemmata«. malte7, womit sich die Notiz bei Plutarch8 über
ein Gemälde des Ismenias verbinden läßt, in dem die Familie des Redners Lykurg
in ihrer Geschlechtsfolge (ή καταγωγή του γένους) dargestellt war. Hiernach müssen
wir allerdings zugeben, daß die cognatio« des Pamphilos ein Familienbild irgend
einer Art gewesen sein könne. Betrachte ich jedoch, wie in den Worten et proe-
lium . . . ac victoria gewiß nur ein einziges Gemälde bezeichnet ist, so kann ich
mich des Verdachtes nicht erwehren, daß auch cognatio auf dasselbe zu beziehen
sei, der Ausdruck selbst aber auf einem Verderbnisse des Textes oder einem Miß-
verständnisse beruhe, durch welches er an die Stelle eines Begriffes, wie ‘Zusammen-
stoß, Angriff’ getreten sei.«
Eine Verderbnis des Textes, das heißt also eine Konjektur, die den ver-
langten Sinn ergeben würde, aufzutreiben, scheint mir hoffnungslos. Ein Miß-
verständnis aber anzunehmen, erlaubt das Rätsel zu lösen.
Ich versuche eine Übersetzung ins Griechische. Cognatio durch συγγενικόν
zu übersetzen, würde nichts nützen und ist auch schon dadurch ausgeschlossen,
daß, wie ich früher verkannt habe9, Plinius ausdrücklich συγγενικόν durch frequentia
erklärt, wenn er es nicht wie bei Oinias einfach unübersetzt hinschreibt.
Was aber, wenn in der Quelle καταγωγή gestanden hätte! Die καταγωγή του
γένους des Lykurg, von der Hand des Ismenios, war nach Plutarch ein illustrierter
2) a. a. O. (Plin. N. PI. XXXV, § 76).
3) XXXV, § 136.
4) XXXV, § 134.
5) Vgl. § 143. Oenias syngenicon.
6) XXXV, § 139.
7) Im eigentümlich römischen Sprachgebrauche
scheinen nicht sowohl die Familienbilder selbst,
wie der eigentliche Stammbaum, der genealo¬
gische Apparat, durch welchen solche Bilder
untereinander verknüpft wurden, durch stemmata
bezeichnet worden zu sein: Plin. XXXV, § 6;
Seneca, de benef. III, 28; Lamprid. Alex. Sev.
6, 27; vgl. R. Roch, feint. ant. ined. p. 343.
8) Vitae X. Orat. p. 843 F.
9) Festschrift für Otto Benndorf S. 179 (Grab-
gemälde in der Überlieferung erwähnt).