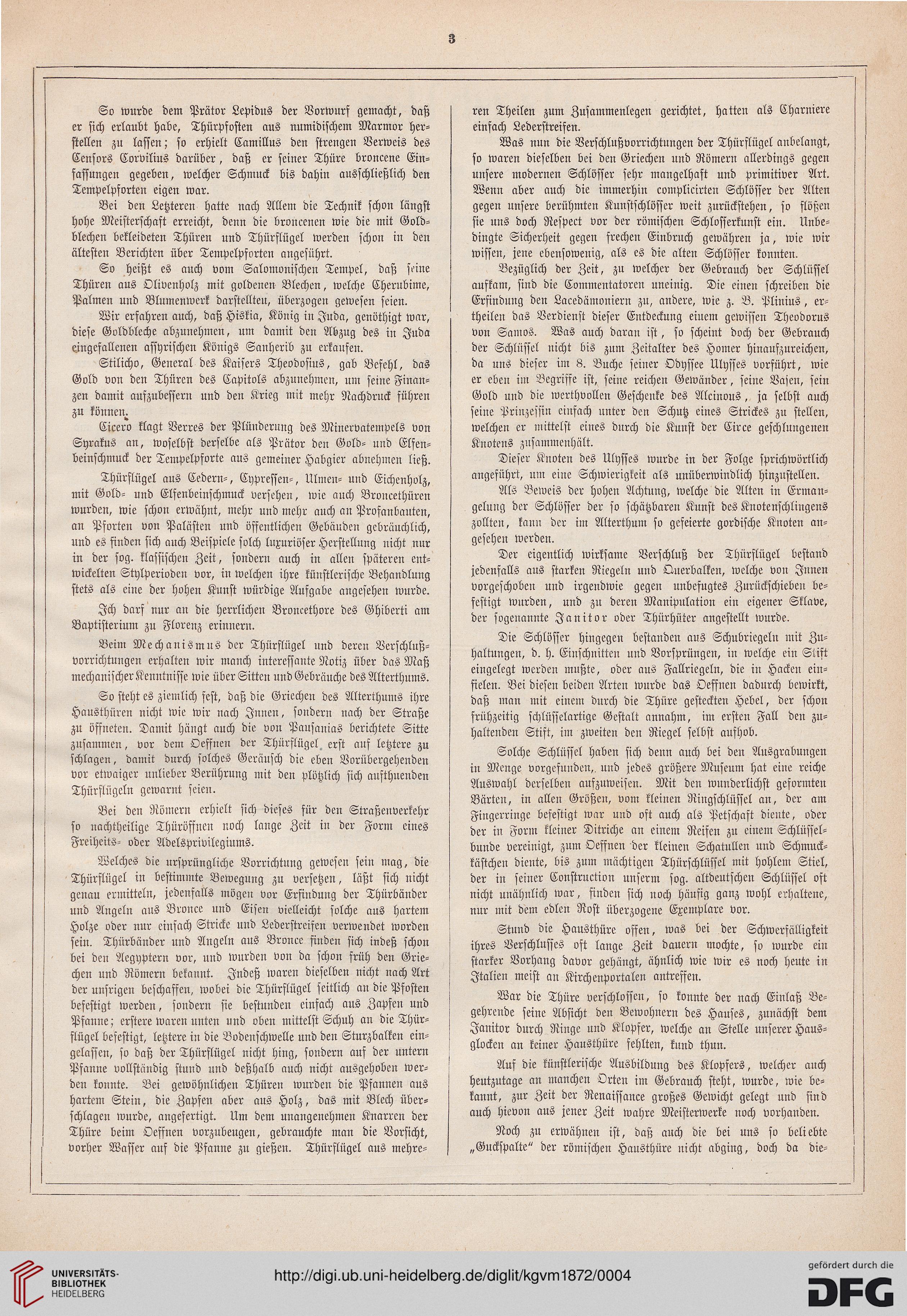3
So wurde dem Prätor Lepidus der Vorwurf gemacht, daß
er sich erlaubt habe, Thürpfosten aus numidischem Marmor Her-
stellen zu lassen; so erhielt Camillus den strengen Verweis des
Censors Corvilius darüber, daß er seiner Thüre broncene Ein-
fassungen gegeben, welcher Schmuck bis dahin ausschließlich den
Tempelpforten eigen war.
Bei den Letzteren hatte nach Allem die Technik schon längst
hohe Meisterschaft erreicht, denn die broncenen wie die mit Gold-
blechen bekleideten Thüren und Thürflügel werden schon in den
ältesten Berichten über Tempelpfartcn angeführt.
So heißt es auch vom Salomonischen Tempel, daß seine
Thüren aus Olivenholz mit goldenen- Blechen, welche Cherubime,
Palmen und Blumenwerk darstellteu, überzogen gewesen seien.
Wir erfahren auch, daß Hiskia, König in Juda, genöthigt war,
diese Goldbleche abzunehmen, um damit den Abzug des in Juda
eingefallenen assyrischen Königs Sanherib zu erkaufen.
Stilicho, General des Kaisers Theodosius, gab Befehl, das
Gold von den Thüren des Capitols abzunehmen, um seine Finan-
zen damit aufzubessern und den Krieg mit mehr Nachdruck führen
zu können.
Cicero klagt Verres der Plünderung des Minervatempels von
Syrakus an, woselbst derselbe als Prätor den Gold- und Elfen-
beinschmuck der Tempelpforte aus gemeiner Habgier abnehmen ließ.
Thürflügel aus Cedern-, Cypressen-, Ulmen- und Eichenholz,
mit Gold- und Elfenbeinschmuck versehen, wie auch Broncethüren
wurden, wie schon erwähnt, mehr und mehr auch an Profanbauten,
an Pforten von Palästen und öffentlichen Gebäuden gebräuchlich,
und es finden sich auch Beispiele solch luxuriöser Herstellung nicht nur
in der sog. klassischen Zeit, sondern auch in allen späteren ent-
wickelten Stylperioden vor, in welchen ihre künstlerische Behandlung
stets als eine der hohen Kunst würdige Aufgabe angesehen wurde.
Ich darf nur an die herrlichen Broncethore des Ghiberti am
Baptisterium zu Florenz erinnern.
Beim Mechanismus der Thürflügel und deren Verschluß-
Vorrichtungen erhalten wir manch interessante Notiz über das Maß
mechanischer Kenntnisse wie über Sitten und Gebräuche des Alterthums.
So steht es ziemlich fest, daß die Griechen des Alterthums ihre
Hausthüren nicht wie wir nach Innen, sondern nach der Straße
zu öffneten. Damit hängt auch die von Pausanias berichtete Sitte
zusammen, vor dem Oeffnen der Thürflügel, erst auf letztere zu
schlagen, damit durch solches Geräusch die eben Vorübergehenden
vor etwaiger unlieber Berührung mit den plötzlich sich aufthuenden
Thürflügeln gewarnt seien.
Bei den Römern erhielt sich dieses für den Straßenverkehr
so nachtheilige Thüröffnen noch lange Zeit in der Form eines
Freiheits- oder Adelsprivilegiums.
Welches die ursprüngliche Vorrichtung gewesen sein mag, die
Thürflügel in bestimmte Bewegung zu versetzen, läßt sich nicht
genau ermitteln, jedenfalls mögen vor Erfindung der Thürbänder
und Angeln aus Bronce und Eisen vielleicht solche aus hartem
Holze oder nur einfach Stricke und Lederstreifen verwendet worden
sein. Thürbänder und Angeln aus Bronce finden sich indeß schon
bei den Aegyptern vor, und wurden von da schon früh den Grie-
chen und Römern bekannt. Indeß waren dieselben nicht nach Art
der unsrigen beschaffen, wobei die Thürflügel seitlich an die Pfosten
befestigt werden, sondern sie bestunden einfach aus Zapfen und
Pfanne; crstere waren unten und oben mittelst Schuh an die Thür-
flügel befestigt, letztere in die Bodenschwelle und den Sturzbalken ein-
gelassen, so daß der Thürflügel nicht hing, sondern auf der untern t
Pfanne vollständig stund und deßhalb auch nicht ausgehoben wer-
den konnte. Bei gewöhnlichen Thüren wurden die Pfannen aus
hartem Stein, die Zapfen aber aus Holz, das mit Blech über-
schlagen wurde, angefertigt. Um dem unangenehmen Knarren der
Thüre beim Oeffnen vorzubeugen, gebrauchte man die Vorsicht,
vorher Wasser auf die Pfanne zu gießen. Thürflügel aus mehre-
ren Theilen zum Zusammenlegen gerichtet, hatten als Charniere
einfach Lederstreifen.
Was nun die Berschlußvorrichtungen der Thürflügel anbelangt,
so waren dieselben bei den Griechen und Römern allerdings gegen
unsere modernen Schlösser sehr mangelhaft und primitiver Art.
Wenn aber auch die immerhin complicirten Schlösser der Alten
gegen unsere berühmten Kunstschlösser weit zurückstehen, so flößen
sie uns doch Respect vor der römischen Schlosserkunst ein. Unbe-
dingte Sicherheit gegen frechen Einbruch gewähren ja, wie wir
wissen, jene ebensowenig, als es die alten Schlösser konnten.
Bezüglich der Zeit, zu welcher der Gebrauch der Schlüssel
aufkam, sind die Commentatoren uneinig. Die einen schreiben die
Erfindung den Lacedämoniern zu, andere, wie z. B. Plinius, er-
theilen das Verdienst dieser Entdeckung einem gewissen Theodorus
von Samos. Was auch daran ist, so scheint doch der Gebrauch
der Schlüssel nicht bis zum Zeitalter des Homer hinaufzureichen,
da uns dieser im 8. Buche seiner Odyssee Ulysses vorführt, wie
er eben im Begriffe ist, seine reichen Gewänder, seine Vasen, sein
Gold und die werthvollen Geschenke des Alcinous, ja selbst auch
seine Prinzessin einfach unter den Schutz eines Strickes zu stellen,
welchen er mittelst eines durch die Kunst der Circe geschlungenen
Knotens zusammenhält.
Dieser Knoten des Ulysses wurde in der Folge sprichwörtlich
angeführt, um eine Schwierigkeit als unüberwindlich hinzustellen.
Als Beweis der hohen Achtung, welche die Alten in Erman-
gelung der Schlösser der so schätzbaren Kunst des Knotenschlingens
zollten, kann der im Alterthum so gefeierte gordische Knoten an-
gesehen werden.
Der eigentlich wirksame Verschluß der Thürflügel bestand
jedenfalls aus starken Riegeln und Querbalken, welche von Innen
vorgeschoben und irgendwie gegen unbefugtes Zurückschieben be-
festigt wurden, und zu deren Manipulation ein eigener Sklave,
der sogenannte Janitor oder Thürhüter angestellt wurde.
Die Schlösser hingegen bestanden aus Schubriegeln mit Zu-
haltungen, d. h. Einschnitten und Vorsprüngen, in welche ein Stift
eingelegt werden mußte, oder aus Fallriegeln, die in Hacken ein-
fielen. Bei diesen beiden Arten wurde das Oeffnen dadurch bewirkt,
daß man mit einem durch die Thüre gesteckten Hebel, der schon
frühzeitig schlüsselartige Gestalt annahm, im ersten Fall den zn-
haltenden Stift, im zweiten den Riegel selbst aufhob.
Solche Schliiffcl haben sich denn auch bei den Ausgrabungen
in Menge vorgefunden,, und jedes größere Museum hat eine reiche
Auswahl derselben aufzuweisen. Mit den wunderlichst geformten
Bärten, in allen Größen, vom kleinen Ringschlüssel an, der am
Fingerringe befestigt war und oft auch als Petschaft diente, oder
der in Form kleiner Ditriche an einem Reifen zu einem Schlüssel-
bunde vereinigt, zum Oeffnen der kleinen Schatullen und Schmuck-
kästchen diente, bis zum mächtigen Thürschlüssel mit hohlem Stiel,
der in seiner Constrnction unserm sog. altdeutschen Schlüssel oft
nicht unähnlich war, finden sich noch häufig ganz wohl erhaltene,
nur mit dem edlen Rost überzogene Exemplare vor.
Stund die Hausthüre offen, was bei der Schwerfälligkeit
ihres Verschlusses oft lange Zeit dauern mochte, so wurde ein
starker Vorhang davor gehängt, ähnlich wie wir es noch heute in
Italien meist an Kirchenportalen antreffen.
War die Thüre verschlossen, so konnte der nach Einlaß Be-
gehrende seine Absicht den Bewohnern des Hauses, zunächst dem
Janitor durch Ringe und Klopfer, welche an Stelle unserer Haus-
glocken an keiner Hausthüre fehlten, kund thun.
Auf die künstlerische Ausbildung des Klopfers, welcher auch
heutzutage an manchen Orten im Gebrauch steht, wurde, wie be-
kannt, zur Zeit der Renaissance großes Gewicht gelegt und sind
auch hievon aus jener Zeit wahre Meisterwerke noch vorhanden.
Noch zu erwähnen ist, daß auch die bei uns so beliebte
„Guckspalte" der römischen Hausthüre nicht abging, doch da die-
So wurde dem Prätor Lepidus der Vorwurf gemacht, daß
er sich erlaubt habe, Thürpfosten aus numidischem Marmor Her-
stellen zu lassen; so erhielt Camillus den strengen Verweis des
Censors Corvilius darüber, daß er seiner Thüre broncene Ein-
fassungen gegeben, welcher Schmuck bis dahin ausschließlich den
Tempelpforten eigen war.
Bei den Letzteren hatte nach Allem die Technik schon längst
hohe Meisterschaft erreicht, denn die broncenen wie die mit Gold-
blechen bekleideten Thüren und Thürflügel werden schon in den
ältesten Berichten über Tempelpfartcn angeführt.
So heißt es auch vom Salomonischen Tempel, daß seine
Thüren aus Olivenholz mit goldenen- Blechen, welche Cherubime,
Palmen und Blumenwerk darstellteu, überzogen gewesen seien.
Wir erfahren auch, daß Hiskia, König in Juda, genöthigt war,
diese Goldbleche abzunehmen, um damit den Abzug des in Juda
eingefallenen assyrischen Königs Sanherib zu erkaufen.
Stilicho, General des Kaisers Theodosius, gab Befehl, das
Gold von den Thüren des Capitols abzunehmen, um seine Finan-
zen damit aufzubessern und den Krieg mit mehr Nachdruck führen
zu können.
Cicero klagt Verres der Plünderung des Minervatempels von
Syrakus an, woselbst derselbe als Prätor den Gold- und Elfen-
beinschmuck der Tempelpforte aus gemeiner Habgier abnehmen ließ.
Thürflügel aus Cedern-, Cypressen-, Ulmen- und Eichenholz,
mit Gold- und Elfenbeinschmuck versehen, wie auch Broncethüren
wurden, wie schon erwähnt, mehr und mehr auch an Profanbauten,
an Pforten von Palästen und öffentlichen Gebäuden gebräuchlich,
und es finden sich auch Beispiele solch luxuriöser Herstellung nicht nur
in der sog. klassischen Zeit, sondern auch in allen späteren ent-
wickelten Stylperioden vor, in welchen ihre künstlerische Behandlung
stets als eine der hohen Kunst würdige Aufgabe angesehen wurde.
Ich darf nur an die herrlichen Broncethore des Ghiberti am
Baptisterium zu Florenz erinnern.
Beim Mechanismus der Thürflügel und deren Verschluß-
Vorrichtungen erhalten wir manch interessante Notiz über das Maß
mechanischer Kenntnisse wie über Sitten und Gebräuche des Alterthums.
So steht es ziemlich fest, daß die Griechen des Alterthums ihre
Hausthüren nicht wie wir nach Innen, sondern nach der Straße
zu öffneten. Damit hängt auch die von Pausanias berichtete Sitte
zusammen, vor dem Oeffnen der Thürflügel, erst auf letztere zu
schlagen, damit durch solches Geräusch die eben Vorübergehenden
vor etwaiger unlieber Berührung mit den plötzlich sich aufthuenden
Thürflügeln gewarnt seien.
Bei den Römern erhielt sich dieses für den Straßenverkehr
so nachtheilige Thüröffnen noch lange Zeit in der Form eines
Freiheits- oder Adelsprivilegiums.
Welches die ursprüngliche Vorrichtung gewesen sein mag, die
Thürflügel in bestimmte Bewegung zu versetzen, läßt sich nicht
genau ermitteln, jedenfalls mögen vor Erfindung der Thürbänder
und Angeln aus Bronce und Eisen vielleicht solche aus hartem
Holze oder nur einfach Stricke und Lederstreifen verwendet worden
sein. Thürbänder und Angeln aus Bronce finden sich indeß schon
bei den Aegyptern vor, und wurden von da schon früh den Grie-
chen und Römern bekannt. Indeß waren dieselben nicht nach Art
der unsrigen beschaffen, wobei die Thürflügel seitlich an die Pfosten
befestigt werden, sondern sie bestunden einfach aus Zapfen und
Pfanne; crstere waren unten und oben mittelst Schuh an die Thür-
flügel befestigt, letztere in die Bodenschwelle und den Sturzbalken ein-
gelassen, so daß der Thürflügel nicht hing, sondern auf der untern t
Pfanne vollständig stund und deßhalb auch nicht ausgehoben wer-
den konnte. Bei gewöhnlichen Thüren wurden die Pfannen aus
hartem Stein, die Zapfen aber aus Holz, das mit Blech über-
schlagen wurde, angefertigt. Um dem unangenehmen Knarren der
Thüre beim Oeffnen vorzubeugen, gebrauchte man die Vorsicht,
vorher Wasser auf die Pfanne zu gießen. Thürflügel aus mehre-
ren Theilen zum Zusammenlegen gerichtet, hatten als Charniere
einfach Lederstreifen.
Was nun die Berschlußvorrichtungen der Thürflügel anbelangt,
so waren dieselben bei den Griechen und Römern allerdings gegen
unsere modernen Schlösser sehr mangelhaft und primitiver Art.
Wenn aber auch die immerhin complicirten Schlösser der Alten
gegen unsere berühmten Kunstschlösser weit zurückstehen, so flößen
sie uns doch Respect vor der römischen Schlosserkunst ein. Unbe-
dingte Sicherheit gegen frechen Einbruch gewähren ja, wie wir
wissen, jene ebensowenig, als es die alten Schlösser konnten.
Bezüglich der Zeit, zu welcher der Gebrauch der Schlüssel
aufkam, sind die Commentatoren uneinig. Die einen schreiben die
Erfindung den Lacedämoniern zu, andere, wie z. B. Plinius, er-
theilen das Verdienst dieser Entdeckung einem gewissen Theodorus
von Samos. Was auch daran ist, so scheint doch der Gebrauch
der Schlüssel nicht bis zum Zeitalter des Homer hinaufzureichen,
da uns dieser im 8. Buche seiner Odyssee Ulysses vorführt, wie
er eben im Begriffe ist, seine reichen Gewänder, seine Vasen, sein
Gold und die werthvollen Geschenke des Alcinous, ja selbst auch
seine Prinzessin einfach unter den Schutz eines Strickes zu stellen,
welchen er mittelst eines durch die Kunst der Circe geschlungenen
Knotens zusammenhält.
Dieser Knoten des Ulysses wurde in der Folge sprichwörtlich
angeführt, um eine Schwierigkeit als unüberwindlich hinzustellen.
Als Beweis der hohen Achtung, welche die Alten in Erman-
gelung der Schlösser der so schätzbaren Kunst des Knotenschlingens
zollten, kann der im Alterthum so gefeierte gordische Knoten an-
gesehen werden.
Der eigentlich wirksame Verschluß der Thürflügel bestand
jedenfalls aus starken Riegeln und Querbalken, welche von Innen
vorgeschoben und irgendwie gegen unbefugtes Zurückschieben be-
festigt wurden, und zu deren Manipulation ein eigener Sklave,
der sogenannte Janitor oder Thürhüter angestellt wurde.
Die Schlösser hingegen bestanden aus Schubriegeln mit Zu-
haltungen, d. h. Einschnitten und Vorsprüngen, in welche ein Stift
eingelegt werden mußte, oder aus Fallriegeln, die in Hacken ein-
fielen. Bei diesen beiden Arten wurde das Oeffnen dadurch bewirkt,
daß man mit einem durch die Thüre gesteckten Hebel, der schon
frühzeitig schlüsselartige Gestalt annahm, im ersten Fall den zn-
haltenden Stift, im zweiten den Riegel selbst aufhob.
Solche Schliiffcl haben sich denn auch bei den Ausgrabungen
in Menge vorgefunden,, und jedes größere Museum hat eine reiche
Auswahl derselben aufzuweisen. Mit den wunderlichst geformten
Bärten, in allen Größen, vom kleinen Ringschlüssel an, der am
Fingerringe befestigt war und oft auch als Petschaft diente, oder
der in Form kleiner Ditriche an einem Reifen zu einem Schlüssel-
bunde vereinigt, zum Oeffnen der kleinen Schatullen und Schmuck-
kästchen diente, bis zum mächtigen Thürschlüssel mit hohlem Stiel,
der in seiner Constrnction unserm sog. altdeutschen Schlüssel oft
nicht unähnlich war, finden sich noch häufig ganz wohl erhaltene,
nur mit dem edlen Rost überzogene Exemplare vor.
Stund die Hausthüre offen, was bei der Schwerfälligkeit
ihres Verschlusses oft lange Zeit dauern mochte, so wurde ein
starker Vorhang davor gehängt, ähnlich wie wir es noch heute in
Italien meist an Kirchenportalen antreffen.
War die Thüre verschlossen, so konnte der nach Einlaß Be-
gehrende seine Absicht den Bewohnern des Hauses, zunächst dem
Janitor durch Ringe und Klopfer, welche an Stelle unserer Haus-
glocken an keiner Hausthüre fehlten, kund thun.
Auf die künstlerische Ausbildung des Klopfers, welcher auch
heutzutage an manchen Orten im Gebrauch steht, wurde, wie be-
kannt, zur Zeit der Renaissance großes Gewicht gelegt und sind
auch hievon aus jener Zeit wahre Meisterwerke noch vorhanden.
Noch zu erwähnen ist, daß auch die bei uns so beliebte
„Guckspalte" der römischen Hausthüre nicht abging, doch da die-