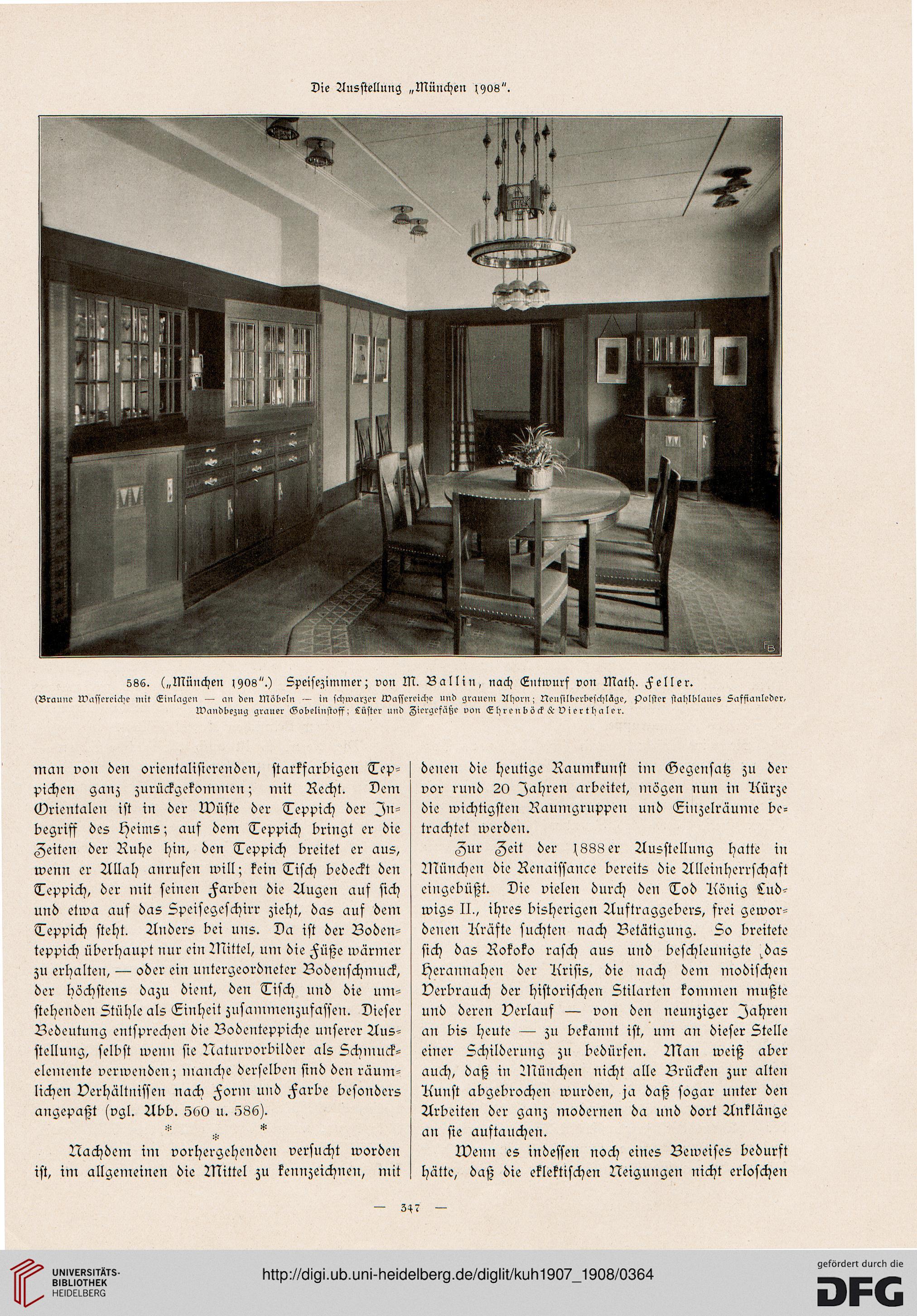Die Ausstellung „München ,yo8".
!i
fj
\m\
! *
586. („München ,908".) Speisezimmer; von M. Ballin, nach Entwurf von Math. Feiler.
(Braune Wassereiche mit Einlagen — an den Möbeln — in schwarzer Wassereiche und grauem Ahorn; Neusilberbeschläge, Polster stahlblaues Saffianleder,
Wandbezug grauer Gobelinstoff; Lüster und Aiergefäße von E hren b ö ck & £> i er 11} ci Ier.
man von den orientalisierenden, starkfarbigen Tep-
pichen ganz zurückgekommen; mit Recht. Dem
Orientalen ist in der Wüste der Teppich der In-
begriff des Heims; auf dem Teppich bringt er die
Zeiten der Ruhe hin, den Teppich breitet er aus,
wenn er Allah anrnfen will; kein Tisch bedeckt de,i
Teppich, der mit seinen Farben die Augen aus sich
und etwa auf das Speisegeschirr zieht, das auf dem
Teppich steht. Anders bei uns. Da ist der Boden-
teppich überhaupt nur ein Mittel, um die Füße wärmer
zu erhalten, — oder ein untergeordneter Bodenschmuck,
der höchstens dazu dient, den Tisch und die um-
stehenden Stühle als Einheit zusanrmenzufaffen. Dieser
Bedeutung entsprechen die Bodenteppiche unserer Aus-
stellung, selbst wenn sie Naturvorbilder als Schmuck-
elemente verwenden; manche derselben sind den räum-
lichen Verhältnissen nach Form und Farbe besonders
angepaßt (vgl. Abb. 560 u. 586).
* *
Nachdem im vorhergehenden versucht worden
ist, im allgemeinen die Mittel zu kennzeichnen, mit
denen die heutige Raumkunst im Gegensatz zu der
vor rund 20 Jahren arbeitet, mögen nun in Kürze
die wichtigsten Raumgruppen und Einzelräume be-
trachtet werden.
Zur Zeit der 1(888 er Ausstellung hatte in
München die Renaissance bereits die Alleinherrschaft
eingebüßt. Die vielen durch den Tod König Lud-
wigs II., ihres bisherigen Auftraggebers, frei gewor-
denen Kräfte suchten nach Betätigung. So breitete
sich das Rokoko rasch aus und beschleunigte chas
herannahen der Krisis, die nach dem modischen
Verbrauch der historischen Stilarten kommen mußte
und deren Verlauf — von den neunziger Jahren
an bis heute — zu bekannt ist, um an dieser Stelle
einer Schilderung zu bedürfen. Man weiß aber
auch, daß in München nicht alle Brücken zur alten
Kunst abgebrochen wurden, ja daß sogar unter den
Arbeiten der ganz modernen da und dort Anklänge
an sie austauchen.
Wenn cs indessen noch eines Beweises bedurft
hätte, daß die eklektischen Neigungen nicht erloschen
!i
fj
\m\
! *
586. („München ,908".) Speisezimmer; von M. Ballin, nach Entwurf von Math. Feiler.
(Braune Wassereiche mit Einlagen — an den Möbeln — in schwarzer Wassereiche und grauem Ahorn; Neusilberbeschläge, Polster stahlblaues Saffianleder,
Wandbezug grauer Gobelinstoff; Lüster und Aiergefäße von E hren b ö ck & £> i er 11} ci Ier.
man von den orientalisierenden, starkfarbigen Tep-
pichen ganz zurückgekommen; mit Recht. Dem
Orientalen ist in der Wüste der Teppich der In-
begriff des Heims; auf dem Teppich bringt er die
Zeiten der Ruhe hin, den Teppich breitet er aus,
wenn er Allah anrnfen will; kein Tisch bedeckt de,i
Teppich, der mit seinen Farben die Augen aus sich
und etwa auf das Speisegeschirr zieht, das auf dem
Teppich steht. Anders bei uns. Da ist der Boden-
teppich überhaupt nur ein Mittel, um die Füße wärmer
zu erhalten, — oder ein untergeordneter Bodenschmuck,
der höchstens dazu dient, den Tisch und die um-
stehenden Stühle als Einheit zusanrmenzufaffen. Dieser
Bedeutung entsprechen die Bodenteppiche unserer Aus-
stellung, selbst wenn sie Naturvorbilder als Schmuck-
elemente verwenden; manche derselben sind den räum-
lichen Verhältnissen nach Form und Farbe besonders
angepaßt (vgl. Abb. 560 u. 586).
* *
Nachdem im vorhergehenden versucht worden
ist, im allgemeinen die Mittel zu kennzeichnen, mit
denen die heutige Raumkunst im Gegensatz zu der
vor rund 20 Jahren arbeitet, mögen nun in Kürze
die wichtigsten Raumgruppen und Einzelräume be-
trachtet werden.
Zur Zeit der 1(888 er Ausstellung hatte in
München die Renaissance bereits die Alleinherrschaft
eingebüßt. Die vielen durch den Tod König Lud-
wigs II., ihres bisherigen Auftraggebers, frei gewor-
denen Kräfte suchten nach Betätigung. So breitete
sich das Rokoko rasch aus und beschleunigte chas
herannahen der Krisis, die nach dem modischen
Verbrauch der historischen Stilarten kommen mußte
und deren Verlauf — von den neunziger Jahren
an bis heute — zu bekannt ist, um an dieser Stelle
einer Schilderung zu bedürfen. Man weiß aber
auch, daß in München nicht alle Brücken zur alten
Kunst abgebrochen wurden, ja daß sogar unter den
Arbeiten der ganz modernen da und dort Anklänge
an sie austauchen.
Wenn cs indessen noch eines Beweises bedurft
hätte, daß die eklektischen Neigungen nicht erloschen