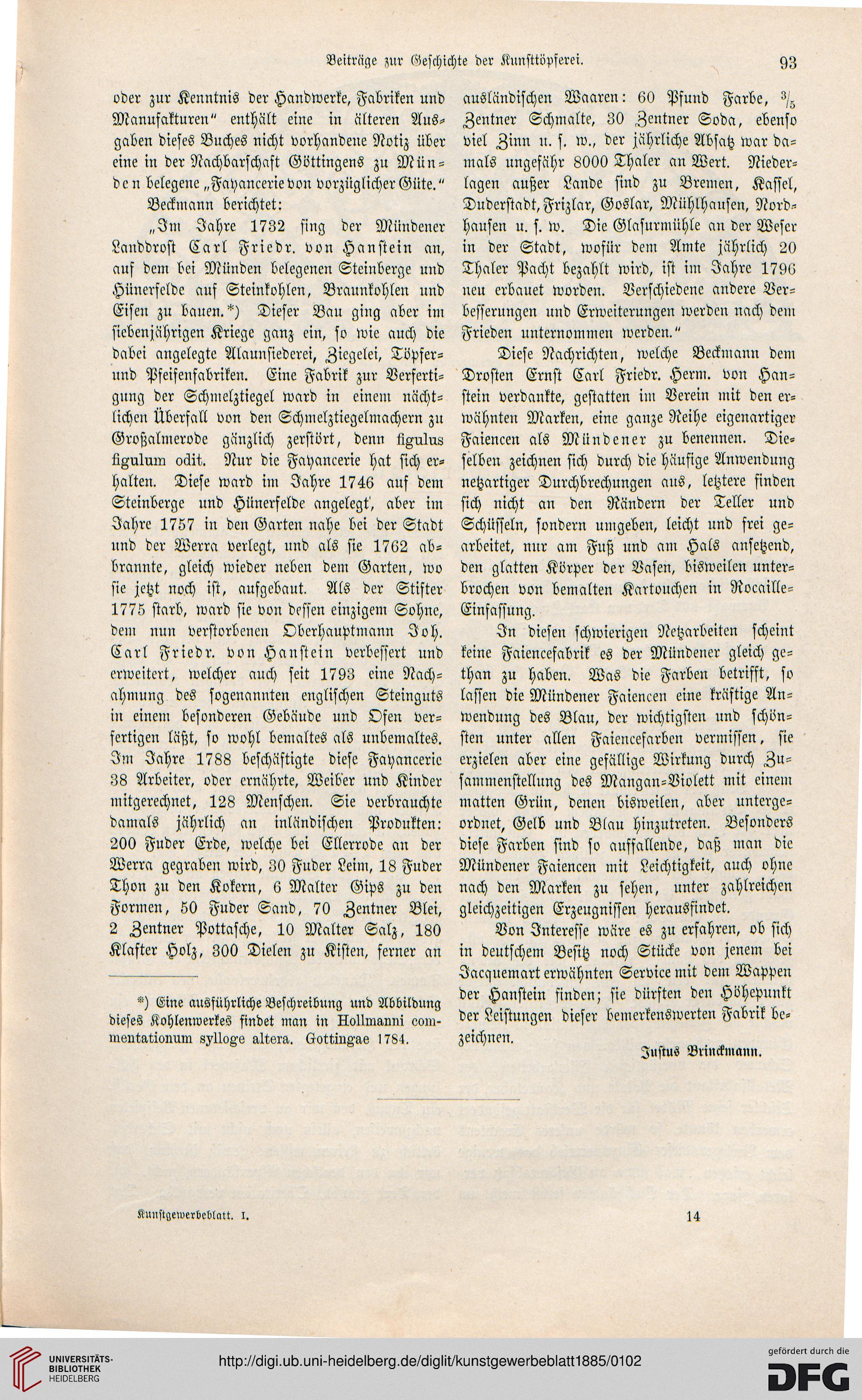Beitrttge zur Keschichte der Kunsttöpferei.
93
oder zur Kenntnis der Handwerke, Fabriken und
Manufakturen" enthält eine in älteren Aus-
gaben dieses Buches nicht vorhandene Notiz über
eine in der Nachbarschaft Göttingens zu Mün-
den belegene „Fayancerie von vorznglicher Güte."
Beckmann berichtet:
„Jm Jahre 1732 sing der Miindener
Landdrost Carl Friedr. von Hanstein an,
auf dem bei Münden belegenen Steinberge und
Hünerfelde auf Steinkohlen, Braunkohlen nnd
Eisen zu banen. *) Dieser Bau ging aber im
siebenjährigen Kriege ganz ein, so wie auch die
dabei angelegtc Alaunsiederei, Ziegelei, Töpfer-
und Pfeifenfabriken. Eine Fabrik zur Verferti-
gung der Schmelztiegel ward in einem nächt-
lichen Überfall von den Schmelztiegelmachern zn
Großalmerodc gänzlich zerstört, denn ÜAnlns
ÜAulrun oäit. Nur die Fayancerie hat sich er-
halten. Diese ward im Jahre 1746 auf dem
Steinberge und Hünerfelde angelegt', aber im
Jahre 1757 in den Garten nahe bei der Stadt
und der Werra verlegt, und als sie 1762 ab-
brannte, gleich wieder nebcn dem Garten, wo
sie jetzt noch ist, aufgebaut. Als der Stister
1775 starb, ward sie von dessen einzigem Sohne,
dem nun verstorbenen Obcrhauptmann Joh.
Carl Friedr. von Hanstein verbessert und
erweitert, welcher auch seit 1793 cine Nach-
ahmung des sogenannten englischen Steinguts
iu einem besonderen Gebäude und Ofen ver-
fertigen läßt, so wohl bemaltes als unbemaltes.
Jm Jahre 1788 beschäftigte diese Fayancerie
38 Arbeiter, oder ernährte, Weiber und Kinder
mitgerechnet, 128 Menschen. Sie verbrauchte
damals jährlich an inländischen Produkten:
200 Fuder Erde, welche bei Ellerrode an der
Werra gegraben wird, 30 Fuder Leim, 18 Fuder
Thon zu den Kokern, 6 Malter Gips zu den
Formen, 50 Fuder Sand, 70 Zentner Blei,
2 Zentner Pottasche, 10 Malter Salz, 180
Klafter Holz, 300 Dielen zu Kisten, ferner an
'*1 Eine ausführliche Beschreibung und Abbildung
dieses Kohlenwerkes findet man in Hollwamü eom-
msntationum szäloKs altsra. Kottiutzae 1784.
ausländischen Waaren: 60 Pfund Farbe, ^
Zentncr Schmalte, 30 Zentner Soda, ebenso
viel Zinn n. s. w., der jährliche Absatz war da-
mals ungefähr 8000 Thaler an Wert. Nieder-
lagen außer Lande sind zu Bremen, Kassel,
Duderstadt, Frizlar, Goslar, Mühlhanscn, Nord-
hausen u. s. w. Die Glasurniühle an der Weser
in der Stadt, wofiir dem Amte jährlich 20
Thaler Pacht bezahlt wird, ist im Jahre 1796
neu erbauet worden. Verschiedene andere Ver-
besserungen und Erweiterungen werden nach dem
Frieden unternommen werden."
Diese Nachrichten, welche Beckmann dcm
Drosten Ernst Carl Friedr. Herm. von Han-
stein verdankte, gestattcn im Verein mit den er-
wähnten Marken, eine ganze Reihe eigenartiger
Faiencen als Mündener zu benennen. Die-
selben zeichnen sich durch die häufige Anwendung
netzartiger Durchbrechungen aus, letztere sinden
sich nicht an den Rändern der Teller und
Schüsseln, sondern umgeben, leicht und frei ge-
arbeitet, uur am Fuß und am Hals ansetzend,
den glatten Körper der Vasen, bisweilen unter-
brochen von bemalten Kartonchen in Rocaille-
Einfassung.
Jn diesen schwierigen Netzarbeiten scheint
keine Faiencefabrik es der Mündener gleich ge-
than zu haben. Was die Farben betrifft, so
lassen die Mündener Faicncen eine kräftige An-
wendung des Blau, dcr wichtigsten und schön-
sten unter allen Faiencefarben vermissen, sie
erzielen aber eine gefällige Wirkung durch Zu-
sammenstellung des Mangan-Violett mit einem
matten Grün, denen bisweilen, aber unterge-
ordnet, Gelb und Blau hinzutreten. Besonders
diese Farben sind so ausfallende, daß man dic
Mündener Faiencen mit Leichtigkeit, auch ohne
nach den Marken zu sehen, unter zahlreichen
gleichzeitigen Erzeugnissen heraussindet.
Von Jnteresse wäre es zu erfahren, ob sich
in deutschem Besitz noch Stücke von jenem bei
Jacguemart erwähnten Service mit dem Wappen
der Hanstein finden; sie dürften dcn Höhepunkt
der Leistungen dieser bemerkenswerten Fabrik be-
zeichnen.
Iustus Bnnckmmin.
Kunstgewerbcblatt. I.
14
93
oder zur Kenntnis der Handwerke, Fabriken und
Manufakturen" enthält eine in älteren Aus-
gaben dieses Buches nicht vorhandene Notiz über
eine in der Nachbarschaft Göttingens zu Mün-
den belegene „Fayancerie von vorznglicher Güte."
Beckmann berichtet:
„Jm Jahre 1732 sing der Miindener
Landdrost Carl Friedr. von Hanstein an,
auf dem bei Münden belegenen Steinberge und
Hünerfelde auf Steinkohlen, Braunkohlen nnd
Eisen zu banen. *) Dieser Bau ging aber im
siebenjährigen Kriege ganz ein, so wie auch die
dabei angelegtc Alaunsiederei, Ziegelei, Töpfer-
und Pfeifenfabriken. Eine Fabrik zur Verferti-
gung der Schmelztiegel ward in einem nächt-
lichen Überfall von den Schmelztiegelmachern zn
Großalmerodc gänzlich zerstört, denn ÜAnlns
ÜAulrun oäit. Nur die Fayancerie hat sich er-
halten. Diese ward im Jahre 1746 auf dem
Steinberge und Hünerfelde angelegt', aber im
Jahre 1757 in den Garten nahe bei der Stadt
und der Werra verlegt, und als sie 1762 ab-
brannte, gleich wieder nebcn dem Garten, wo
sie jetzt noch ist, aufgebaut. Als der Stister
1775 starb, ward sie von dessen einzigem Sohne,
dem nun verstorbenen Obcrhauptmann Joh.
Carl Friedr. von Hanstein verbessert und
erweitert, welcher auch seit 1793 cine Nach-
ahmung des sogenannten englischen Steinguts
iu einem besonderen Gebäude und Ofen ver-
fertigen läßt, so wohl bemaltes als unbemaltes.
Jm Jahre 1788 beschäftigte diese Fayancerie
38 Arbeiter, oder ernährte, Weiber und Kinder
mitgerechnet, 128 Menschen. Sie verbrauchte
damals jährlich an inländischen Produkten:
200 Fuder Erde, welche bei Ellerrode an der
Werra gegraben wird, 30 Fuder Leim, 18 Fuder
Thon zu den Kokern, 6 Malter Gips zu den
Formen, 50 Fuder Sand, 70 Zentner Blei,
2 Zentner Pottasche, 10 Malter Salz, 180
Klafter Holz, 300 Dielen zu Kisten, ferner an
'*1 Eine ausführliche Beschreibung und Abbildung
dieses Kohlenwerkes findet man in Hollwamü eom-
msntationum szäloKs altsra. Kottiutzae 1784.
ausländischen Waaren: 60 Pfund Farbe, ^
Zentncr Schmalte, 30 Zentner Soda, ebenso
viel Zinn n. s. w., der jährliche Absatz war da-
mals ungefähr 8000 Thaler an Wert. Nieder-
lagen außer Lande sind zu Bremen, Kassel,
Duderstadt, Frizlar, Goslar, Mühlhanscn, Nord-
hausen u. s. w. Die Glasurniühle an der Weser
in der Stadt, wofiir dem Amte jährlich 20
Thaler Pacht bezahlt wird, ist im Jahre 1796
neu erbauet worden. Verschiedene andere Ver-
besserungen und Erweiterungen werden nach dem
Frieden unternommen werden."
Diese Nachrichten, welche Beckmann dcm
Drosten Ernst Carl Friedr. Herm. von Han-
stein verdankte, gestattcn im Verein mit den er-
wähnten Marken, eine ganze Reihe eigenartiger
Faiencen als Mündener zu benennen. Die-
selben zeichnen sich durch die häufige Anwendung
netzartiger Durchbrechungen aus, letztere sinden
sich nicht an den Rändern der Teller und
Schüsseln, sondern umgeben, leicht und frei ge-
arbeitet, uur am Fuß und am Hals ansetzend,
den glatten Körper der Vasen, bisweilen unter-
brochen von bemalten Kartonchen in Rocaille-
Einfassung.
Jn diesen schwierigen Netzarbeiten scheint
keine Faiencefabrik es der Mündener gleich ge-
than zu haben. Was die Farben betrifft, so
lassen die Mündener Faicncen eine kräftige An-
wendung des Blau, dcr wichtigsten und schön-
sten unter allen Faiencefarben vermissen, sie
erzielen aber eine gefällige Wirkung durch Zu-
sammenstellung des Mangan-Violett mit einem
matten Grün, denen bisweilen, aber unterge-
ordnet, Gelb und Blau hinzutreten. Besonders
diese Farben sind so ausfallende, daß man dic
Mündener Faiencen mit Leichtigkeit, auch ohne
nach den Marken zu sehen, unter zahlreichen
gleichzeitigen Erzeugnissen heraussindet.
Von Jnteresse wäre es zu erfahren, ob sich
in deutschem Besitz noch Stücke von jenem bei
Jacguemart erwähnten Service mit dem Wappen
der Hanstein finden; sie dürften dcn Höhepunkt
der Leistungen dieser bemerkenswerten Fabrik be-
zeichnen.
Iustus Bnnckmmin.
Kunstgewerbcblatt. I.
14