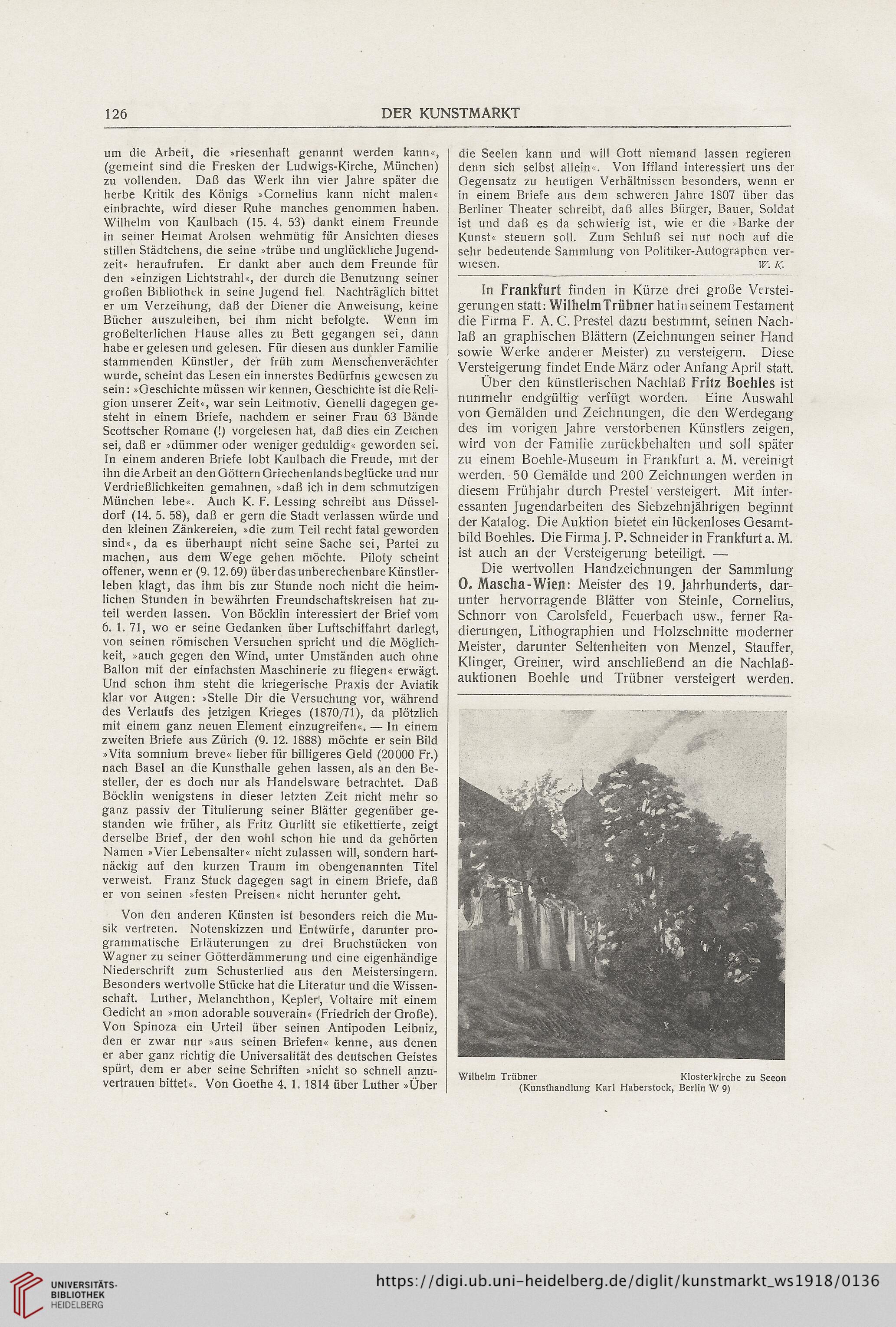126
DER KUNSTMARKT
um die Arbeit, die »riesenhaft genannt werden kann«,
(gemeint sind die Fresken der Ludwigs-Kirche, München)
zu vollenden. Daß das Werk ihn vier Jahre später die
herbe Kritik des Königs »Cornelius kann nicht malen«
einbrachte, wird dieser Ruhe manches genommen haben.
Wilhelm von Kaulbach (15. 4. 53) dankt einem Freunde
in seiner Heimat Arolsen wehmütig für Ansichten dieses
stillen Städtchens, die seine »trübe und unglückliche Jugend-
zeit« heraufrufen. Er dankt aber auch dem Freunde für
den »einzigen Lichtstrahl«, der durch die Benutzung seiner
großen Bibliothek in seine Jugend fiel Nachträglich bittet
er um Verzeihung, daß der Diener die Anweisung, keine
Bücher auszuleihen, bei ihm nicht befolgte. Wenn im
großelterlichen Hause alles zu Bett gegangen sei, dann
habe er gelesen und gelesen. Für diesen aus dunkler Familie
stammenden Künstler, der früh zum Menschenverächter
wurde, scheint das Lesen ein innerstes Bedürfnis gewesen zu
sein: »Geschichte müssen wir kennen, Geschichte ist die Reli-
gion unserer Zeit«, war sein Leitmotiv. Genelli dagegen ge-
steht in einem Briefe, nachdem er seiner Frau 63 Bände
Scottscher Romane (!) vorgelesen hat, daß dies ein Zeichen
sei, daß er »dümmer oder weniger geduldig« geworden sei.
In einem anderen Briefe lobt Kaulbach die Freude, mit der
ihn die Arbeit an den Göttern Griechenlands beglücke und nur
Verdrießlichkeiten gemahnen, »daß ich in dem schmutzigen
München lebe«. Auch K. F. Lessing schreibt aus Düssel-
dorf (14. 5. 58), daß er gern die Stadt verlassen würde und
den kleinen Zänkereien, »die zum Teil recht fatal geworden
sind«, da es überhaupt nicht seine Sache sei, Partei zu
machen, aus dem Wege gehen möchte. Piloty scheint
offener, wenn er (9.12.69) über das unberechenbare Künstler-
leben klagt, das ihm bis zur Stunde noch nicht die heim-
lichen Stunden in bewährten Freundschaftskreisen hat zu-
teil werden lassen. Von Böcklin interessiert der Brief vom
6. 1. 71, wo er seine Gedanken über Luftschiffahrt darlegt,
von seinen römischen Versuchen spricht und die Möglich-
keit, »auch gegen den Wind, unter Umständen auch ohne
Ballon mit der einfachsten Maschinerie zu fliegen« erwägt.
Und schon ihm steht die kriegerische Praxis der Aviatik
klar vor Augen: »Stelle Dir die Versuchung vor, während
des Verlaufs des jetzigen Krieges (1870/71), da plötzlich
mit einem ganz neuen Element einzugreifen«. — In einem
zweiten Briefe aus Zürich (9. 12. 1888) möchte er sein Bild
»Vita somnium breve« lieber für billigeres Geld (20000 Fr.)
nach Basel an die Kunsthalle gehen lassen, als an den Be-
steller, der es doch nur als Handelsware betrachtet. Daß
Böcklin wenigstens in dieser letzten Zeit nicht mehr so
ganz passiv der Titulierung seiner Blätter gegenüber ge-
standen wie früher, als Fritz Ourlitt sie etikettierte, zeigt
derselbe Brief, der den wohl schon hie und da gehörten
Namen »Vier Lebensalter« nicht zulassen will, sondern hart-
näckig auf den kurzen Traum im obengenannten Titel
verweist. Franz Stuck dagegen sagt in einem Briefe, daß
er von seinen »festen Preisen« nicht herunter geht.
Von den anderen Künsten ist besonders reich die Mu-
sik vertreten. Notenskizzen und Entwürfe, darunter pro-
grammatische Erläuterungen zu drei Bruchstücken von
Wagner zu seiner Götterdämmerung und eine eigenhändige
Niederschrift zum Schusterlied aus den Meistersingern.
Besonders wertvolle Stücke hat die Literatur und die Wissen-
schaft. Luther, Melanchthon, Kepler', Voltaire mit einem
Gedicht an »mon adorable souverain« (Friedrich der Große).
Von Spinoza ein Urteil über seinen Antipoden Leibniz,
den er zwar nur »aus seinen Briefen« kenne, aus denen
er aber ganz richtig die Universalität des deutschen Geistes
spürt, dem er aber seine Schriften »nicht so schnell anzu-
vertrauen bittet«. Von Goethe 4. 1. 1814 über Luther »Über
die Seelen kann und will Gott niemand lassen regieren
denn sich selbst allein«. Von Iffland interessiert uns der
Gegensatz zu heutigen Verhältnissen besonders, wenn er
in einem Briefe aus dem schweren Jahre 1807 über das
Berliner Theater schreibt, daß alles Bürger, Bauer, Soldat
ist und daß es da schwierig ist, wie er die Barke der
Kunst« steuern soll. Zum Schluß sei nur noch auf die
sehr bedeutende Sammlung von Politiker-Autographen ver-
wiesen. W. K.
In Frankfurt finden in Kürze drei große Verstei-
gerungen statt: WilhelmTrübner hatinseinemTestament
die Firma F. A. C. Prestel dazu bestimmt, seinen Nach-
laß an graphischen Blättern (Zeichnungen seiner Hand
sowie Werke anderer Meister) zu versteigern. Diese
Versteigerung findet Ende März oder Anfang April statt.
Über den künstlerischen Nachlaß Fritz Boehles ist
nunmehr endgültig verfügt worden. Eine Auswahl
von Gemälden und Zeichnungen, die den Werdegang
des im vorigen Jahre verstorbenen Künstlers zeigen,
wird von der Familie zurückbehalten und soll später
zu einem Boehle-Museum in Frankfurt a. M. vereinigt
werden. 50 Gemälde und 200 Zeichnungen werden in
diesem Frühjahr durch Prestel versteigert. Mit inter-
essanten Jugendarbeiten des Siebzehnjährigen beginnt
der Katalog. Die Auktion bietet ein lückenloses Gesamt-
bild Boehles. Die Firma J. P. Schneider in Frankfurt a. M.
ist auch an der Versteigerung beteiligt. —
Die wertvollen Handzeichnungen der Sammlung
0. Mascha-Wien: Meister des 19. Jahrhunderts, dar-
unter hervorragende Blätter von Steinle, Cornelius,
Schnorr von Carolsfeld, Feuerbach usw., ferner Ra-
dierungen, Lithographien und Holzschnitte moderner
Meister, darunter Seltenheiten von Menzel, Stauffer,
Klinger, Greiner, wird anschließend an die Nachlaß-
auktionen Boehle und Trübner versteigert werden.
Wilhelm Trübner Klosterkirche zu Seeon
(Kunsthandlung Karl Haberstock, Berlin W 9)
DER KUNSTMARKT
um die Arbeit, die »riesenhaft genannt werden kann«,
(gemeint sind die Fresken der Ludwigs-Kirche, München)
zu vollenden. Daß das Werk ihn vier Jahre später die
herbe Kritik des Königs »Cornelius kann nicht malen«
einbrachte, wird dieser Ruhe manches genommen haben.
Wilhelm von Kaulbach (15. 4. 53) dankt einem Freunde
in seiner Heimat Arolsen wehmütig für Ansichten dieses
stillen Städtchens, die seine »trübe und unglückliche Jugend-
zeit« heraufrufen. Er dankt aber auch dem Freunde für
den »einzigen Lichtstrahl«, der durch die Benutzung seiner
großen Bibliothek in seine Jugend fiel Nachträglich bittet
er um Verzeihung, daß der Diener die Anweisung, keine
Bücher auszuleihen, bei ihm nicht befolgte. Wenn im
großelterlichen Hause alles zu Bett gegangen sei, dann
habe er gelesen und gelesen. Für diesen aus dunkler Familie
stammenden Künstler, der früh zum Menschenverächter
wurde, scheint das Lesen ein innerstes Bedürfnis gewesen zu
sein: »Geschichte müssen wir kennen, Geschichte ist die Reli-
gion unserer Zeit«, war sein Leitmotiv. Genelli dagegen ge-
steht in einem Briefe, nachdem er seiner Frau 63 Bände
Scottscher Romane (!) vorgelesen hat, daß dies ein Zeichen
sei, daß er »dümmer oder weniger geduldig« geworden sei.
In einem anderen Briefe lobt Kaulbach die Freude, mit der
ihn die Arbeit an den Göttern Griechenlands beglücke und nur
Verdrießlichkeiten gemahnen, »daß ich in dem schmutzigen
München lebe«. Auch K. F. Lessing schreibt aus Düssel-
dorf (14. 5. 58), daß er gern die Stadt verlassen würde und
den kleinen Zänkereien, »die zum Teil recht fatal geworden
sind«, da es überhaupt nicht seine Sache sei, Partei zu
machen, aus dem Wege gehen möchte. Piloty scheint
offener, wenn er (9.12.69) über das unberechenbare Künstler-
leben klagt, das ihm bis zur Stunde noch nicht die heim-
lichen Stunden in bewährten Freundschaftskreisen hat zu-
teil werden lassen. Von Böcklin interessiert der Brief vom
6. 1. 71, wo er seine Gedanken über Luftschiffahrt darlegt,
von seinen römischen Versuchen spricht und die Möglich-
keit, »auch gegen den Wind, unter Umständen auch ohne
Ballon mit der einfachsten Maschinerie zu fliegen« erwägt.
Und schon ihm steht die kriegerische Praxis der Aviatik
klar vor Augen: »Stelle Dir die Versuchung vor, während
des Verlaufs des jetzigen Krieges (1870/71), da plötzlich
mit einem ganz neuen Element einzugreifen«. — In einem
zweiten Briefe aus Zürich (9. 12. 1888) möchte er sein Bild
»Vita somnium breve« lieber für billigeres Geld (20000 Fr.)
nach Basel an die Kunsthalle gehen lassen, als an den Be-
steller, der es doch nur als Handelsware betrachtet. Daß
Böcklin wenigstens in dieser letzten Zeit nicht mehr so
ganz passiv der Titulierung seiner Blätter gegenüber ge-
standen wie früher, als Fritz Ourlitt sie etikettierte, zeigt
derselbe Brief, der den wohl schon hie und da gehörten
Namen »Vier Lebensalter« nicht zulassen will, sondern hart-
näckig auf den kurzen Traum im obengenannten Titel
verweist. Franz Stuck dagegen sagt in einem Briefe, daß
er von seinen »festen Preisen« nicht herunter geht.
Von den anderen Künsten ist besonders reich die Mu-
sik vertreten. Notenskizzen und Entwürfe, darunter pro-
grammatische Erläuterungen zu drei Bruchstücken von
Wagner zu seiner Götterdämmerung und eine eigenhändige
Niederschrift zum Schusterlied aus den Meistersingern.
Besonders wertvolle Stücke hat die Literatur und die Wissen-
schaft. Luther, Melanchthon, Kepler', Voltaire mit einem
Gedicht an »mon adorable souverain« (Friedrich der Große).
Von Spinoza ein Urteil über seinen Antipoden Leibniz,
den er zwar nur »aus seinen Briefen« kenne, aus denen
er aber ganz richtig die Universalität des deutschen Geistes
spürt, dem er aber seine Schriften »nicht so schnell anzu-
vertrauen bittet«. Von Goethe 4. 1. 1814 über Luther »Über
die Seelen kann und will Gott niemand lassen regieren
denn sich selbst allein«. Von Iffland interessiert uns der
Gegensatz zu heutigen Verhältnissen besonders, wenn er
in einem Briefe aus dem schweren Jahre 1807 über das
Berliner Theater schreibt, daß alles Bürger, Bauer, Soldat
ist und daß es da schwierig ist, wie er die Barke der
Kunst« steuern soll. Zum Schluß sei nur noch auf die
sehr bedeutende Sammlung von Politiker-Autographen ver-
wiesen. W. K.
In Frankfurt finden in Kürze drei große Verstei-
gerungen statt: WilhelmTrübner hatinseinemTestament
die Firma F. A. C. Prestel dazu bestimmt, seinen Nach-
laß an graphischen Blättern (Zeichnungen seiner Hand
sowie Werke anderer Meister) zu versteigern. Diese
Versteigerung findet Ende März oder Anfang April statt.
Über den künstlerischen Nachlaß Fritz Boehles ist
nunmehr endgültig verfügt worden. Eine Auswahl
von Gemälden und Zeichnungen, die den Werdegang
des im vorigen Jahre verstorbenen Künstlers zeigen,
wird von der Familie zurückbehalten und soll später
zu einem Boehle-Museum in Frankfurt a. M. vereinigt
werden. 50 Gemälde und 200 Zeichnungen werden in
diesem Frühjahr durch Prestel versteigert. Mit inter-
essanten Jugendarbeiten des Siebzehnjährigen beginnt
der Katalog. Die Auktion bietet ein lückenloses Gesamt-
bild Boehles. Die Firma J. P. Schneider in Frankfurt a. M.
ist auch an der Versteigerung beteiligt. —
Die wertvollen Handzeichnungen der Sammlung
0. Mascha-Wien: Meister des 19. Jahrhunderts, dar-
unter hervorragende Blätter von Steinle, Cornelius,
Schnorr von Carolsfeld, Feuerbach usw., ferner Ra-
dierungen, Lithographien und Holzschnitte moderner
Meister, darunter Seltenheiten von Menzel, Stauffer,
Klinger, Greiner, wird anschließend an die Nachlaß-
auktionen Boehle und Trübner versteigert werden.
Wilhelm Trübner Klosterkirche zu Seeon
(Kunsthandlung Karl Haberstock, Berlin W 9)