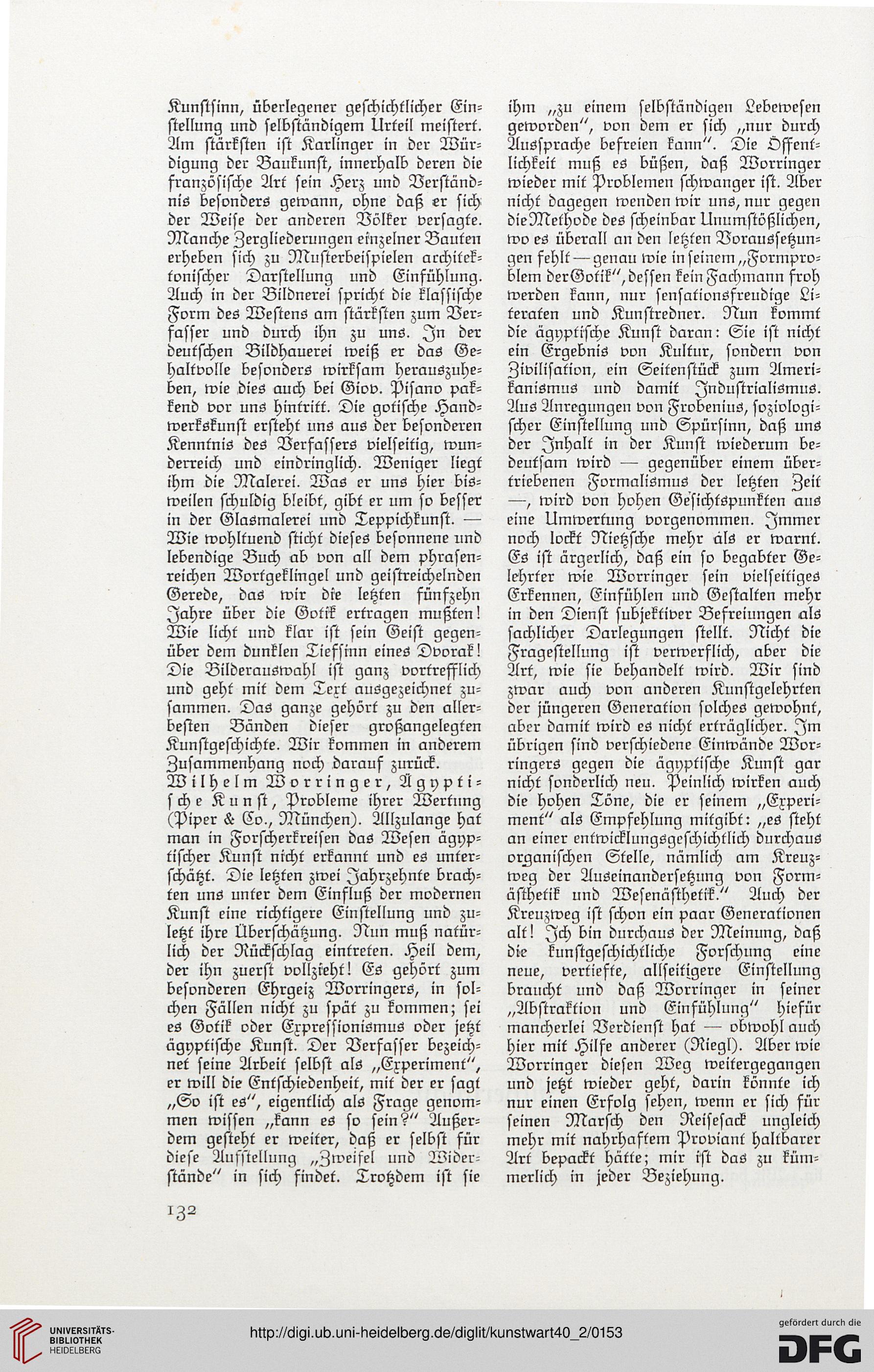Kunstsirm, überlegener geschichtllcher Ein-
stellung und selbständigem Urkeil meistert.
Am stärksten ist Karlinger >n dcr Wür-
digung der Baukunst, mnerhalb deren die
sranzösische Art sein Herz und Verständ-
nis besonders gewann, ohne daß er sich
der Weise der anderen Völker versagte.
Manche Zergliederungen emzelner Bauten
erheben sich zu Mllsterbeispielen acchitek-
tonischer Darstellung und Einsühlung.
Allch in der Bildnerei spricht die klassische
Form des Westens am stärksten zum Ver-
sasser und durch ihn zu uns. Jn der
deutschen Bildhauerei weiß er das Ge-
haltvolle besonders wirksam herauszuhe-
ben, wie dies anch bei Giov. Pisano pak-
kend vor uns hintritt. Die gotische Hand-
werkskunst ersteht uns aus der besonderen
Kenntnis des Dersassers vielseitig, wun-
derreich und eindri'nglich. Weniger liegt
ihm die Malerei. Was er uns hier bis-
weilen schuldig bleibt, gibt er um so besser
in der Glasmalerei und Teppichkunst. —
Wie wohltuend sticht dieseS besonnene nnd
lebendige Buch ab von all dem phrasen-
reichen Wortgekli'ngel und geistreichelnden
Gerede, das wir die letzten sünszehn
Jahre über die Gotik ertragen mußten!
Wie licht und klar ist sein Geist gegen-
über dem dunklen Tiefsinn eines Dvorak!
Die Bilderauswahl ist ganz vortresslich
und geht mit dem Tert ausgezeichnet zu-
sammen. Das ganze gehört zu den aller-
besten Bänden dieser großangelegten
Kunstgeschichte. Wir kommen in anderem
Zusammenhang noch daraus zurück.
Wilhelm Worringer, Ägypti-
sche Kunst, Probleme ihrer Wertnng
(Piper §: Co., München). Allzulange hat
man i'n Forscherkreisen das Wesen ägyp-
tischer Kunst nicht erkannt und es unter-
schätzt. Die letzten zwei Jahrzehnte brach-
ten nns unter dem Einsiuß der modernen
Kunst eine richtigere Einstellung und zu-
letzt ihre Überschätzung. Nun muß natür-
lich der Rückschlag eintreten. Heil dem,
der ihn zuerst vollzreht! Es gehört zum
besonderen Ehrgeiz Worringers, in sol-
chen Fallen nicht zu spät zu kommen; sei
es Gotik oder ExpressionismuS oder jetzt
ägyptische Kunst. Der Verfasser bezeich-
net seine Arbeit selbst als „Experiment",
er will die Entschiedenheit, mit der er sagt
„So ist eö", eigentlich als Frage genom-
men wissen „kann es so sein?" Außer-
dem gesteht er weiter, daß er selbst sür
diese Aufstellung „Zweifel unö Wider-
stände" in sich sindet. Trotzdem ist sie
ihm „zu einem selbständigen Lebewesen
geworden", von dem er sich „nur durch
Aussprache besreien kann". Die Dfsent-
lichkeit muß es büßen, daß Worringer
wieder mit Problemen schwanger ist. Aber
m'cht dagegen wenden wir uns, nur gegen
dieMethode des scheinbar Unumstößlichen,
wo es überall an den letzten Voraussetznn-
gen fehlt — genan wie inseinem„Formpro-
blem derGotik",dessen kein Fachmann froh
werden kann, nur sensationsfreudige Li-
teraten nnd Kunstredner. Nun kommt
die ägyptische Kunst daran: Sie ist nicht
ein Ergebnis von Kultur, sondern von
Zivilisation, ein Seitenstück zum Ameri-
kanismus und damit Jndustrialismus.
Aus Anregnngen von Frobenins, sozivlogi-
scher Einstellung und Spürsinn, daß uns
der Jnhalt in der Kunst wiederum be-
dentsam wird — gegenüber einem über-
triebenen Formalismus der letzten Zeit
—, wird von hohen Gesichtspunkten aus
eine Umwertung vorgenommen. Jmmer
noch lockt Nietzsche mehr äls er warnt.
Es ist ärgerlich, daß ein so begabter Ge-
lehrter wie Worringer sein vielseitiges
Erkennen, Einfühlen nnd Gestalten mehr
in den Dienst subjektiver Besreinngen als
sachlicher Darlegungen stellt. Nicht die
Fragestellung ist verwerslich, aber die
Art, wie sie behandelt wird. Wir sind
zwar auch von anderen Kunstgelehrten
der jüngeren Generation solches gewohnt,
aber damit wird eS nicht erträglicher. Jm
übrigen sind verschiedene Einwände Wor-
ringers gegen die ägyptische Kunst gar
nicht sonderlich neu. Peinlich wirken auch
die hohen Töne, die er seinem „Experi-
ment" als Empsehlung mikgibt: „es steht
an einer entwicklungsgeschichtlich durchaus
organischen Stelle, nämlich am Kreuz-
weg der Auseinandersetzung von Form-
ästhetik und Wesenästhetik." Auch der
Kreuzweg ist schon ein paar Generationen
alt! Jch bin durchanS der Meinung, daß
die kunstgeschichtliche Forschung cine
neue, vertiefte, allseitigere Einstellung
brancht und daß Worringer in seiner
„Abstraktion und Einfühlung" hiefür
mancherlei Verdienst hat — obwohl auch
hier mit Hilfe anderer (Riegl). Aber wic
Worringer diesen Weg weitergegangcn
und jetzt wieder geht, darin könnte ich
nur einen Erfolg sehen, wenn er sich sür
seinen Marsch den Reisesack ungleich
mehr mit nahrhaftem Proviant haltbarer
Art bepackt hätte; mir ist das zu küm-
merlich in jeder Beziehung.
stellung und selbständigem Urkeil meistert.
Am stärksten ist Karlinger >n dcr Wür-
digung der Baukunst, mnerhalb deren die
sranzösische Art sein Herz und Verständ-
nis besonders gewann, ohne daß er sich
der Weise der anderen Völker versagte.
Manche Zergliederungen emzelner Bauten
erheben sich zu Mllsterbeispielen acchitek-
tonischer Darstellung und Einsühlung.
Allch in der Bildnerei spricht die klassische
Form des Westens am stärksten zum Ver-
sasser und durch ihn zu uns. Jn der
deutschen Bildhauerei weiß er das Ge-
haltvolle besonders wirksam herauszuhe-
ben, wie dies anch bei Giov. Pisano pak-
kend vor uns hintritt. Die gotische Hand-
werkskunst ersteht uns aus der besonderen
Kenntnis des Dersassers vielseitig, wun-
derreich und eindri'nglich. Weniger liegt
ihm die Malerei. Was er uns hier bis-
weilen schuldig bleibt, gibt er um so besser
in der Glasmalerei und Teppichkunst. —
Wie wohltuend sticht dieseS besonnene nnd
lebendige Buch ab von all dem phrasen-
reichen Wortgekli'ngel und geistreichelnden
Gerede, das wir die letzten sünszehn
Jahre über die Gotik ertragen mußten!
Wie licht und klar ist sein Geist gegen-
über dem dunklen Tiefsinn eines Dvorak!
Die Bilderauswahl ist ganz vortresslich
und geht mit dem Tert ausgezeichnet zu-
sammen. Das ganze gehört zu den aller-
besten Bänden dieser großangelegten
Kunstgeschichte. Wir kommen in anderem
Zusammenhang noch daraus zurück.
Wilhelm Worringer, Ägypti-
sche Kunst, Probleme ihrer Wertnng
(Piper §: Co., München). Allzulange hat
man i'n Forscherkreisen das Wesen ägyp-
tischer Kunst nicht erkannt und es unter-
schätzt. Die letzten zwei Jahrzehnte brach-
ten nns unter dem Einsiuß der modernen
Kunst eine richtigere Einstellung und zu-
letzt ihre Überschätzung. Nun muß natür-
lich der Rückschlag eintreten. Heil dem,
der ihn zuerst vollzreht! Es gehört zum
besonderen Ehrgeiz Worringers, in sol-
chen Fallen nicht zu spät zu kommen; sei
es Gotik oder ExpressionismuS oder jetzt
ägyptische Kunst. Der Verfasser bezeich-
net seine Arbeit selbst als „Experiment",
er will die Entschiedenheit, mit der er sagt
„So ist eö", eigentlich als Frage genom-
men wissen „kann es so sein?" Außer-
dem gesteht er weiter, daß er selbst sür
diese Aufstellung „Zweifel unö Wider-
stände" in sich sindet. Trotzdem ist sie
ihm „zu einem selbständigen Lebewesen
geworden", von dem er sich „nur durch
Aussprache besreien kann". Die Dfsent-
lichkeit muß es büßen, daß Worringer
wieder mit Problemen schwanger ist. Aber
m'cht dagegen wenden wir uns, nur gegen
dieMethode des scheinbar Unumstößlichen,
wo es überall an den letzten Voraussetznn-
gen fehlt — genan wie inseinem„Formpro-
blem derGotik",dessen kein Fachmann froh
werden kann, nur sensationsfreudige Li-
teraten nnd Kunstredner. Nun kommt
die ägyptische Kunst daran: Sie ist nicht
ein Ergebnis von Kultur, sondern von
Zivilisation, ein Seitenstück zum Ameri-
kanismus und damit Jndustrialismus.
Aus Anregnngen von Frobenins, sozivlogi-
scher Einstellung und Spürsinn, daß uns
der Jnhalt in der Kunst wiederum be-
dentsam wird — gegenüber einem über-
triebenen Formalismus der letzten Zeit
—, wird von hohen Gesichtspunkten aus
eine Umwertung vorgenommen. Jmmer
noch lockt Nietzsche mehr äls er warnt.
Es ist ärgerlich, daß ein so begabter Ge-
lehrter wie Worringer sein vielseitiges
Erkennen, Einfühlen nnd Gestalten mehr
in den Dienst subjektiver Besreinngen als
sachlicher Darlegungen stellt. Nicht die
Fragestellung ist verwerslich, aber die
Art, wie sie behandelt wird. Wir sind
zwar auch von anderen Kunstgelehrten
der jüngeren Generation solches gewohnt,
aber damit wird eS nicht erträglicher. Jm
übrigen sind verschiedene Einwände Wor-
ringers gegen die ägyptische Kunst gar
nicht sonderlich neu. Peinlich wirken auch
die hohen Töne, die er seinem „Experi-
ment" als Empsehlung mikgibt: „es steht
an einer entwicklungsgeschichtlich durchaus
organischen Stelle, nämlich am Kreuz-
weg der Auseinandersetzung von Form-
ästhetik und Wesenästhetik." Auch der
Kreuzweg ist schon ein paar Generationen
alt! Jch bin durchanS der Meinung, daß
die kunstgeschichtliche Forschung cine
neue, vertiefte, allseitigere Einstellung
brancht und daß Worringer in seiner
„Abstraktion und Einfühlung" hiefür
mancherlei Verdienst hat — obwohl auch
hier mit Hilfe anderer (Riegl). Aber wic
Worringer diesen Weg weitergegangcn
und jetzt wieder geht, darin könnte ich
nur einen Erfolg sehen, wenn er sich sür
seinen Marsch den Reisesack ungleich
mehr mit nahrhaftem Proviant haltbarer
Art bepackt hätte; mir ist das zu küm-
merlich in jeder Beziehung.