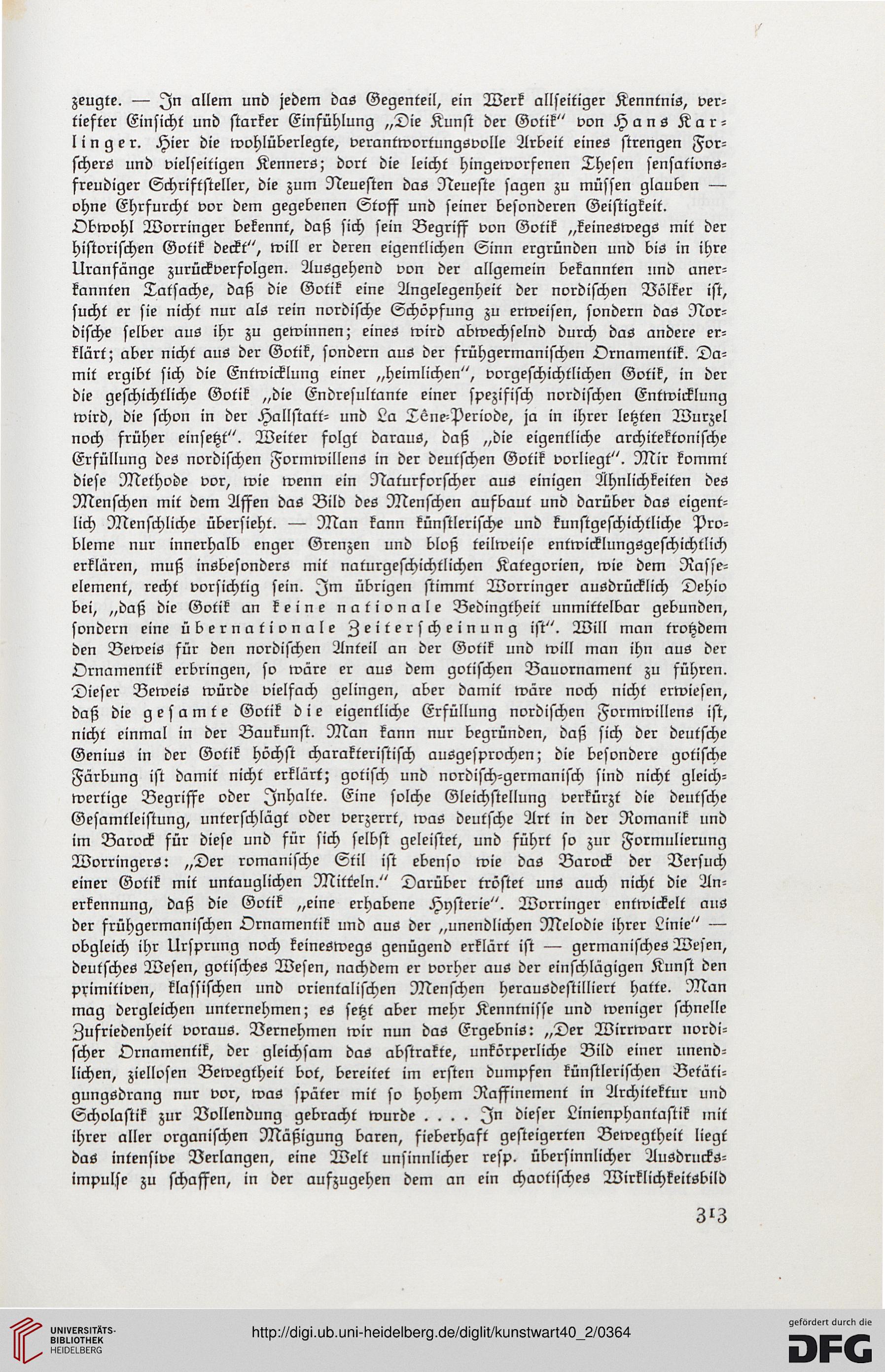zeugte. — Jri allem und jedem das Gegenteil, ein Werk allseitiger Kenntnis, ver-
tiefter Einsicht und starker Einfühlung „Die Kunst der Gotik" von Hans Kar-
linger. Hier die wohlüberlegte, verantwortungsvolle Arbeit eines strengen For-
schers und vielseitigen Kenners; dort die leicht hingeworfenen Thesen sensativns-
freudiger Schriftsteller, die zum Neuesten das Neueste sagen zu müssen glauben —
ohne Ehrfurcht vor dem gegebenen Stosf und seiner besonderen Geistigkeit.
Obwohl Worringer bekennt, daß sich sein Begrisf von Gotik „keineswegs mit der
historischen Gotik deckt", will er deren eigentlichen Sinn ergründen und bis in ihre
Uranfänge zurückverfolgen. AuSgehend von der allgemein bekannten nnd aner-
kannten Tatsache, daß die Gotik eine Angelegenheit der nordischen Dölker ist,
sncht er sie nicht nur als rein nordische Schöpfung zu erweisen, sondern das Nor-
dische selber aus ihr zu gewinnen; eines wird abwechselnd durch das andere er-
klärt; aber nicht aus der Gotik, sondern aus der frühgermanischen Ornamentik. Da-
mit ergibt sich die Entwicklung einer „heimlichen", vorgeschichtlichen Gotik, in der
die geschichtliche Gotik „die Endresultante einer spezifisch nordischen Entwicklung
wird, die schon in der Hallstatt- und La Tene-Periode, ja in ihrer letzten Wurzel
noch früher einsetzt". Weiter folgt daraus, daß „die eigentliche architektonische
Erfüllung des nordischen Formwillens in der deutschen Gotik vorliegt". Mir kommt
diese Methode vor, wie wenn ein Naturforscher aus einigen Ähnlichkeiten des
Menschen mit dem Asfen das Bild des Menschen aufbaut und darüber das eigent-
lich Menschliche übersieht. — Man kann künstlerische und kunstgeschichtliche Pro-
bleme nur innerhalb enger Grenzen und bloß teilweise entwicklungsgeschichtlich
erklären, muß insbesonders mit naturgeschichtlichen Kategorien, wie dem Rasse-
element, recht vorsichtig sein. Jm übrigen stimmt Worringer ausdrücklich Dehio
bei, „daß die Gotik an keine nationale Bedingtheit unmittelbar gebunden,
sondern eine übernationale Zeiterscheinurig ist". Will man trotzdem
den Beweis für den nordischen Anteil an der Gotik und will man ihn auS der
Ornamentik erbringen, so wäre er aus dem gotischen Bauornament zu führen.
Dieser Beweis würde vielfach gelingen, aber damit wäre noch nicht erwiesen,
daß die gesamte Gotik d i e eigentliche Erfüllung nordischen Formwillens ist,
nicht einmal in der Baukunst. Man kann nur begründen, daß sich der deutsche
Genius in der Gotik höchst charakteristisch auögesprochen; die besondere gotische
Färbung ist damit nicht erklärt; gotisch und nordisch-germanisch sind nicht gleich-
wertige Begriffe oder Inhalte. Eine solche Gleichstellung verkürzt die deutsche
Gesamtleistung, unterschlägt oder verzerrt, was deutsche Art in der Romanik und
im Barock für diese und für sich selbst geleistet, und führt so zur Formnlierung
Worringers: „Der romanische Stil ist ebenso wie das Barock der Bersuch
einer Gotik mit untauglichen Mitteln." Darüber tröstet uns auch nicht die An-
erkennung, daß die Gotik „eine erhabene Hysterie". Worringer entwickelt ans
der frühgermanischen Ornamentik und aus der „unendlichen Melodie ihrer Linie" —
obgleich ihr Ursprung noch keineswegs genügend erklärt ist — germanisches Wesen,
deutsches Wesen, gotisches Wesen, nachdem er vorher aus der einschlägigen Kunst den
pximitiven, klassischen und orientalischen Menschen herausdestilliert hatte. Man
mag dergleichen unternehmen; es setzt aber mehr Kenntnisse und weniger schnelle
Zufriedenheit voraus. Vernehmen wir nun das Ergebnis: „Der Wirrwarr nordi-
scher Ornamentik, der gleichsam das abstrakte, unkörperliche Bild einer unend-
lichen, ziellosen Bewegtheit bot, bereitet im ersten dumpfen künstlerischen Bctäti-
gungsdrang nur vor, was später mit so hohem Raffinement in Architektur und
Scholastik zur Vollendung gebracht wurde .... Jn dieser Linienphantastik init
ihrer aller organischen Mäßigung baren, fieberhaft gesteigerten Bewegtheit liegt
das intensive Derlangen, eine Welt unsinnlicher resp. übersinnlicher Ausdrncks-
impulse zu schaffen, in der aufzugehen dem an ein chaotisches Wirklichkeitsbild
tiefter Einsicht und starker Einfühlung „Die Kunst der Gotik" von Hans Kar-
linger. Hier die wohlüberlegte, verantwortungsvolle Arbeit eines strengen For-
schers und vielseitigen Kenners; dort die leicht hingeworfenen Thesen sensativns-
freudiger Schriftsteller, die zum Neuesten das Neueste sagen zu müssen glauben —
ohne Ehrfurcht vor dem gegebenen Stosf und seiner besonderen Geistigkeit.
Obwohl Worringer bekennt, daß sich sein Begrisf von Gotik „keineswegs mit der
historischen Gotik deckt", will er deren eigentlichen Sinn ergründen und bis in ihre
Uranfänge zurückverfolgen. AuSgehend von der allgemein bekannten nnd aner-
kannten Tatsache, daß die Gotik eine Angelegenheit der nordischen Dölker ist,
sncht er sie nicht nur als rein nordische Schöpfung zu erweisen, sondern das Nor-
dische selber aus ihr zu gewinnen; eines wird abwechselnd durch das andere er-
klärt; aber nicht aus der Gotik, sondern aus der frühgermanischen Ornamentik. Da-
mit ergibt sich die Entwicklung einer „heimlichen", vorgeschichtlichen Gotik, in der
die geschichtliche Gotik „die Endresultante einer spezifisch nordischen Entwicklung
wird, die schon in der Hallstatt- und La Tene-Periode, ja in ihrer letzten Wurzel
noch früher einsetzt". Weiter folgt daraus, daß „die eigentliche architektonische
Erfüllung des nordischen Formwillens in der deutschen Gotik vorliegt". Mir kommt
diese Methode vor, wie wenn ein Naturforscher aus einigen Ähnlichkeiten des
Menschen mit dem Asfen das Bild des Menschen aufbaut und darüber das eigent-
lich Menschliche übersieht. — Man kann künstlerische und kunstgeschichtliche Pro-
bleme nur innerhalb enger Grenzen und bloß teilweise entwicklungsgeschichtlich
erklären, muß insbesonders mit naturgeschichtlichen Kategorien, wie dem Rasse-
element, recht vorsichtig sein. Jm übrigen stimmt Worringer ausdrücklich Dehio
bei, „daß die Gotik an keine nationale Bedingtheit unmittelbar gebunden,
sondern eine übernationale Zeiterscheinurig ist". Will man trotzdem
den Beweis für den nordischen Anteil an der Gotik und will man ihn auS der
Ornamentik erbringen, so wäre er aus dem gotischen Bauornament zu führen.
Dieser Beweis würde vielfach gelingen, aber damit wäre noch nicht erwiesen,
daß die gesamte Gotik d i e eigentliche Erfüllung nordischen Formwillens ist,
nicht einmal in der Baukunst. Man kann nur begründen, daß sich der deutsche
Genius in der Gotik höchst charakteristisch auögesprochen; die besondere gotische
Färbung ist damit nicht erklärt; gotisch und nordisch-germanisch sind nicht gleich-
wertige Begriffe oder Inhalte. Eine solche Gleichstellung verkürzt die deutsche
Gesamtleistung, unterschlägt oder verzerrt, was deutsche Art in der Romanik und
im Barock für diese und für sich selbst geleistet, und führt so zur Formnlierung
Worringers: „Der romanische Stil ist ebenso wie das Barock der Bersuch
einer Gotik mit untauglichen Mitteln." Darüber tröstet uns auch nicht die An-
erkennung, daß die Gotik „eine erhabene Hysterie". Worringer entwickelt ans
der frühgermanischen Ornamentik und aus der „unendlichen Melodie ihrer Linie" —
obgleich ihr Ursprung noch keineswegs genügend erklärt ist — germanisches Wesen,
deutsches Wesen, gotisches Wesen, nachdem er vorher aus der einschlägigen Kunst den
pximitiven, klassischen und orientalischen Menschen herausdestilliert hatte. Man
mag dergleichen unternehmen; es setzt aber mehr Kenntnisse und weniger schnelle
Zufriedenheit voraus. Vernehmen wir nun das Ergebnis: „Der Wirrwarr nordi-
scher Ornamentik, der gleichsam das abstrakte, unkörperliche Bild einer unend-
lichen, ziellosen Bewegtheit bot, bereitet im ersten dumpfen künstlerischen Bctäti-
gungsdrang nur vor, was später mit so hohem Raffinement in Architektur und
Scholastik zur Vollendung gebracht wurde .... Jn dieser Linienphantastik init
ihrer aller organischen Mäßigung baren, fieberhaft gesteigerten Bewegtheit liegt
das intensive Derlangen, eine Welt unsinnlicher resp. übersinnlicher Ausdrncks-
impulse zu schaffen, in der aufzugehen dem an ein chaotisches Wirklichkeitsbild