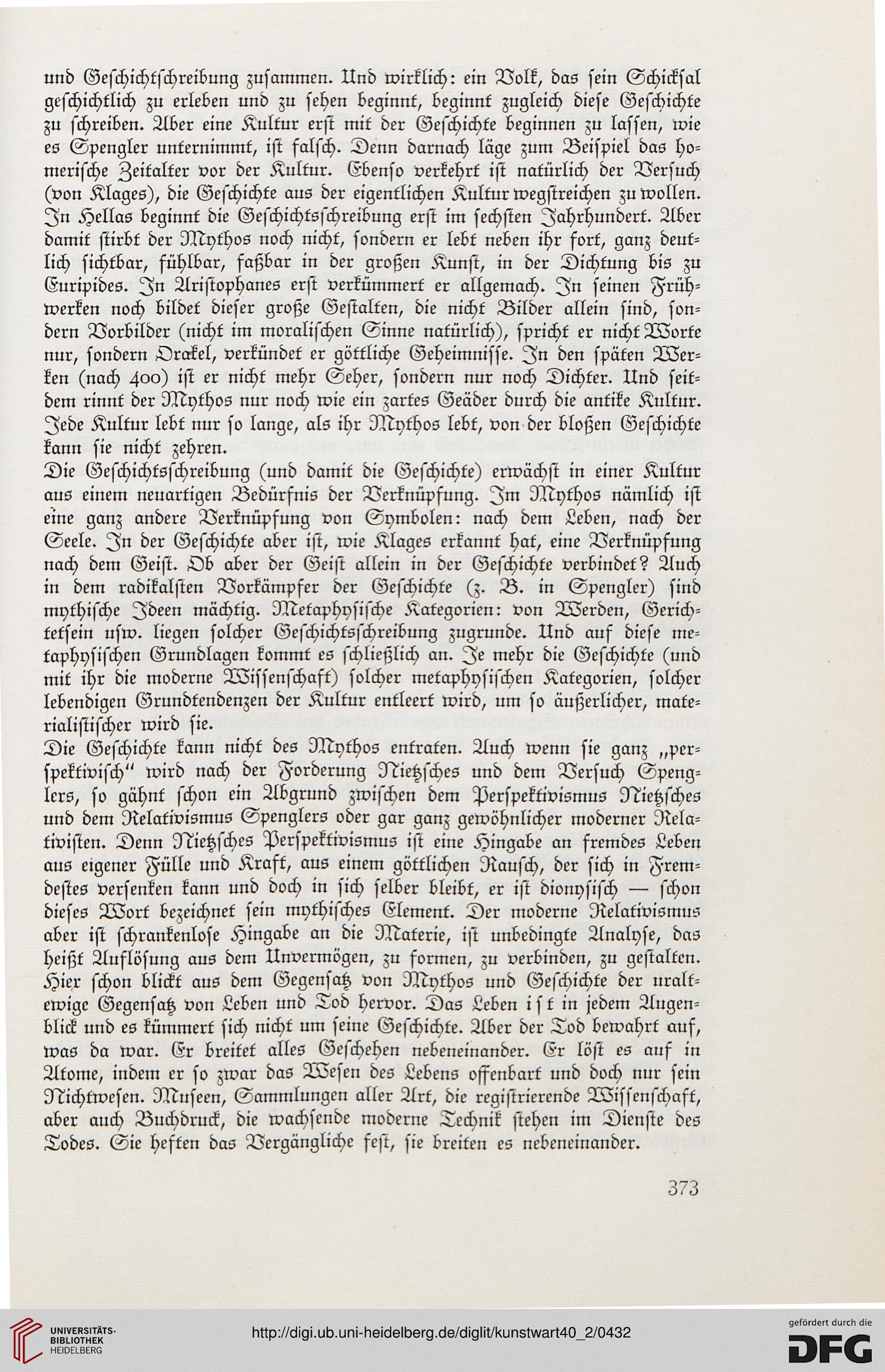und Geschlchtschreibung zusammen. Und wirklrch: ein Volk, das sein Schicksal
geschichtlich zu erleben und zu sehen beginnk, beginnk zugleich diese Geschichke
zu schreiben. Aber eine KulLur erst miL der GeschichLe beginnen zu lassen, wie
es Spengler unLernimmL, isl falsch. Denn darnach läge zum Beispiel das ho-
merische ZeiLalLer vor der Kultur. Ebenso verkehrL ist naLürlich der Versuch
(von Klages), die GeschichLe aus der eigenLlichen Kultur wegsireichen zu wollen.
In Hellas beginnL die GeschichLsschreibung ersi im sechsien IahrhunderL. Aber
damit siirbt der MchLhos noch nicht, sondern er lebt neben ihr fort, ganz deut-
lich sichkbar, fühlbar, faßbar in der großen Kunsi, in der DichLung bis zu
Euripides. Jn Arisiophanes erst verkümmerL er allgemach. Jn seinen Früh-
werken noch bildet dieser große Gestalten, die nicht Bilder allein sind, son-
dern Vorbilder (nichL im moralischen Sinne naLürlich), spricht er nicht Worke
nur, sondern Orakel, verkündeL er göLLliche Geheimnisse. Fn den späten Wer-
ken (nach 400) ist er nicht mehr Seher, sondern nnr noch DichLer. Und seiL-
dem rinnt der MchLhos nur noch wie ein zarkes Geäder durch die anLike KulLur.
Fede Kultur lebt nur so lange, als ihr MyLhos lebt, von der bloßen GeschichLe
kann sie nicht zehren.
Die GeschichLsschreibung (und damik die GeschichLe) erwächsi in einer Kultur
aus einem neuariigen Bedürfnis der Berknüpfung. Jm Mythos nämlich ist
eine ganz andere Verknüpfung von Symbolen: nach dem Leben, nach der
Seele. Jn der GefchichLe aber isi, wie Klages erkannt haL, eine Berknüpfung
nach dem Geisi. Ob aber der Geisi allein in der Geschichte verbindeL? Auch
in dem radikalsten Vorkämpfer der GeschichLe (z. B. in Spengler) sind
mythische Fdeen mächtig. Metaphysische Kategorien: von Werden, Gerich-
LeLsein usw. liegen solcher GeschichLsschreibung zugrunde. llnd auf diese me-
Laphysischen Grundlagen kommt es schließlich an. Fe mehr die Geschichke (und
mit ihr die moderne Wissenschaft) solcher metaphysischen Kategorien, solcher
lebendigen Grundtendenzen der Kulkur entleert wird, um so äußerlicher, mate-
rialisiischer wird sie.
Die GeschichLe kann nicht des Mythos entraken. Auch wenn sie ganz „per-
spektivisch" wird nach der Forderung Nietzsches urck dem Versuch Speng-
lers, so gähnt schon ein Abgrund zwischen dem Perspektivismus NieHsches
und dem RelaLivismus Spenglers oder gar ganz gewöhnlicher moderner Rela-
tivisien. Denn NleHsches Perspektivismus isi eine Hingabe an fremdes Leben
aus eigener Fülle und Krafk, aus einem göLLlichen Rausch, der sich in Frem-
desies versenken kann und doch in sich selber bleibt, er isi dionysisch — schon
dieses WorL bezeichnet sein mykhisches ElemenL. Der moderne RelaLivismus
aber isi schrankenlose Hingabe an die Makerie, isi unbedingke Analyse, das
heißL Auflösung aus dem Unvermögen, zu formen, zu verbinden, zu gesialien.
Hier schon blickt aus dem Gegensatz von Mykhos und GeschichLe der nralk-
ewigc Gegensatz von Leben und Tod hervor. Das Leben isk in jedem Angen-
blick und es kümmert sich nicht um seine Geschichke. Aber der Tod bewahrt auf,
was da war. Er brcitek alles Geschehen nebeneinander. Er lösi es cmf in
Atome, indem er so zwar das Wesen des Lebens osfenbart und doch nur sein
Ntchkwesen. Museen, Sammlungen aller ArL, die regisirierende WissenschafL,
aber auch Buchdruck, die wachsende moderne Technik siehen im Dienste des
Todes. Sie hesien das Vergängliche fesi, sie breiten es nebeneinander.
37Z
geschichtlich zu erleben und zu sehen beginnk, beginnk zugleich diese Geschichke
zu schreiben. Aber eine KulLur erst miL der GeschichLe beginnen zu lassen, wie
es Spengler unLernimmL, isl falsch. Denn darnach läge zum Beispiel das ho-
merische ZeiLalLer vor der Kultur. Ebenso verkehrL ist naLürlich der Versuch
(von Klages), die GeschichLe aus der eigenLlichen Kultur wegsireichen zu wollen.
In Hellas beginnL die GeschichLsschreibung ersi im sechsien IahrhunderL. Aber
damit siirbt der MchLhos noch nicht, sondern er lebt neben ihr fort, ganz deut-
lich sichkbar, fühlbar, faßbar in der großen Kunsi, in der DichLung bis zu
Euripides. Jn Arisiophanes erst verkümmerL er allgemach. Jn seinen Früh-
werken noch bildet dieser große Gestalten, die nicht Bilder allein sind, son-
dern Vorbilder (nichL im moralischen Sinne naLürlich), spricht er nicht Worke
nur, sondern Orakel, verkündeL er göLLliche Geheimnisse. Fn den späten Wer-
ken (nach 400) ist er nicht mehr Seher, sondern nnr noch DichLer. Und seiL-
dem rinnt der MchLhos nur noch wie ein zarkes Geäder durch die anLike KulLur.
Fede Kultur lebt nur so lange, als ihr MyLhos lebt, von der bloßen GeschichLe
kann sie nicht zehren.
Die GeschichLsschreibung (und damik die GeschichLe) erwächsi in einer Kultur
aus einem neuariigen Bedürfnis der Berknüpfung. Jm Mythos nämlich ist
eine ganz andere Verknüpfung von Symbolen: nach dem Leben, nach der
Seele. Jn der GefchichLe aber isi, wie Klages erkannt haL, eine Berknüpfung
nach dem Geisi. Ob aber der Geisi allein in der Geschichte verbindeL? Auch
in dem radikalsten Vorkämpfer der GeschichLe (z. B. in Spengler) sind
mythische Fdeen mächtig. Metaphysische Kategorien: von Werden, Gerich-
LeLsein usw. liegen solcher GeschichLsschreibung zugrunde. llnd auf diese me-
Laphysischen Grundlagen kommt es schließlich an. Fe mehr die Geschichke (und
mit ihr die moderne Wissenschaft) solcher metaphysischen Kategorien, solcher
lebendigen Grundtendenzen der Kulkur entleert wird, um so äußerlicher, mate-
rialisiischer wird sie.
Die GeschichLe kann nicht des Mythos entraken. Auch wenn sie ganz „per-
spektivisch" wird nach der Forderung Nietzsches urck dem Versuch Speng-
lers, so gähnt schon ein Abgrund zwischen dem Perspektivismus NieHsches
und dem RelaLivismus Spenglers oder gar ganz gewöhnlicher moderner Rela-
tivisien. Denn NleHsches Perspektivismus isi eine Hingabe an fremdes Leben
aus eigener Fülle und Krafk, aus einem göLLlichen Rausch, der sich in Frem-
desies versenken kann und doch in sich selber bleibt, er isi dionysisch — schon
dieses WorL bezeichnet sein mykhisches ElemenL. Der moderne RelaLivismus
aber isi schrankenlose Hingabe an die Makerie, isi unbedingke Analyse, das
heißL Auflösung aus dem Unvermögen, zu formen, zu verbinden, zu gesialien.
Hier schon blickt aus dem Gegensatz von Mykhos und GeschichLe der nralk-
ewigc Gegensatz von Leben und Tod hervor. Das Leben isk in jedem Angen-
blick und es kümmert sich nicht um seine Geschichke. Aber der Tod bewahrt auf,
was da war. Er brcitek alles Geschehen nebeneinander. Er lösi es cmf in
Atome, indem er so zwar das Wesen des Lebens osfenbart und doch nur sein
Ntchkwesen. Museen, Sammlungen aller ArL, die regisirierende WissenschafL,
aber auch Buchdruck, die wachsende moderne Technik siehen im Dienste des
Todes. Sie hesien das Vergängliche fesi, sie breiten es nebeneinander.
37Z