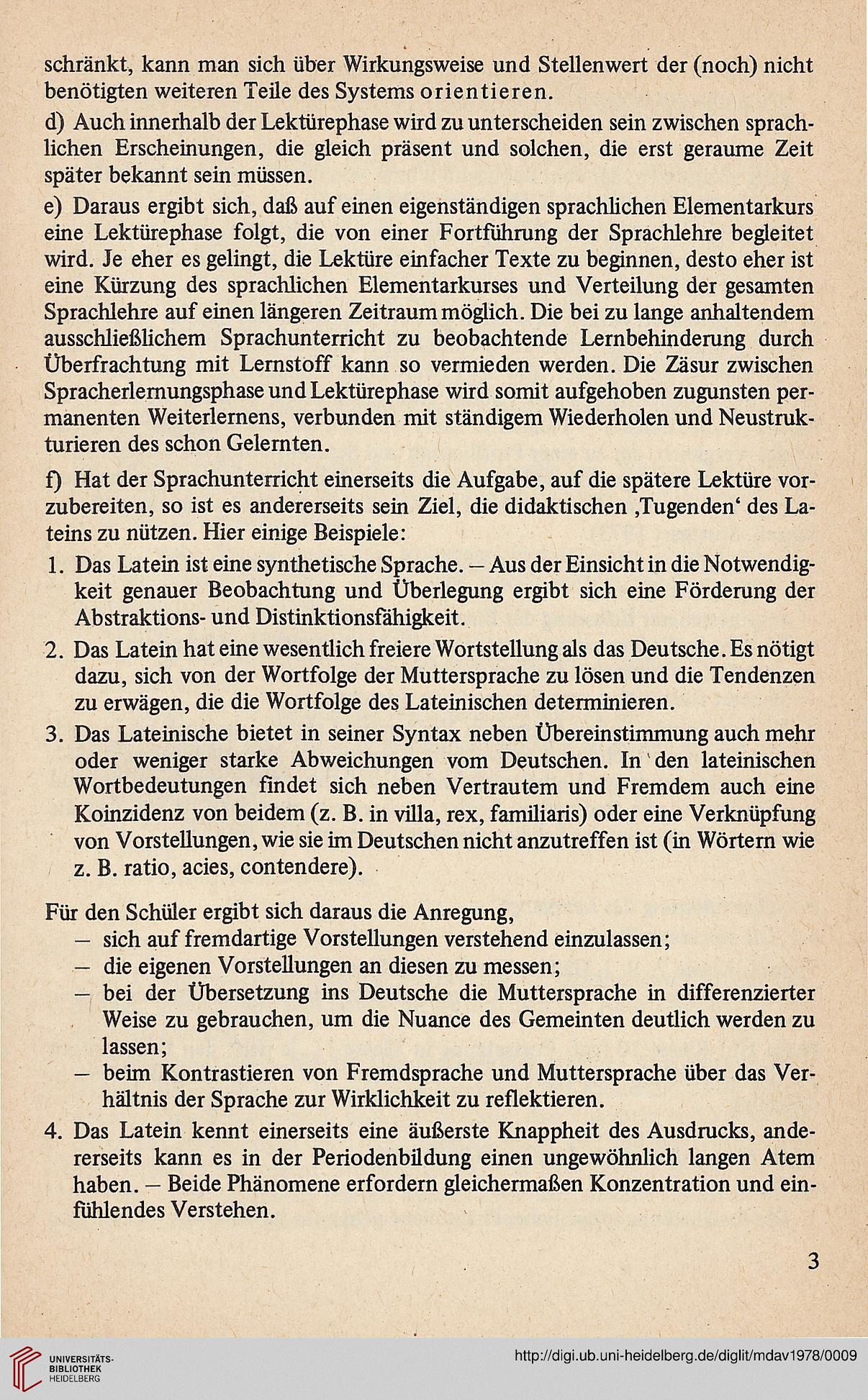schränkt, kann man sich über Wirkungsweise und Stellenwert der (noch) nicht
benötigten weiteren Teile des Systems orientieren.
d) Auch innerhalb der Lektürephase wird zu unterscheiden sein zwischen sprach-
lichen Erscheinungen, die gleich präsent und solchen, die erst geraume Zeit
später bekannt sein müssen.
e) Daraus ergibt sich, daß auf einen eigenständigen sprachlichen Elementarkurs
eine Lektürephase folgt, die von einer Fortführung der Sprachlehre begleitet
wird. Je eher es gelingt, die Lektüre einfacher Texte zu beginnen, desto eher ist
eine Kürzung des sprachlichen Elementarkurses und Verteilung der gesamten
Sprachlehre auf einen längeren Zeitraum möglich. Die bei zu lange anhaltendem
ausschließlichem Sprachunterricht zu beobachtende Lernbehinderung durch
Überfrachtung mit Lernstoff kann so vermieden werden. Die Zäsur zwischen
Spracherlemungsphase und Lektürephase wird somit aufgehoben zugunsten per-
manenten Weiterlernens, verbunden mit ständigem Wiederholen und Neustruk-
turieren des schon Gelernten.
f) Hat der Sprachunterricht einerseits die Aufgabe, auf die spätere Lektüre vor-
zubereiten, so ist es andererseits sein Ziel, die didaktischen ,Tugenden1 des La-
teins zu nützen. Hier einige Beispiele:
1. Das Latein ist eine synthetische Sprache. — Aus der Einsicht in die Notwendig-
keit genauer Beobachtung und Überlegung ergibt sich eine Förderung der
Abstraktions- und Distinktionsfähigkeit.
2. Das Latein hat eine wesentlich freiere Wortstellung als das Deutsche. Es nötigt
dazu, sich von der Wortfolge der Muttersprache zu lösen und die Tendenzen
zu erwägen, die die Wortfolge des Lateinischen determinieren.
3. Das Lateinische bietet in seiner Syntax neben Übereinstimmung auch mehr
oder weniger starke Abweichungen vom Deutschen. In den lateinischen
Wortbedeutungen findet sich neben Vertrautem und Fremdem auch eine
Koinzidenz von beidem (z. B. in villa, rex, familiaris) oder eine Verknüpfung
von Vorstellungen, wie sie im Deutschen nicht anzutreffen ist (in Wörtern wie
z. B. ratio, acies, contendere).
Für den Schüler ergibt sich daraus die Anregung,
— sich auf fremdartige Vorstellungen verstehend einzulassen;
— die eigenen Vorstellungen an diesen zu messen;
— bei der Übersetzung ins Deutsche die Muttersprache in differenzierter
Weise zu gebrauchen, um die Nuance des Gemeinten deutlich werden zu
lassen;
— beim Kontrastieren von Fremdsprache und Muttersprache über das Ver-
hältnis der Sprache zur Wirklichkeit zu reflektieren.
4. Das Latein kennt einerseits eine äußerste Knappheit des Ausdrucks, ande-
rerseits kann es in der Periodenbildung einen ungewöhnlich langen Atem
haben. - Beide Phänomene erfordern gleichermaßen Konzentration und ein-
fühlendes Verstehen.
3
benötigten weiteren Teile des Systems orientieren.
d) Auch innerhalb der Lektürephase wird zu unterscheiden sein zwischen sprach-
lichen Erscheinungen, die gleich präsent und solchen, die erst geraume Zeit
später bekannt sein müssen.
e) Daraus ergibt sich, daß auf einen eigenständigen sprachlichen Elementarkurs
eine Lektürephase folgt, die von einer Fortführung der Sprachlehre begleitet
wird. Je eher es gelingt, die Lektüre einfacher Texte zu beginnen, desto eher ist
eine Kürzung des sprachlichen Elementarkurses und Verteilung der gesamten
Sprachlehre auf einen längeren Zeitraum möglich. Die bei zu lange anhaltendem
ausschließlichem Sprachunterricht zu beobachtende Lernbehinderung durch
Überfrachtung mit Lernstoff kann so vermieden werden. Die Zäsur zwischen
Spracherlemungsphase und Lektürephase wird somit aufgehoben zugunsten per-
manenten Weiterlernens, verbunden mit ständigem Wiederholen und Neustruk-
turieren des schon Gelernten.
f) Hat der Sprachunterricht einerseits die Aufgabe, auf die spätere Lektüre vor-
zubereiten, so ist es andererseits sein Ziel, die didaktischen ,Tugenden1 des La-
teins zu nützen. Hier einige Beispiele:
1. Das Latein ist eine synthetische Sprache. — Aus der Einsicht in die Notwendig-
keit genauer Beobachtung und Überlegung ergibt sich eine Förderung der
Abstraktions- und Distinktionsfähigkeit.
2. Das Latein hat eine wesentlich freiere Wortstellung als das Deutsche. Es nötigt
dazu, sich von der Wortfolge der Muttersprache zu lösen und die Tendenzen
zu erwägen, die die Wortfolge des Lateinischen determinieren.
3. Das Lateinische bietet in seiner Syntax neben Übereinstimmung auch mehr
oder weniger starke Abweichungen vom Deutschen. In den lateinischen
Wortbedeutungen findet sich neben Vertrautem und Fremdem auch eine
Koinzidenz von beidem (z. B. in villa, rex, familiaris) oder eine Verknüpfung
von Vorstellungen, wie sie im Deutschen nicht anzutreffen ist (in Wörtern wie
z. B. ratio, acies, contendere).
Für den Schüler ergibt sich daraus die Anregung,
— sich auf fremdartige Vorstellungen verstehend einzulassen;
— die eigenen Vorstellungen an diesen zu messen;
— bei der Übersetzung ins Deutsche die Muttersprache in differenzierter
Weise zu gebrauchen, um die Nuance des Gemeinten deutlich werden zu
lassen;
— beim Kontrastieren von Fremdsprache und Muttersprache über das Ver-
hältnis der Sprache zur Wirklichkeit zu reflektieren.
4. Das Latein kennt einerseits eine äußerste Knappheit des Ausdrucks, ande-
rerseits kann es in der Periodenbildung einen ungewöhnlich langen Atem
haben. - Beide Phänomene erfordern gleichermaßen Konzentration und ein-
fühlendes Verstehen.
3