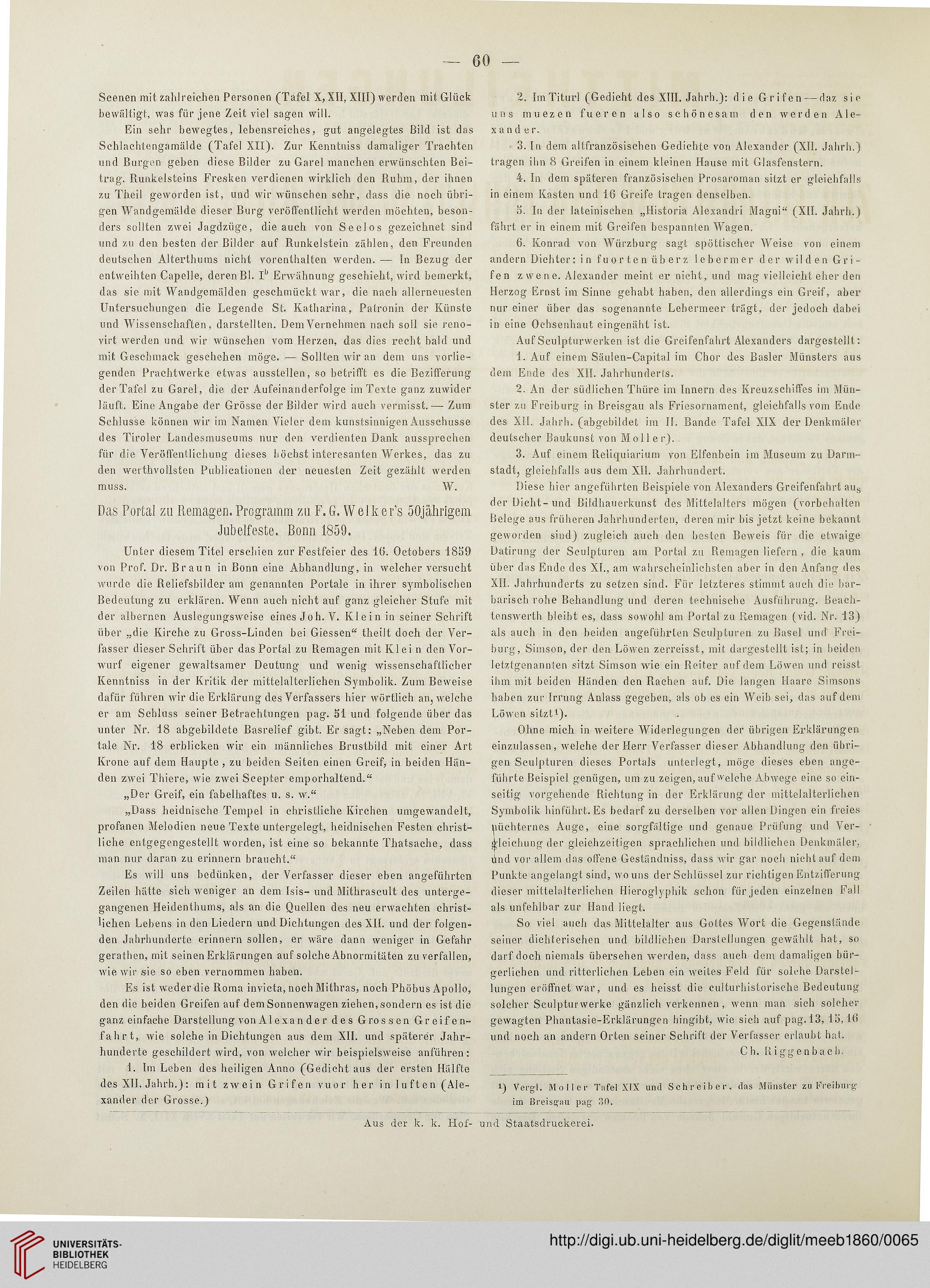60
Seenen mit zahlreichen Personen (Tafel X, XII, XIII) werden mit Glück
bewältigt, was für jene Zeit viel sagen will.
Ein sehr bewegtes, lebensreiches, gut angelegtes Bild ist das
Schlachtengamälde (Tafel XII). Zur Kenntniss damaliger Trachten
und Burgen geben diese Bilder zu Garei manchen erwünschten Bei-
trag. Runkelsteins Fresken verdienen wirklich den Ruhm, der ihnen
zu Theil geworden ist, und wir wünschen sehr, dass die noch übri-
gen Wandgemälde dieser Burg veröff'entlieht werden möchten, beson-
ders sollten zwei Jagdzüge, die auch von Seelos gezeichnet sind
und zu den besten der Bilder auf Runkelstein zählen, den Freunden
deutschen Alterthums nicht vorenthalten werden. — In Bezug der
entweihten Capelle, deren Bl. I1’ Erwähnung geschieht, wird bemerkt,
das sie mit Wandgemälden geschmückt war, die nach allerneuesten
Untersuchungen die Legende St. Katharina, Patronin der Künste
und Wissenschaften, darstellten. Dem Vernehmen nach soll sie reno-
virt werden und wir wünschen vom Herzen, das dies recht bald und
mit Geschmack geschehen möge. — Sollten wir an dem uns vorlie-
genden Prachtwerke etwas ausstellen, so betrifft es die Bezifferung
der Tafel zu Garei, die der Aufeinanderfolge im Texte ganz zuwider
läuft. Eine Angabe der Grösse der Bilder wird auch vermisst.— Zum
Schlüsse können wir im Namen Vieler dem kunstsinnigen Ausschüsse
des Tiroler Landesmuseums nur den verdienten Dank aussprechen
für die Veröffentlichung dieses höchst interesanten Werkes, das zu
den werthvollsten Publicationen der neuesten Zeit gezählt werden
muss. W.
Das Portal zu Remagen. Programm zu F. G. Welker’s 50jahrigem
Jubelfeste. Bonn 1859.
Unter diesem Titel erschien zur Festfeier des 16. Octobers 1859
von Prof. Dr. Braun in Bonn eine Abhandlung, in welcher versucht
wurde die Reliefsbilder am genannten Portale in ihrer symbolischen
Bedeutung zu erklären. Wenn auch nicht auf ganz gleicher Stufe mit
der albernen Auslegungsweise eines Joh.V. K1 e i n in seiner Schrift
über „die Kirche zu Gross-Linden bei Giessen“ theilt doch der Ver-
fasser dieser Schrift über das Portal zu Remagen mit Klei n den Vor-
wurf eigener gewaltsamer Deutung und wenig wissenschaftlicher
Kenntniss in der Kritik der mittelalterlichen Symbolik. Zum Beweise
dafür führen wir die Erklärung des Verfassers hier wörtlich an, welche
er am Schluss seiner Betrachtungen pag. 51 und folgende über das
unter Nr. 18 abgebildete Basrelief gibt. Er sagt: „Neben dem Por-
tale Nr. 18 erblicken wir ein männliches Brustbild mit einer Art
Krone auf dem Haupte, zu beiden Seiten einen Greif, in beiden Hän-
den zwei Thiere, wie zwei Scepter emporhaltend.“
„Der Greif, ein fabelhaftes u. s. w.“
„Dass heidnische Tempel in christliche Kirchen umgewandelt,
profanen Melodien neue Texte untergelegt, heidnischen Festen christ-
liche entgegengestellt worden, ist eine so bekannte Thatsache, dass
man nur daran zu erinnern braucht.“
Es will uns bediinken, der Verfasser dieser eben angeführten
Zeilen hätte sicli weniger an dem Isis- und Mithrascult des unterge-
gangenen Heidenthums, als an die Quellen des neu erwachten christ-
lichen Lebens in den Liedern und Dichtungen des XII. und der folgen-
den Jahrhunderte erinnern sollen, er wäre dann weniger in Gefahr
gerathen, mit seinen Erklärungen auf solche Abnormitäten zu verfallen,
wie wir sie so eben vernommen haben.
Es ist weder die Roma invicta, noch Mithras, noch Phöbus Apollo,
den die beiden Greifen auf dem Sonnenwagen ziehen, sondern es ist die
ganz einfache Darstellung von Al ex a n der des Grossen Greifen-
fahrt, wie solche in Dichtungen aus dem XII. und späterer Jahr-
hunderte geschildert wird, von welcher wir beispielsweise anführen:
1. Im Leben des heiligen Anno (Gedicht aus der ersten Hälfte
des XII. Jahrh.): mit zwein Grifen vuor her in 1 u ft en (Ale-
xander der Grosse.)
2. Im Titurl (Gedicht des XIII. Jahrh.): die Grifen-—daz sic
uns muezen fueren also schönesam den werden Ale-
xand er.
3. ln dem altfranzösischen Gedichte von Alexander (XII. Jahrh.)
tragen ihn 8 Greifen in einem kleinen Hause mit Glasfenstern.
4. ln dem späteren französischen Prosaroman sitzt er gleichfalls
in einem Kasten und 16 Greife tragen denselben.
5. In der lateinischen „Historia Alexandri Magni“ (XII. Jahrh.)
fährt er in einem mit Greifen bespannten Wagen.
6. Konrad von Würzburg sagt spöttischer Weise von einem
andern Dichter:in fuorten überz lebermer der wilden Gri-
fen z we n e. Alexander meint er nicht, und mag vielleicht eher den
Herzog Ernst im Sinne gehabt haben, den allerdings ein Greif, aber
nur einer über das sogenannte Lebermeer trägt, der jedoch dabei
in eine Ochsenhaut eingenäht ist.
AufSculpturwerken ist die Greifenfahrt Alexanders dargestellt:
1. Auf einem Säulen-Capital im Chor des Basler Münsters aus
dem Ende des XII. Jahrhunderts.
2. An der südlichen Thüre im Innern des Kreuzschiffes im Mün-
ster zu Freiburg in Breisgau als Friesornament, gleichfalls vom Ende
des XiI. Jahrh. (abgebildet im II. Bande Tafel XIX der Denkmäler
deutscher Baukunst von Möller).
3. Auf einem Reliquiarium von Elfenbein im Museum zu Darm-
stadt, gleichfalls aus dem XII. Jahrhundert.
Diese hier angeführten Beispiele von Alexanders Greifenfahrt aus
der Dicht-und Bildhauerkunst des Mittelalters mögen (Vorbehalten
Belege aus früheren Jahrhunderten, deren mir bis jetzt keine bekannt
geworden sind) zugleich auch den besten Beweis für die etwaige
Datirung der Sculpturen am Portal zu Remagen liefern , die kaum
über das Ende des XL, am wahrscheinlichsten aber in den Anfang des
XII. Jahrhunderts zu setzen sind. Für letzteres stimmt auch die bar-
barisch rohe Behandlung und deren technische Ausführung, ßeach-
tenswerth bleibt es, dass sowohl am Portal zu Remagen (vid. Nr. 13)
als auch in den beiden angeführten Sculpturen zu Basel und Frei-
burg, Simson, der den Löwen zerreisst, mit dargestellt ist; in beiden
letztgenannten sitzt Simson wie ein Reiter auf dem Löwen und reisst
ihm mit beiden Händen den Rachen auf. Die langen Haare Simsons
haben zur Irrung Anlass gegeben, als ob es ein Weib sei, das auf dem
Löwen sitzt1).
Ohne mich in weitere Widerlegungen der übrigen Erklärungen
einzulassen, welche der Herr Verfasser dieser Abhandlung den übri-
gen Sculpturen dieses Portals unterlegt, möge dieses eben ange-
führte Beispiel genügen, um zu zeigen, auf welche Abwege eine so ein-
seitig vorgehende Richtung in der Erklärung der mittelalterlichen
Symbolik hinführt. Es bedarf zu derselben vor allen Dingen ein freies
nüchternes Auge, eine sorgfältige und genaue Prüfung und Ver-
bleichung der gleichzeitigen sprachlichen und bildlichen Denkmäler,
lind vor allem das offene Geständniss, dass wir gar noch nicht auf dem
Punkte angelangt sind, wo uns der Schlüssel zur richtigen Entzifferung
dieser mittelalterlichen Hieroglyphik schon für jeden einzelnen Fall
als unfehlbar zur Hand liegt.
So viel auch das Mittelalter aus Gottes Wort die Gegenstände
seiner dichterischen und bildlichen Darstellungen gewählt hat, so
darf doch niemals übersehen werden, dass auch dem damaligen bür-
gerlichen und ritterlichen Leben ein weites Feld für solche Darstel-
lungen eröffnet war, und es heisst die culturhistorische Bedeutung
solcher Sculptur werke gänzlich verkennen, wenn man sich solcher
gewagten Phantasie-Erklärungen hingibt, wie sich auf pag. 13, 15,46
und noch an andern Orten seiner Schrift der Verfasser erlaubt hat.
Cb. Riggenbach. i)
i) Vergt. Möller Tafel XIX und Schreiber, das Münster zu Freiburg
im Breisgau pag- 30.
Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
Seenen mit zahlreichen Personen (Tafel X, XII, XIII) werden mit Glück
bewältigt, was für jene Zeit viel sagen will.
Ein sehr bewegtes, lebensreiches, gut angelegtes Bild ist das
Schlachtengamälde (Tafel XII). Zur Kenntniss damaliger Trachten
und Burgen geben diese Bilder zu Garei manchen erwünschten Bei-
trag. Runkelsteins Fresken verdienen wirklich den Ruhm, der ihnen
zu Theil geworden ist, und wir wünschen sehr, dass die noch übri-
gen Wandgemälde dieser Burg veröff'entlieht werden möchten, beson-
ders sollten zwei Jagdzüge, die auch von Seelos gezeichnet sind
und zu den besten der Bilder auf Runkelstein zählen, den Freunden
deutschen Alterthums nicht vorenthalten werden. — In Bezug der
entweihten Capelle, deren Bl. I1’ Erwähnung geschieht, wird bemerkt,
das sie mit Wandgemälden geschmückt war, die nach allerneuesten
Untersuchungen die Legende St. Katharina, Patronin der Künste
und Wissenschaften, darstellten. Dem Vernehmen nach soll sie reno-
virt werden und wir wünschen vom Herzen, das dies recht bald und
mit Geschmack geschehen möge. — Sollten wir an dem uns vorlie-
genden Prachtwerke etwas ausstellen, so betrifft es die Bezifferung
der Tafel zu Garei, die der Aufeinanderfolge im Texte ganz zuwider
läuft. Eine Angabe der Grösse der Bilder wird auch vermisst.— Zum
Schlüsse können wir im Namen Vieler dem kunstsinnigen Ausschüsse
des Tiroler Landesmuseums nur den verdienten Dank aussprechen
für die Veröffentlichung dieses höchst interesanten Werkes, das zu
den werthvollsten Publicationen der neuesten Zeit gezählt werden
muss. W.
Das Portal zu Remagen. Programm zu F. G. Welker’s 50jahrigem
Jubelfeste. Bonn 1859.
Unter diesem Titel erschien zur Festfeier des 16. Octobers 1859
von Prof. Dr. Braun in Bonn eine Abhandlung, in welcher versucht
wurde die Reliefsbilder am genannten Portale in ihrer symbolischen
Bedeutung zu erklären. Wenn auch nicht auf ganz gleicher Stufe mit
der albernen Auslegungsweise eines Joh.V. K1 e i n in seiner Schrift
über „die Kirche zu Gross-Linden bei Giessen“ theilt doch der Ver-
fasser dieser Schrift über das Portal zu Remagen mit Klei n den Vor-
wurf eigener gewaltsamer Deutung und wenig wissenschaftlicher
Kenntniss in der Kritik der mittelalterlichen Symbolik. Zum Beweise
dafür führen wir die Erklärung des Verfassers hier wörtlich an, welche
er am Schluss seiner Betrachtungen pag. 51 und folgende über das
unter Nr. 18 abgebildete Basrelief gibt. Er sagt: „Neben dem Por-
tale Nr. 18 erblicken wir ein männliches Brustbild mit einer Art
Krone auf dem Haupte, zu beiden Seiten einen Greif, in beiden Hän-
den zwei Thiere, wie zwei Scepter emporhaltend.“
„Der Greif, ein fabelhaftes u. s. w.“
„Dass heidnische Tempel in christliche Kirchen umgewandelt,
profanen Melodien neue Texte untergelegt, heidnischen Festen christ-
liche entgegengestellt worden, ist eine so bekannte Thatsache, dass
man nur daran zu erinnern braucht.“
Es will uns bediinken, der Verfasser dieser eben angeführten
Zeilen hätte sicli weniger an dem Isis- und Mithrascult des unterge-
gangenen Heidenthums, als an die Quellen des neu erwachten christ-
lichen Lebens in den Liedern und Dichtungen des XII. und der folgen-
den Jahrhunderte erinnern sollen, er wäre dann weniger in Gefahr
gerathen, mit seinen Erklärungen auf solche Abnormitäten zu verfallen,
wie wir sie so eben vernommen haben.
Es ist weder die Roma invicta, noch Mithras, noch Phöbus Apollo,
den die beiden Greifen auf dem Sonnenwagen ziehen, sondern es ist die
ganz einfache Darstellung von Al ex a n der des Grossen Greifen-
fahrt, wie solche in Dichtungen aus dem XII. und späterer Jahr-
hunderte geschildert wird, von welcher wir beispielsweise anführen:
1. Im Leben des heiligen Anno (Gedicht aus der ersten Hälfte
des XII. Jahrh.): mit zwein Grifen vuor her in 1 u ft en (Ale-
xander der Grosse.)
2. Im Titurl (Gedicht des XIII. Jahrh.): die Grifen-—daz sic
uns muezen fueren also schönesam den werden Ale-
xand er.
3. ln dem altfranzösischen Gedichte von Alexander (XII. Jahrh.)
tragen ihn 8 Greifen in einem kleinen Hause mit Glasfenstern.
4. ln dem späteren französischen Prosaroman sitzt er gleichfalls
in einem Kasten und 16 Greife tragen denselben.
5. In der lateinischen „Historia Alexandri Magni“ (XII. Jahrh.)
fährt er in einem mit Greifen bespannten Wagen.
6. Konrad von Würzburg sagt spöttischer Weise von einem
andern Dichter:in fuorten überz lebermer der wilden Gri-
fen z we n e. Alexander meint er nicht, und mag vielleicht eher den
Herzog Ernst im Sinne gehabt haben, den allerdings ein Greif, aber
nur einer über das sogenannte Lebermeer trägt, der jedoch dabei
in eine Ochsenhaut eingenäht ist.
AufSculpturwerken ist die Greifenfahrt Alexanders dargestellt:
1. Auf einem Säulen-Capital im Chor des Basler Münsters aus
dem Ende des XII. Jahrhunderts.
2. An der südlichen Thüre im Innern des Kreuzschiffes im Mün-
ster zu Freiburg in Breisgau als Friesornament, gleichfalls vom Ende
des XiI. Jahrh. (abgebildet im II. Bande Tafel XIX der Denkmäler
deutscher Baukunst von Möller).
3. Auf einem Reliquiarium von Elfenbein im Museum zu Darm-
stadt, gleichfalls aus dem XII. Jahrhundert.
Diese hier angeführten Beispiele von Alexanders Greifenfahrt aus
der Dicht-und Bildhauerkunst des Mittelalters mögen (Vorbehalten
Belege aus früheren Jahrhunderten, deren mir bis jetzt keine bekannt
geworden sind) zugleich auch den besten Beweis für die etwaige
Datirung der Sculpturen am Portal zu Remagen liefern , die kaum
über das Ende des XL, am wahrscheinlichsten aber in den Anfang des
XII. Jahrhunderts zu setzen sind. Für letzteres stimmt auch die bar-
barisch rohe Behandlung und deren technische Ausführung, ßeach-
tenswerth bleibt es, dass sowohl am Portal zu Remagen (vid. Nr. 13)
als auch in den beiden angeführten Sculpturen zu Basel und Frei-
burg, Simson, der den Löwen zerreisst, mit dargestellt ist; in beiden
letztgenannten sitzt Simson wie ein Reiter auf dem Löwen und reisst
ihm mit beiden Händen den Rachen auf. Die langen Haare Simsons
haben zur Irrung Anlass gegeben, als ob es ein Weib sei, das auf dem
Löwen sitzt1).
Ohne mich in weitere Widerlegungen der übrigen Erklärungen
einzulassen, welche der Herr Verfasser dieser Abhandlung den übri-
gen Sculpturen dieses Portals unterlegt, möge dieses eben ange-
führte Beispiel genügen, um zu zeigen, auf welche Abwege eine so ein-
seitig vorgehende Richtung in der Erklärung der mittelalterlichen
Symbolik hinführt. Es bedarf zu derselben vor allen Dingen ein freies
nüchternes Auge, eine sorgfältige und genaue Prüfung und Ver-
bleichung der gleichzeitigen sprachlichen und bildlichen Denkmäler,
lind vor allem das offene Geständniss, dass wir gar noch nicht auf dem
Punkte angelangt sind, wo uns der Schlüssel zur richtigen Entzifferung
dieser mittelalterlichen Hieroglyphik schon für jeden einzelnen Fall
als unfehlbar zur Hand liegt.
So viel auch das Mittelalter aus Gottes Wort die Gegenstände
seiner dichterischen und bildlichen Darstellungen gewählt hat, so
darf doch niemals übersehen werden, dass auch dem damaligen bür-
gerlichen und ritterlichen Leben ein weites Feld für solche Darstel-
lungen eröffnet war, und es heisst die culturhistorische Bedeutung
solcher Sculptur werke gänzlich verkennen, wenn man sich solcher
gewagten Phantasie-Erklärungen hingibt, wie sich auf pag. 13, 15,46
und noch an andern Orten seiner Schrift der Verfasser erlaubt hat.
Cb. Riggenbach. i)
i) Vergt. Möller Tafel XIX und Schreiber, das Münster zu Freiburg
im Breisgau pag- 30.
Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.