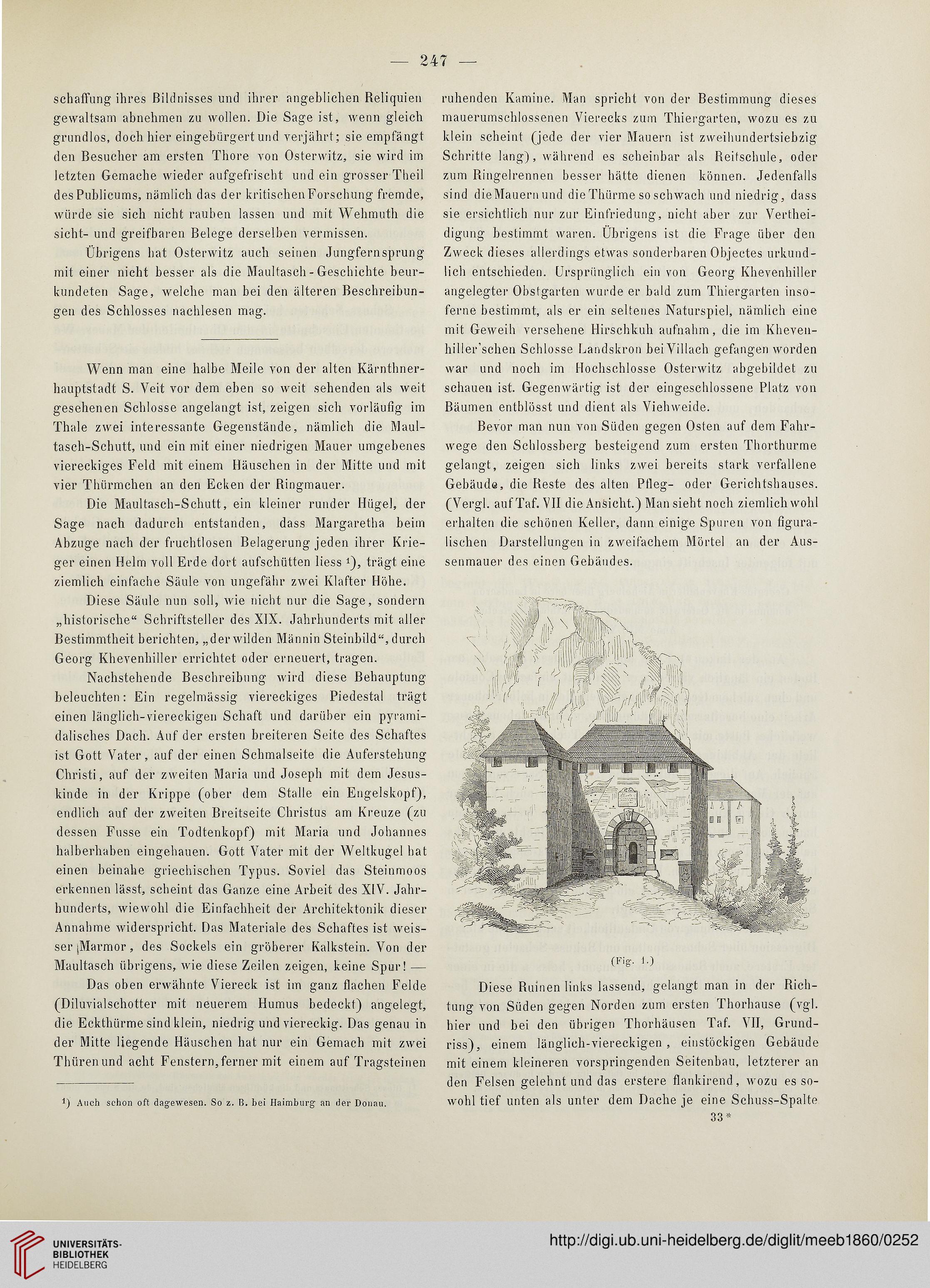247
Schaffung ihres Bildnisses und ihrer angeblichen Reliquien
gewaltsam abnehmen zu wollen. Die Sage ist, wenn gleich
grundlos, doch hier eingebürgert und verjährt; sie empfängt
den Besucher am ersten Thore von Osterwitz, sie wird im
letzten Gemache wieder aufgefrischt und ein grosser Theil
des Publicums, nämlich das der kritischen Forschung fremde,
würde sie sich nicht rauben lassen und mit Wehmuth die
sicht- und greifbaren Belege derselben vermissen.
Übrigens hat Osterwitz auch seinen Jungfernsprung
mit einer nicht besser als die Maultaseh - Geschichte beur-
kundeten Sage, welche man bei den älteren Beschreibun-
gen des Schlosses nachlesen mag.
Wenn man eine halbe Meile von der alten Kärnthner-
hauptstadt S. Veit vor dem eben so weit sehenden als weit
gesehenen Schlosse angelangt ist, zeigen sich vorläufig im
Thale zwei interessante Gegenstände, nämlich die Maul-
tasch-Schutt, und ein mit einer niedrigen Mauer umgebenes
viereckiges Feld mit einem Häuschen in der Mitte und mit
vier Thürmchen an den Ecken der Ringmauer.
Die Maultasch-Schutt, ein kleiner runder Hügel, der
Sage nach dadurch entstanden, dass Margaretha beim
Abzüge nach der fruchtlosen Belagerung jeden ihrer Krie-
ger einen Helm voll Erde dort aufschütten liess *), trägt eine
ziemlich einfache Säule von ungefähr zwei Klafter Höhe.
Diese Säule nun soll, wie nicht nur die Sage, sondern
„historische“ Schriftsteller des XIX. Jahrhunderts mit aller
Bestimmtheit berichten, „derwilden Männin Steinbild“, durch
Georg Khevenhiller errichtet oder erneuert, tragen.
Nachstehende Beschreibung wird diese Behauptung
beleuchten: Ein regelmässig viereckiges Piedestal trägt
einen länglich-viereckigen Schaft und darüber ein pyrami-
dalisches Dach. Auf der ersten breiteren Seite des Schaftes
ist Gott Vater, auf der einen Schmalseite die Auferstehung
Christi, auf der zweiten Maria und Joseph mit dem Jesus-
kinde in der Krippe (ober dem Stalle ein Engelskopf),
endlich auf der zweiten Breitseite Christus am Kreuze (zu
dessen Fusse ein Todtenkopf) mit Maria und Johannes
halberhaben eingehauen. Gott Vater mit der Weltkugel hat
einen beinahe griechischen Typus. Soviel das Steinmoos
erkennen lässt, scheint das Ganze eine Arbeit des XIV. Jahr-
hunderts, wiewohl die Einfachheit der Architektonik dieser
Annahme widerspricht. Das Materiale des Schaftes ist weis-
ser [Marmor, des Sockels ein gröberer Kalkstein. Von der
Maultaseh übrigens, wie diese Zeilen zeigen, keine Spur! —
Das oben erwähnte Viereck ist im ganz flachen Felde
(Diluvialschotter mit neuerem Humus bedeckt) angelegt,
die Eckthürme sind klein, niedrig und viereckig. Das genau in
der Mitte liegende Häuschen hat nur ein Gemach mit zwei
Thürenund acht Fenstern,ferner mit einem auf Tragsteinen 1
ruhenden Kamine. Man spricht von der Bestimmung dieses
mauerumschlossenen Vierecks zum Thiergarten, wozu es zu
klein scheint (jede der vier Mauern ist zweihundertsiebzig
Schritte lang), während es scheinbar als Reitschule, oder
zum Ringelrennen besser hätte dienen können. Jedenfalls
sind die Mauern und die Thürme so schwach und niedrig, dass
sie ersichtlich nur zur Einfriedung, nicht aber zur Verthei-
digung bestimmt waren. Übrigens ist die Frage über den
Zweck dieses allerdings etwas sonderbaren Objectes urkund-
lich entschieden. Ursprünglich ein von Georg Khevenhiller
angelegter Obstgarten wurde er bald zum Thiergarten inso-
ferne bestimmt, als er ein seltenes Naturspiel, nämlich eine
mit Geweih versehene Hirschkuh aufnahm, die im Kheven-
hiller’schen Schlosse Landskron bei Villach gefangen worden
war und noch im Hochschlosse Osterwitz abgebildet zu
schauen ist. Gegenwärtig ist der eingeschlossene Platz von
Bäumen entblösst und dient als Viehweide.
Bevor man nun von Süden gegen Osten auf dem Fahr-
wege den Schlossberg besteigend zum ersten Thorthurme
gelangt, zeigen sich links zwei bereits stark verfallene
Gebäude, die Reste des alten Pfleg- oder Gerichtshauses.
(Vergl. aufTaf. VII die Ansicht.) Man sieht noch ziemlich wohl
erhalten die schönen Keller, dann einige Spuren von figura-
lischen Darstellungen in zweifachem Mörtel an der Aus-
senmauer des einen Gebäudes.
(Fig-, i.)
Diese Ruinen links lassend, gelangt man in der Rich-
tung von Süden gegen Norden zum ersten Thorhause (vgl.
hier und bei den übrigen Thorhäusen Taf. ^ II, Grund-
riss), einem länglich-viereckigen, einstöckigen Gebäude
mit einem kleineren vorspringenden Seitenbau, letzterer an
den Felsen gelehnt und das erstere flankirend, wozu es so-
wohl tief unten als unter dem Dache je eine Schuss-Spalte
33*
1) Auch schon oft dagewesen. So z. 13. bei Haimbnrg an der Donau.
Schaffung ihres Bildnisses und ihrer angeblichen Reliquien
gewaltsam abnehmen zu wollen. Die Sage ist, wenn gleich
grundlos, doch hier eingebürgert und verjährt; sie empfängt
den Besucher am ersten Thore von Osterwitz, sie wird im
letzten Gemache wieder aufgefrischt und ein grosser Theil
des Publicums, nämlich das der kritischen Forschung fremde,
würde sie sich nicht rauben lassen und mit Wehmuth die
sicht- und greifbaren Belege derselben vermissen.
Übrigens hat Osterwitz auch seinen Jungfernsprung
mit einer nicht besser als die Maultaseh - Geschichte beur-
kundeten Sage, welche man bei den älteren Beschreibun-
gen des Schlosses nachlesen mag.
Wenn man eine halbe Meile von der alten Kärnthner-
hauptstadt S. Veit vor dem eben so weit sehenden als weit
gesehenen Schlosse angelangt ist, zeigen sich vorläufig im
Thale zwei interessante Gegenstände, nämlich die Maul-
tasch-Schutt, und ein mit einer niedrigen Mauer umgebenes
viereckiges Feld mit einem Häuschen in der Mitte und mit
vier Thürmchen an den Ecken der Ringmauer.
Die Maultasch-Schutt, ein kleiner runder Hügel, der
Sage nach dadurch entstanden, dass Margaretha beim
Abzüge nach der fruchtlosen Belagerung jeden ihrer Krie-
ger einen Helm voll Erde dort aufschütten liess *), trägt eine
ziemlich einfache Säule von ungefähr zwei Klafter Höhe.
Diese Säule nun soll, wie nicht nur die Sage, sondern
„historische“ Schriftsteller des XIX. Jahrhunderts mit aller
Bestimmtheit berichten, „derwilden Männin Steinbild“, durch
Georg Khevenhiller errichtet oder erneuert, tragen.
Nachstehende Beschreibung wird diese Behauptung
beleuchten: Ein regelmässig viereckiges Piedestal trägt
einen länglich-viereckigen Schaft und darüber ein pyrami-
dalisches Dach. Auf der ersten breiteren Seite des Schaftes
ist Gott Vater, auf der einen Schmalseite die Auferstehung
Christi, auf der zweiten Maria und Joseph mit dem Jesus-
kinde in der Krippe (ober dem Stalle ein Engelskopf),
endlich auf der zweiten Breitseite Christus am Kreuze (zu
dessen Fusse ein Todtenkopf) mit Maria und Johannes
halberhaben eingehauen. Gott Vater mit der Weltkugel hat
einen beinahe griechischen Typus. Soviel das Steinmoos
erkennen lässt, scheint das Ganze eine Arbeit des XIV. Jahr-
hunderts, wiewohl die Einfachheit der Architektonik dieser
Annahme widerspricht. Das Materiale des Schaftes ist weis-
ser [Marmor, des Sockels ein gröberer Kalkstein. Von der
Maultaseh übrigens, wie diese Zeilen zeigen, keine Spur! —
Das oben erwähnte Viereck ist im ganz flachen Felde
(Diluvialschotter mit neuerem Humus bedeckt) angelegt,
die Eckthürme sind klein, niedrig und viereckig. Das genau in
der Mitte liegende Häuschen hat nur ein Gemach mit zwei
Thürenund acht Fenstern,ferner mit einem auf Tragsteinen 1
ruhenden Kamine. Man spricht von der Bestimmung dieses
mauerumschlossenen Vierecks zum Thiergarten, wozu es zu
klein scheint (jede der vier Mauern ist zweihundertsiebzig
Schritte lang), während es scheinbar als Reitschule, oder
zum Ringelrennen besser hätte dienen können. Jedenfalls
sind die Mauern und die Thürme so schwach und niedrig, dass
sie ersichtlich nur zur Einfriedung, nicht aber zur Verthei-
digung bestimmt waren. Übrigens ist die Frage über den
Zweck dieses allerdings etwas sonderbaren Objectes urkund-
lich entschieden. Ursprünglich ein von Georg Khevenhiller
angelegter Obstgarten wurde er bald zum Thiergarten inso-
ferne bestimmt, als er ein seltenes Naturspiel, nämlich eine
mit Geweih versehene Hirschkuh aufnahm, die im Kheven-
hiller’schen Schlosse Landskron bei Villach gefangen worden
war und noch im Hochschlosse Osterwitz abgebildet zu
schauen ist. Gegenwärtig ist der eingeschlossene Platz von
Bäumen entblösst und dient als Viehweide.
Bevor man nun von Süden gegen Osten auf dem Fahr-
wege den Schlossberg besteigend zum ersten Thorthurme
gelangt, zeigen sich links zwei bereits stark verfallene
Gebäude, die Reste des alten Pfleg- oder Gerichtshauses.
(Vergl. aufTaf. VII die Ansicht.) Man sieht noch ziemlich wohl
erhalten die schönen Keller, dann einige Spuren von figura-
lischen Darstellungen in zweifachem Mörtel an der Aus-
senmauer des einen Gebäudes.
(Fig-, i.)
Diese Ruinen links lassend, gelangt man in der Rich-
tung von Süden gegen Norden zum ersten Thorhause (vgl.
hier und bei den übrigen Thorhäusen Taf. ^ II, Grund-
riss), einem länglich-viereckigen, einstöckigen Gebäude
mit einem kleineren vorspringenden Seitenbau, letzterer an
den Felsen gelehnt und das erstere flankirend, wozu es so-
wohl tief unten als unter dem Dache je eine Schuss-Spalte
33*
1) Auch schon oft dagewesen. So z. 13. bei Haimbnrg an der Donau.