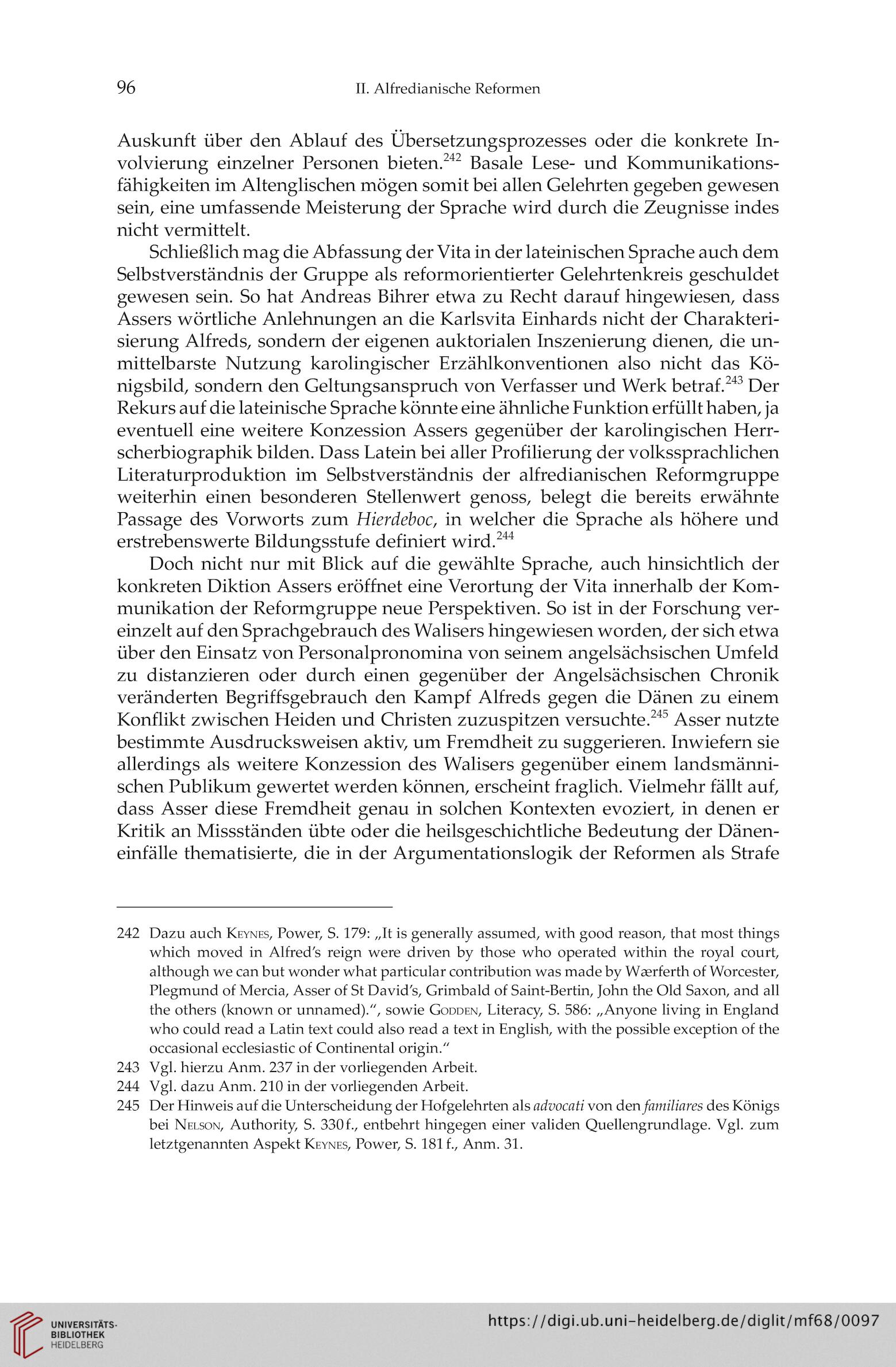96
II. Alfredianische Reformen
Auskunft über den Ablauf des Übersetzungsprozesses oder die konkrete In-
volvierung einzelner Personen bieten.242 Basale Lese- und Kommunikations-
fähigkeiten im Altenglischen mögen somit bei allen Gelehrten gegeben gewesen
sein, eine umfassende Meisterung der Sprache wird durch die Zeugnisse indes
nicht vermittelt.
Schließlich mag die Abfassung der Vita in der lateinischen Sprache auch dem
Selb st Verständnis der Gruppe als reformorientierter Gelehrtenkreis geschuldet
gewesen sein. So hat Andreas Bihrer etwa zu Recht darauf hingewiesen, dass
Assers wörtliche Anlehnungen an die Karlsvita Einhards nicht der Charakteri-
sierung Alfreds, sondern der eigenen auktorialen Inszenierung dienen, die un-
mittelbarste Nutzung karolingischer Erzählkonventionen also nicht das Kö-
nigsbild, sondern den Geltungsanspruch von Verfasser und Werk betraf.243 Der
Rekurs auf die lateinische Sprache könnte eine ähnliche Funktion erfüllt haben, ja
eventuell eine weitere Konzession Assers gegenüber der karolingischen Herr-
scherbiographik bilden. Dass Latein bei aller Profilierung der volkssprachlichen
Literaturproduktion im Selb st Verständnis der alfredianischen Reformgruppe
weiterhin einen besonderen Stellenwert genoss, belegt die bereits erwähnte
Passage des Vorworts zum Hierdeboc, in welcher die Sprache als höhere und
erstrebenswerte Bildungsstufe definiert wird.244
Doch nicht nur mit Blick auf die gewählte Sprache, auch hinsichtlich der
konkreten Diktion Assers eröffnet eine Verortung der Vita innerhalb der Kom-
munikation der Reformgruppe neue Perspektiven. So ist in der Forschung ver-
einzelt auf den Sprachgebrauch des Walisers hingewiesen worden, der sich etwa
über den Einsatz von Personalpronomina von seinem angelsächsischen Umfeld
zu distanzieren oder durch einen gegenüber der Angelsächsischen Chronik
veränderten Begriffsgebrauch den Kampf Alfreds gegen die Dänen zu einem
Konflikt zwischen Heiden und Christen zuzuspitzen versuchte.245 Asser nutzte
bestimmte Ausdrucks weisen aktiv, um Fremdheit zu suggerieren. Inwiefern sie
allerdings als weitere Konzession des Walisers gegenüber einem landsmänni-
schen Publikum gewertet werden können, erscheint fraglich. Vielmehr fällt auf,
dass Asser diese Fremdheit genau in solchen Kontexten evoziert, in denen er
Kritik an Missständen übte oder die heilsgeschichtliche Bedeutung der Dänen-
einfälle thematisierte, die in der Argumentationslogik der Reformen als Strafe
242 Dazu auch Keynes, Power, S. 179: „It is generally assumed, with good reason, that most things
which moved in Alfred's reign were driven by those who operated within the royal court,
although we can but wonder what particular contribution was made by Waerferth of Worcester,
Plegmund of Mercia, Asser of St David's, Grimbald of Saint-Bertin, John the Old Saxon, and all
the others (known or unnamed).", sowie Godden, Literacy, S. 586: „Anyone living in England
who could read a Latin text could also read a text in English, with the possible exception of the
occasional ecclesiastic of Continental origin."
243 Vgl. hierzu Anm. 237 in der vorliegenden Arbeit.
244 Vgl. dazu Anm. 210 in der vorliegenden Arbeit.
245 Der Hinweis auf die Unterscheidung der Hofgelehrten als advocati von den familiäres des Königs
bei Nelson, Authority, S. 330 f., entbehrt hingegen einer validen Quellengrundlage. Vgl. zum
letztgenannten Aspekt Keynes, Power, S. 181 f., Anm. 31.
II. Alfredianische Reformen
Auskunft über den Ablauf des Übersetzungsprozesses oder die konkrete In-
volvierung einzelner Personen bieten.242 Basale Lese- und Kommunikations-
fähigkeiten im Altenglischen mögen somit bei allen Gelehrten gegeben gewesen
sein, eine umfassende Meisterung der Sprache wird durch die Zeugnisse indes
nicht vermittelt.
Schließlich mag die Abfassung der Vita in der lateinischen Sprache auch dem
Selb st Verständnis der Gruppe als reformorientierter Gelehrtenkreis geschuldet
gewesen sein. So hat Andreas Bihrer etwa zu Recht darauf hingewiesen, dass
Assers wörtliche Anlehnungen an die Karlsvita Einhards nicht der Charakteri-
sierung Alfreds, sondern der eigenen auktorialen Inszenierung dienen, die un-
mittelbarste Nutzung karolingischer Erzählkonventionen also nicht das Kö-
nigsbild, sondern den Geltungsanspruch von Verfasser und Werk betraf.243 Der
Rekurs auf die lateinische Sprache könnte eine ähnliche Funktion erfüllt haben, ja
eventuell eine weitere Konzession Assers gegenüber der karolingischen Herr-
scherbiographik bilden. Dass Latein bei aller Profilierung der volkssprachlichen
Literaturproduktion im Selb st Verständnis der alfredianischen Reformgruppe
weiterhin einen besonderen Stellenwert genoss, belegt die bereits erwähnte
Passage des Vorworts zum Hierdeboc, in welcher die Sprache als höhere und
erstrebenswerte Bildungsstufe definiert wird.244
Doch nicht nur mit Blick auf die gewählte Sprache, auch hinsichtlich der
konkreten Diktion Assers eröffnet eine Verortung der Vita innerhalb der Kom-
munikation der Reformgruppe neue Perspektiven. So ist in der Forschung ver-
einzelt auf den Sprachgebrauch des Walisers hingewiesen worden, der sich etwa
über den Einsatz von Personalpronomina von seinem angelsächsischen Umfeld
zu distanzieren oder durch einen gegenüber der Angelsächsischen Chronik
veränderten Begriffsgebrauch den Kampf Alfreds gegen die Dänen zu einem
Konflikt zwischen Heiden und Christen zuzuspitzen versuchte.245 Asser nutzte
bestimmte Ausdrucks weisen aktiv, um Fremdheit zu suggerieren. Inwiefern sie
allerdings als weitere Konzession des Walisers gegenüber einem landsmänni-
schen Publikum gewertet werden können, erscheint fraglich. Vielmehr fällt auf,
dass Asser diese Fremdheit genau in solchen Kontexten evoziert, in denen er
Kritik an Missständen übte oder die heilsgeschichtliche Bedeutung der Dänen-
einfälle thematisierte, die in der Argumentationslogik der Reformen als Strafe
242 Dazu auch Keynes, Power, S. 179: „It is generally assumed, with good reason, that most things
which moved in Alfred's reign were driven by those who operated within the royal court,
although we can but wonder what particular contribution was made by Waerferth of Worcester,
Plegmund of Mercia, Asser of St David's, Grimbald of Saint-Bertin, John the Old Saxon, and all
the others (known or unnamed).", sowie Godden, Literacy, S. 586: „Anyone living in England
who could read a Latin text could also read a text in English, with the possible exception of the
occasional ecclesiastic of Continental origin."
243 Vgl. hierzu Anm. 237 in der vorliegenden Arbeit.
244 Vgl. dazu Anm. 210 in der vorliegenden Arbeit.
245 Der Hinweis auf die Unterscheidung der Hofgelehrten als advocati von den familiäres des Königs
bei Nelson, Authority, S. 330 f., entbehrt hingegen einer validen Quellengrundlage. Vgl. zum
letztgenannten Aspekt Keynes, Power, S. 181 f., Anm. 31.