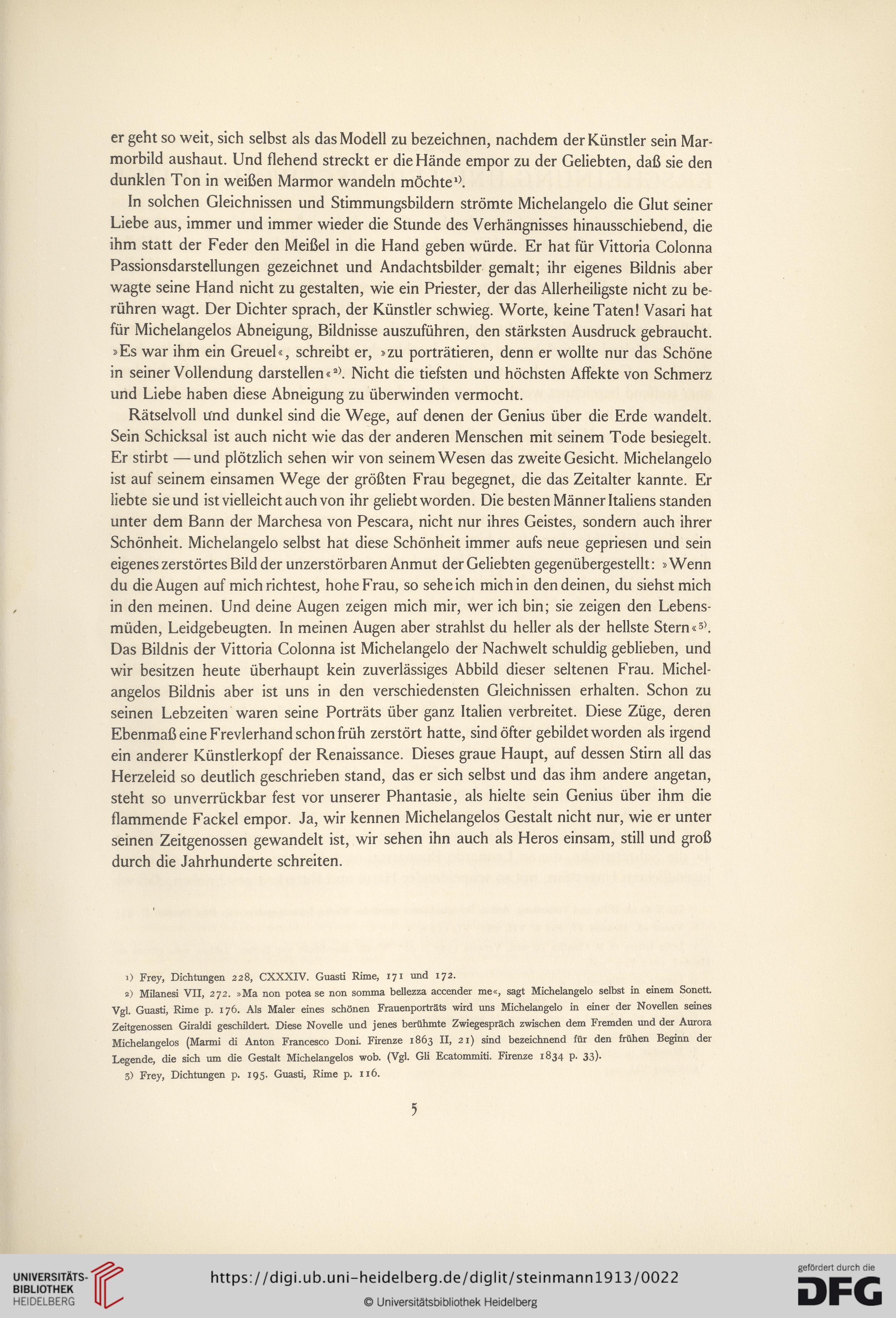er geht so weit, sich selbst als das Modell zu bezeichnen, nachdem der Künstler sein Mar-
morbild aushaut. Und flehend streckt er die Hände empor zu der Geliebten, daß sie den
dunklen Ton in weißen Marmor wandeln möchte0.
In solchen Gleichnissen und Stimmungsbildern strömte Michelangelo die Glut seiner
Liebe aus, immer und immer wieder die Stunde des Verhängnisses hinausschiebend, die
ihm statt der Feder den Meißel in die Hand geben würde. Er hat für Vittoria Colonna
Passionsdarstellungen gezeichnet und Andachtsbilder gemalt; ihr eigenes Bildnis aber
wagte seine Hand nicht zu gestalten, wie ein Priester, der das Allerheiligste nicht zu be-
rühren wagt. Der Dichter sprach, der Künstler schwieg. Worte, keine Taten! Vasari hat
für Michelangelos Abneigung, Bildnisse auszuführen, den stärksten Ausdruck gebraucht.
»Es war ihm ein Greuel«, schreibt er, »zu porträtieren, denn er wollte nur das Schöne
in seiner Vollendung darstellen«1 2). Nicht die tiefsten und höchsten Affekte von Schmerz
und Liebe haben diese Abneigung zu überwinden vermocht.
Rätselvoll Und dunkel sind die Wege, auf denen der Genius über die Erde wandelt.
Sein Schicksal ist auch nicht wie das der anderen Menschen mit seinem Tode besiegelt.
Er stirbt —und plötzlich sehen wir von seinem Wesen das zweite Gesicht. Michelangelo
ist auf seinem einsamen Wege der größten Frau begegnet, die das Zeitalter kannte. Er
liebte sie und ist vielleicht auch von ihr geliebt worden. Die besten Männer Italiens standen
unter dem Bann der Marchesa von Pescara, nicht nur ihres Geistes, sondern auch ihrer
Schönheit. Michelangelo selbst hat diese Schönheit immer aufs neue gepriesen und sein
eigenes zerstörtes Bild der unzerstörbaren Anmut der Geliebten gegenübergestellt: »Wenn
du die Augen auf mich richtest, hohe Frau, so sehe ich mich in den deinen, du siehst mich
in den meinen. Und deine Augen zeigen mich mir, wer ich bin; sie zeigen den Lebens-
müden, Leidgebeugten. In meinen Augen aber strahlst du heller als der hellste Stern «3).
Das Bildnis der Vittoria Colonna ist Michelangelo der Nachwelt schuldig geblieben, und
wir besitzen heute überhaupt kein zuverlässiges Abbild dieser seltenen Frau. Michel-
angelos Bildnis aber ist uns in den verschiedensten Gleichnissen erhalten. Schon zu
seinen Lebzeiten waren seine Porträts über ganz Italien verbreitet. Diese Züge, deren
Ebenmaß eine Frevlerhand schon früh zerstört hatte, sind öfter gebildet worden als irgend
ein anderer Künstlerkopf der Renaissance. Dieses graue Haupt, auf dessen Stirn all das
Herzeleid so deutlich geschrieben stand, das er sich selbst und das ihm andere angetan,
steht so unverrückbar fest vor unserer Phantasie, als hielte sein Genius über ihm die
flammende Fackel empor. Ja, wir kennen Michelangelos Gestalt nicht nur, wie er unter
seinen Zeitgenossen gewandelt ist, wir sehen ihn auch als Heros einsam, still und groß
durch die Jahrhunderte schreiten.
1) Frey, Dichtungen 228, CXXXIV. Guasti Rime, 171 und 172.
2) Milanesi VII, 272. »Ma non potea se non somma bellezza accender me«, sagt Michelangelo selbst in einem Sonett.
Vgl. Guasti, Rime p. 176. Als Maler eines schönen Frauenporträts wird uns Michelangelo in einer der Novellen seines
Zeitgenossen Giraldi geschildert. Diese Novelle und jenes berühmte Zwiegespräch zwischen dem Fremden und der Aurora
Michelangelos (Marmi di Anton Francesco Doni. Firenze 1863 II, 21) sind bezeichnend für den frühen Beginn der
Legende, die sich um die Gestalt Michelangelos wob. (Vgl. Gli Ecatommiti. Firenze 1834 p. 33).
3) Frey, Dichtungen p. 195. Guasti, Rime p. 116.
morbild aushaut. Und flehend streckt er die Hände empor zu der Geliebten, daß sie den
dunklen Ton in weißen Marmor wandeln möchte0.
In solchen Gleichnissen und Stimmungsbildern strömte Michelangelo die Glut seiner
Liebe aus, immer und immer wieder die Stunde des Verhängnisses hinausschiebend, die
ihm statt der Feder den Meißel in die Hand geben würde. Er hat für Vittoria Colonna
Passionsdarstellungen gezeichnet und Andachtsbilder gemalt; ihr eigenes Bildnis aber
wagte seine Hand nicht zu gestalten, wie ein Priester, der das Allerheiligste nicht zu be-
rühren wagt. Der Dichter sprach, der Künstler schwieg. Worte, keine Taten! Vasari hat
für Michelangelos Abneigung, Bildnisse auszuführen, den stärksten Ausdruck gebraucht.
»Es war ihm ein Greuel«, schreibt er, »zu porträtieren, denn er wollte nur das Schöne
in seiner Vollendung darstellen«1 2). Nicht die tiefsten und höchsten Affekte von Schmerz
und Liebe haben diese Abneigung zu überwinden vermocht.
Rätselvoll Und dunkel sind die Wege, auf denen der Genius über die Erde wandelt.
Sein Schicksal ist auch nicht wie das der anderen Menschen mit seinem Tode besiegelt.
Er stirbt —und plötzlich sehen wir von seinem Wesen das zweite Gesicht. Michelangelo
ist auf seinem einsamen Wege der größten Frau begegnet, die das Zeitalter kannte. Er
liebte sie und ist vielleicht auch von ihr geliebt worden. Die besten Männer Italiens standen
unter dem Bann der Marchesa von Pescara, nicht nur ihres Geistes, sondern auch ihrer
Schönheit. Michelangelo selbst hat diese Schönheit immer aufs neue gepriesen und sein
eigenes zerstörtes Bild der unzerstörbaren Anmut der Geliebten gegenübergestellt: »Wenn
du die Augen auf mich richtest, hohe Frau, so sehe ich mich in den deinen, du siehst mich
in den meinen. Und deine Augen zeigen mich mir, wer ich bin; sie zeigen den Lebens-
müden, Leidgebeugten. In meinen Augen aber strahlst du heller als der hellste Stern «3).
Das Bildnis der Vittoria Colonna ist Michelangelo der Nachwelt schuldig geblieben, und
wir besitzen heute überhaupt kein zuverlässiges Abbild dieser seltenen Frau. Michel-
angelos Bildnis aber ist uns in den verschiedensten Gleichnissen erhalten. Schon zu
seinen Lebzeiten waren seine Porträts über ganz Italien verbreitet. Diese Züge, deren
Ebenmaß eine Frevlerhand schon früh zerstört hatte, sind öfter gebildet worden als irgend
ein anderer Künstlerkopf der Renaissance. Dieses graue Haupt, auf dessen Stirn all das
Herzeleid so deutlich geschrieben stand, das er sich selbst und das ihm andere angetan,
steht so unverrückbar fest vor unserer Phantasie, als hielte sein Genius über ihm die
flammende Fackel empor. Ja, wir kennen Michelangelos Gestalt nicht nur, wie er unter
seinen Zeitgenossen gewandelt ist, wir sehen ihn auch als Heros einsam, still und groß
durch die Jahrhunderte schreiten.
1) Frey, Dichtungen 228, CXXXIV. Guasti Rime, 171 und 172.
2) Milanesi VII, 272. »Ma non potea se non somma bellezza accender me«, sagt Michelangelo selbst in einem Sonett.
Vgl. Guasti, Rime p. 176. Als Maler eines schönen Frauenporträts wird uns Michelangelo in einer der Novellen seines
Zeitgenossen Giraldi geschildert. Diese Novelle und jenes berühmte Zwiegespräch zwischen dem Fremden und der Aurora
Michelangelos (Marmi di Anton Francesco Doni. Firenze 1863 II, 21) sind bezeichnend für den frühen Beginn der
Legende, die sich um die Gestalt Michelangelos wob. (Vgl. Gli Ecatommiti. Firenze 1834 p. 33).
3) Frey, Dichtungen p. 195. Guasti, Rime p. 116.