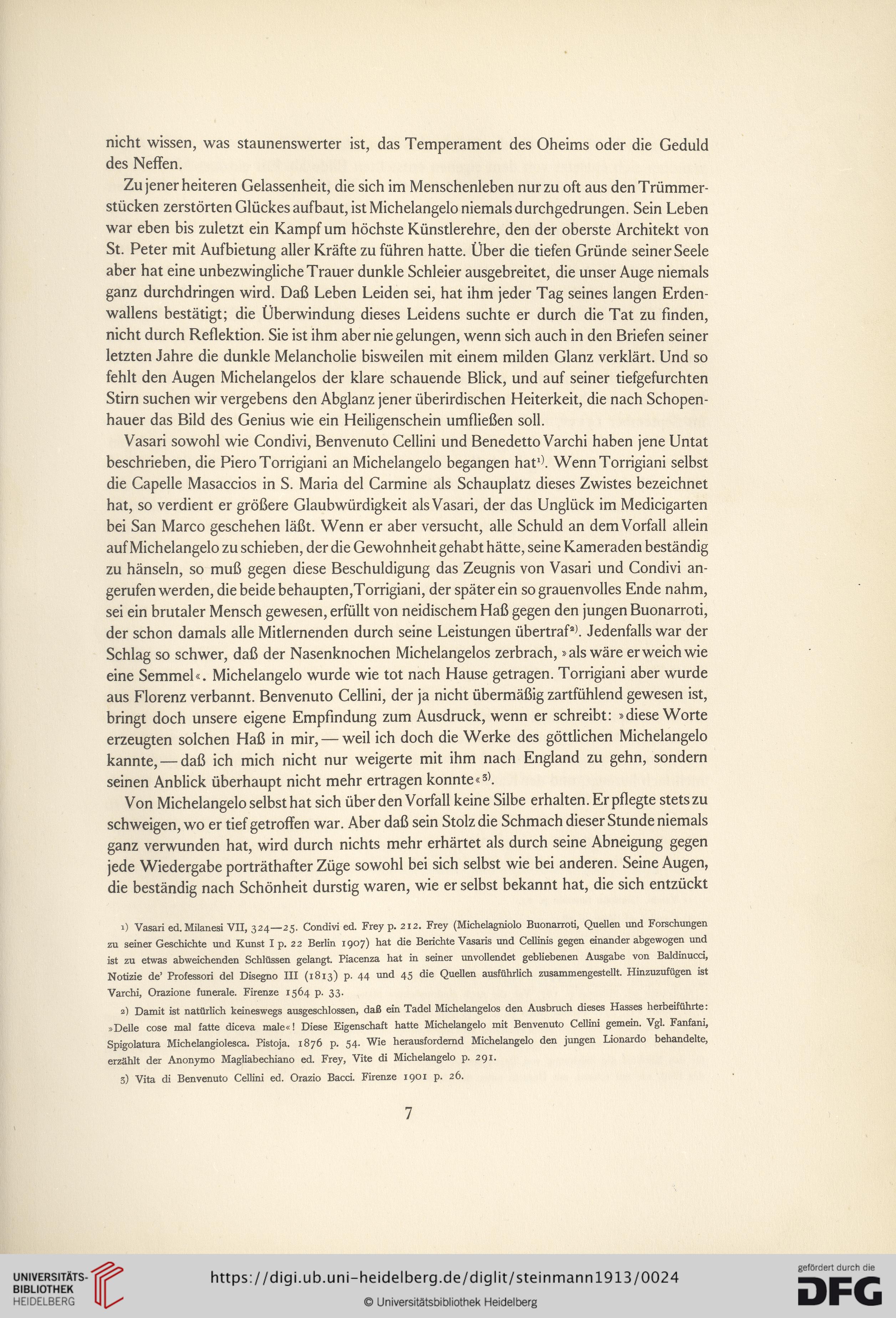nicht wissen, was staunenswerter ist, das Temperament des Oheims oder die Geduld
des Neffen.
Zu jener heiteren Gelassenheit, die sich im Menschenleben nur zu oft aus denTrümmer-
stücken zerstörten Glückes aufbaut, ist Michelangelo niemals durchgedrungen. Sein Leben
war eben bis zuletzt ein Kampf um höchste Künstlerehre, den der oberste Architekt von
St. Peter mit Aufbietung aller Kräfte zu führen hatte. Über die tiefen Gründe seiner Seele
aber hat eine unbezwingliche Trauer dunkle Schleier ausgebreitet, die unser Auge niemals
ganz durchdringen wird. Daß Leben Leiden sei, hat ihm jeder Tag seines langen Erden-
wallens bestätigt; die Überwindung dieses Leidens suchte er durch die Tat zu finden,
nicht durch Reflektion. Sie ist ihm aber nie gelungen, wenn sich auch in den Briefen seiner
letzten Jahre die dunkle Melancholie bisweilen mit einem milden Glanz verklärt. Und so
fehlt den Augen Michelangelos der klare schauende Blick, und auf seiner tiefgefurchten
Stirn suchen wir vergebens den Abglanz jener überirdischen Heiterkeit, die nach Schopen-
hauer das Bild des Genius wie ein Heiligenschein umfließen soll.
Vasari sowohl wie Condivi, Benvenuto Cellini und Benedetto Varchi haben jene Untat
beschrieben, die Piero Torrigiani an Michelangelo begangen hat1). WennTorrigiani selbst
die Capelle Masaccios in S. Maria del Carmine als Schauplatz dieses Zwistes bezeichnet
hat, so verdient er größere Glaubwürdigkeit als Vasari, der das Unglück im Medicigarten
bei San Marco geschehen läßt. Wenn er aber versucht, alle Schuld an dem Vorfall allein
auf Michelangelo zu schieben, der die Gewohnheit gehabt hätte, seine Kameraden beständig
zu hänseln, so muß gegen diese Beschuldigung das Zeugnis von Vasari und Condivi an-
gerufenwerden, die beide behaupten,Torrigiani, der später ein so grauenvolles Ende nahm,
sei ein brutaler Mensch gewesen, erfüllt von neidischem Haß gegen den jungen Buonarroti,
der schon damals alle Mitlernenden durch seine Leistungen übertraf2). Jedenfalls war der
Schlag so schwer, daß der Nasenknochen Michelangelos zerbrach, »als wäre er weich wie
eine Semmel«. Michelangelo wurde wie tot nach Hause getragen. Torrigiani aber wurde
aus Florenz verbannt. Benvenuto Cellini, der ja nicht übermäßig zartfühlend gewesen ist,
bringt doch unsere eigene Empfindung zum Ausdruck, wenn er schreibt: »diese Worte
erzeugten solchen Haß in mir, — weil ich doch die Werke des göttlichen Michelangelo
kannte, — daß ich mich nicht nur weigerte mit ihm nach England zu gehn, sondern
seinen Anblick überhaupt nicht mehr ertragen konnte«3).
Von Michelangelo selbst hat sich über den Vorfall keine Silbe erhalten. Er pflegte stets zu
schweigen, wo er tief getroffen war. Aber daß sein Stolz die Schmach dieser Stunde niemals
ganz verwunden hat, wird durch nichts mehr erhärtet als durch seine Abneigung gegen
jede Wiedergabe porträthafter Züge sowohl bei sich selbst wie bei anderen. Seine Augen,
die beständig nach Schönheit durstig waren, wie er selbst bekannt hat, die sich entzückt
1) Vasari ed.Milanesi VII, 324—25. Condivi ed. Frey p. 212. Frey (Michelagniolo Buonarroti, Quellen und Forschungen
zu seiner Geschichte und Kunst I p. 22 Berlin 1907) hat die Berichte Vasaris und Cellinis gegen einander abgewogen und
ist zu etwas abweichenden Schlüssen gelangt. Piacenza hat in seiner unvollendet gebliebenen Ausgabe von Baldinucci,
Notizie de’ Professori del Disegno III (1813) p. 44 und 45 die Quellen ausführlich zusammengestellt. Hinzuzufügen ist
Varchi, Orazione funerale. Firenze 1564 p. 33.
2) Damit ist natürlich keineswegs ausgeschlossen, daß ein Tadel Michelangelos den Ausbruch dieses Hasses herbeiführte:
»Delle cose mal fatte diceva male«! Diese Eigenschaft hatte Michelangelo mit Benvenuto Cellini gemein. Vgl. Fanfani,
Spigolatura Michelangiolesca. Pistoja. 1876 p. 54. Wie herausfordernd Michelangelo den jungen Lionardo behandelte,
erzählt der Anonymo Magliabechiano ed. Frey, Vite di Michelangelo p. 291.
3) Vita di Benvenuto Cellini ed. Orazio Bacci. Firenze 1901 p. 26.
7
des Neffen.
Zu jener heiteren Gelassenheit, die sich im Menschenleben nur zu oft aus denTrümmer-
stücken zerstörten Glückes aufbaut, ist Michelangelo niemals durchgedrungen. Sein Leben
war eben bis zuletzt ein Kampf um höchste Künstlerehre, den der oberste Architekt von
St. Peter mit Aufbietung aller Kräfte zu führen hatte. Über die tiefen Gründe seiner Seele
aber hat eine unbezwingliche Trauer dunkle Schleier ausgebreitet, die unser Auge niemals
ganz durchdringen wird. Daß Leben Leiden sei, hat ihm jeder Tag seines langen Erden-
wallens bestätigt; die Überwindung dieses Leidens suchte er durch die Tat zu finden,
nicht durch Reflektion. Sie ist ihm aber nie gelungen, wenn sich auch in den Briefen seiner
letzten Jahre die dunkle Melancholie bisweilen mit einem milden Glanz verklärt. Und so
fehlt den Augen Michelangelos der klare schauende Blick, und auf seiner tiefgefurchten
Stirn suchen wir vergebens den Abglanz jener überirdischen Heiterkeit, die nach Schopen-
hauer das Bild des Genius wie ein Heiligenschein umfließen soll.
Vasari sowohl wie Condivi, Benvenuto Cellini und Benedetto Varchi haben jene Untat
beschrieben, die Piero Torrigiani an Michelangelo begangen hat1). WennTorrigiani selbst
die Capelle Masaccios in S. Maria del Carmine als Schauplatz dieses Zwistes bezeichnet
hat, so verdient er größere Glaubwürdigkeit als Vasari, der das Unglück im Medicigarten
bei San Marco geschehen läßt. Wenn er aber versucht, alle Schuld an dem Vorfall allein
auf Michelangelo zu schieben, der die Gewohnheit gehabt hätte, seine Kameraden beständig
zu hänseln, so muß gegen diese Beschuldigung das Zeugnis von Vasari und Condivi an-
gerufenwerden, die beide behaupten,Torrigiani, der später ein so grauenvolles Ende nahm,
sei ein brutaler Mensch gewesen, erfüllt von neidischem Haß gegen den jungen Buonarroti,
der schon damals alle Mitlernenden durch seine Leistungen übertraf2). Jedenfalls war der
Schlag so schwer, daß der Nasenknochen Michelangelos zerbrach, »als wäre er weich wie
eine Semmel«. Michelangelo wurde wie tot nach Hause getragen. Torrigiani aber wurde
aus Florenz verbannt. Benvenuto Cellini, der ja nicht übermäßig zartfühlend gewesen ist,
bringt doch unsere eigene Empfindung zum Ausdruck, wenn er schreibt: »diese Worte
erzeugten solchen Haß in mir, — weil ich doch die Werke des göttlichen Michelangelo
kannte, — daß ich mich nicht nur weigerte mit ihm nach England zu gehn, sondern
seinen Anblick überhaupt nicht mehr ertragen konnte«3).
Von Michelangelo selbst hat sich über den Vorfall keine Silbe erhalten. Er pflegte stets zu
schweigen, wo er tief getroffen war. Aber daß sein Stolz die Schmach dieser Stunde niemals
ganz verwunden hat, wird durch nichts mehr erhärtet als durch seine Abneigung gegen
jede Wiedergabe porträthafter Züge sowohl bei sich selbst wie bei anderen. Seine Augen,
die beständig nach Schönheit durstig waren, wie er selbst bekannt hat, die sich entzückt
1) Vasari ed.Milanesi VII, 324—25. Condivi ed. Frey p. 212. Frey (Michelagniolo Buonarroti, Quellen und Forschungen
zu seiner Geschichte und Kunst I p. 22 Berlin 1907) hat die Berichte Vasaris und Cellinis gegen einander abgewogen und
ist zu etwas abweichenden Schlüssen gelangt. Piacenza hat in seiner unvollendet gebliebenen Ausgabe von Baldinucci,
Notizie de’ Professori del Disegno III (1813) p. 44 und 45 die Quellen ausführlich zusammengestellt. Hinzuzufügen ist
Varchi, Orazione funerale. Firenze 1564 p. 33.
2) Damit ist natürlich keineswegs ausgeschlossen, daß ein Tadel Michelangelos den Ausbruch dieses Hasses herbeiführte:
»Delle cose mal fatte diceva male«! Diese Eigenschaft hatte Michelangelo mit Benvenuto Cellini gemein. Vgl. Fanfani,
Spigolatura Michelangiolesca. Pistoja. 1876 p. 54. Wie herausfordernd Michelangelo den jungen Lionardo behandelte,
erzählt der Anonymo Magliabechiano ed. Frey, Vite di Michelangelo p. 291.
3) Vita di Benvenuto Cellini ed. Orazio Bacci. Firenze 1901 p. 26.
7