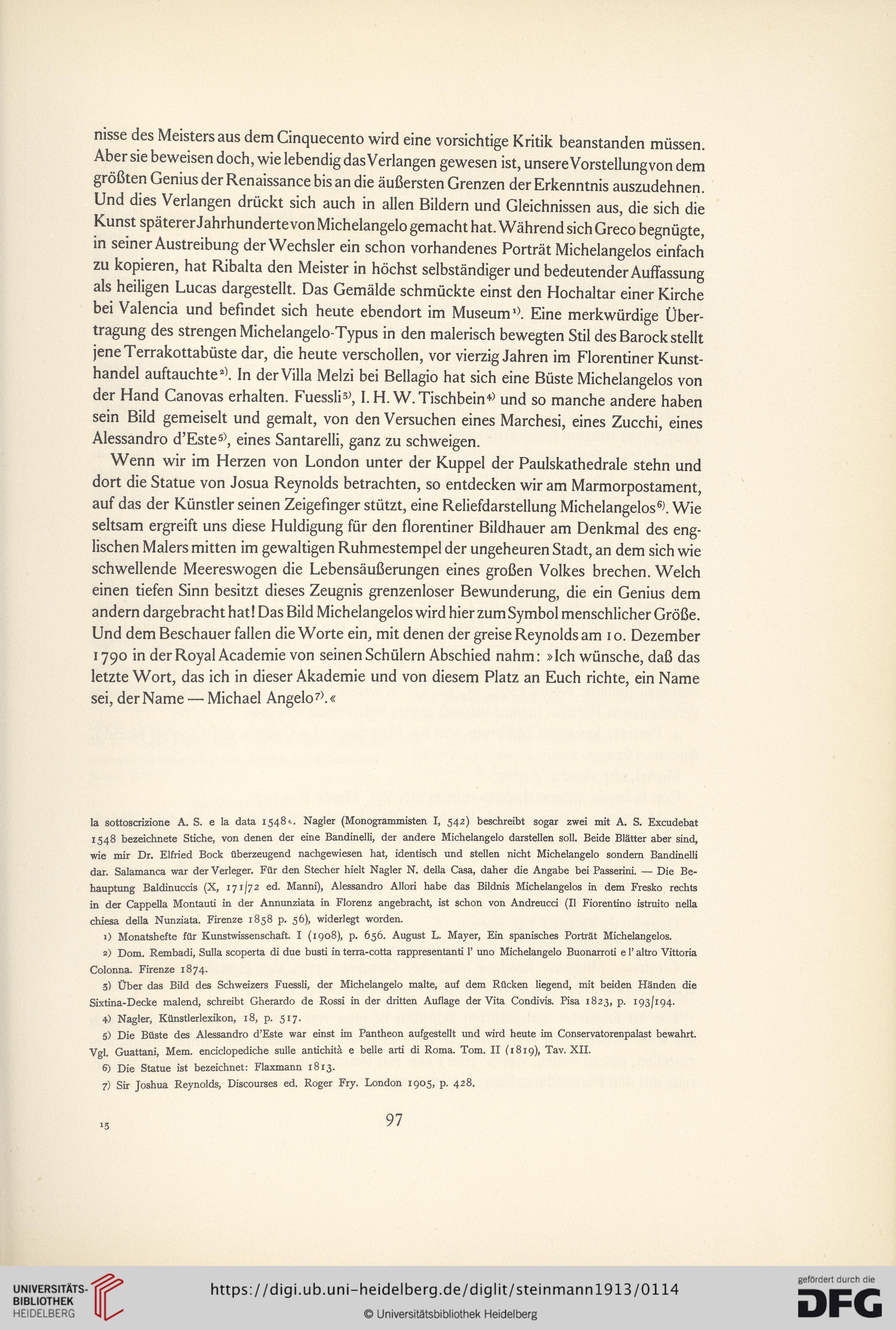nisse des Meisters aus dem Cinquecento wird eine vorsichtige Kritik beanstanden müssen.
Aber sie beweisen doch, wie lebendig dasVerlangen gewesen ist, unsere Vorstellungvon dem
größten Genius der Renaissance bis an die äußersten Grenzen der Erkenntnis auszudehnen.
Und dies Verlangen drückt sich auch in allen Bildern und Gleichnissen aus, die sich die
Kunst späterer Jahrhunderte von Michelangelo gemacht hat. Während sich Greco begnügte,
in seiner Austreibung der Wechsler ein schon vorhandenes Porträt Michelangelos einfach
zu kopieren, hat Ribalta den Meister in höchst selbständiger und bedeutender Auffassung
als heiligen Lucas dargestellt. Das Gemälde schmückte einst den Hochaltar einer Kirche
bei Valencia und befindet sich heute ebendort im Museumx). Eine merkwürdige Über-
tragung des strengen Michelangelo-Typus in den malerisch bewegten Stil des Barock stellt
jene Terrakottabüste dar, die heute verschollen, vor vierzig Jahren im Florentiner Kunst-
handel auftauchte2). In der Villa Melzi bei Bellagio hat sich eine Büste Michelangelos von
der Hand Canovas erhalten. Fuessli3), I. H. W. Tischbein4) und so manche andere haben
sein Bild gemeiselt und gemalt, von den Versuchen eines Marchesi, eines Zucchi, eines
Alessandro d’Este5), eines Santarelli, ganz zu schweigen.
Wenn wir im Herzen von London unter der Kuppel der Paulskathedrale stehn und
dort die Statue von Josua Reynolds betrachten, so entdecken wir am Marmorpostament,
auf das der Künstler seinen Zeigefinger stützt, eine Reliefdarstellung Michelangelos6\ Wie
seltsam ergreift uns diese Huldigung für den florentiner Bildhauer am Denkmal des eng-
lischen Malers mitten im gewaltigen Ruhmestempel der ungeheuren Stadt, an dem sich wie
schwellende Meereswogen die Lebensäußerungen eines großen Volkes brechen. Welch
einen tiefen Sinn besitzt dieses Zeugnis grenzenloser Bewunderung, die ein Genius dem
andern dargebracht hat! Das Bild Michelangelos wird hier zum Symbol menschlicher Größe.
Und dem Beschauer fallen die Worte ein, mit denen der greise Reynolds am i o. Dezember
1790 in der Royal Academie von seinen Schülern Abschied nahm: »Ich wünsche, daß das
letzte Wort, das ich in dieser Akademie und von diesem Platz an Euch richte, ein Name
sei, der Name — Michael Angelo7).«
Ia sottoscrizione A. S. e la data 1548^. Nagler (Monogrammisten I, 542) beschreibt sogar zwei mit A. S. Excudebat
1548 bezeichnete Stiche, von denen der eine Bandinelli, der andere Michelangelo darstellen soll. Beide Blätter aber sind,
wie mir Dr. Elfried Bock überzeugend nachgewiesen hat, identisch und stellen nicht Michelangelo sondern Bandinelli
dar. Salamanca war der Verleger. Für den Stecher hielt Nagler N. della Casa, daher die Angabe bei Passerini. — Die Be-
hauptung Baldinuccis (X, 171/72 ed. Manni), Alessandro Allori habe das Bildnis Michelangelos in dem Fresko rechts
in der Cappella Montauti in der Annunziata in Florenz angebracht, ist schon von Andreucci (II Fiorentino istruito nella
chiesa della Nunziata. Firenze 1858 p. 56), widerlegt worden.
1) Monatshefte für Kunstwissenschaft. I (1908), p. 656. August L. Mayer, Ein spanisches Porträt Michelangelos.
2) Dom. Rembadi, Sulla scoperta di due busti in terra-cotta rappresentanti 1’ uno Michelangelo Buonarroti e 1’ altro Vittoria
Colonna. Firenze 1874.
3) Über das Bild des Schweizers Fuessli, der Michelangelo malte, auf dem Rücken liegend, mit beiden Händen die
Sixtina-Decke malend, schreibt Gherardo de Rossi in der dritten Auflage der Vita Condivis. Pisa 1823, p. 193/194.
4) Nagler, Künstlerlexikon, 18, p. 517.
5) Die Büste des Alessandro d’Este war einst im Pantheon aufgestellt und wird heute im Conservatorenpalast bewahrt.
Vgl. G^attanij Mem. enciclopediche sulle antichitä e belle arti di Roma. Tom. II (1819), Tav. XII.
6) Die Statue ist bezeichnet: Flaxmann 1813.
7) Sir Joshua Reynolds, Discourses ed. Roger Fry. London 1905, p. 428.
15
97
Aber sie beweisen doch, wie lebendig dasVerlangen gewesen ist, unsere Vorstellungvon dem
größten Genius der Renaissance bis an die äußersten Grenzen der Erkenntnis auszudehnen.
Und dies Verlangen drückt sich auch in allen Bildern und Gleichnissen aus, die sich die
Kunst späterer Jahrhunderte von Michelangelo gemacht hat. Während sich Greco begnügte,
in seiner Austreibung der Wechsler ein schon vorhandenes Porträt Michelangelos einfach
zu kopieren, hat Ribalta den Meister in höchst selbständiger und bedeutender Auffassung
als heiligen Lucas dargestellt. Das Gemälde schmückte einst den Hochaltar einer Kirche
bei Valencia und befindet sich heute ebendort im Museumx). Eine merkwürdige Über-
tragung des strengen Michelangelo-Typus in den malerisch bewegten Stil des Barock stellt
jene Terrakottabüste dar, die heute verschollen, vor vierzig Jahren im Florentiner Kunst-
handel auftauchte2). In der Villa Melzi bei Bellagio hat sich eine Büste Michelangelos von
der Hand Canovas erhalten. Fuessli3), I. H. W. Tischbein4) und so manche andere haben
sein Bild gemeiselt und gemalt, von den Versuchen eines Marchesi, eines Zucchi, eines
Alessandro d’Este5), eines Santarelli, ganz zu schweigen.
Wenn wir im Herzen von London unter der Kuppel der Paulskathedrale stehn und
dort die Statue von Josua Reynolds betrachten, so entdecken wir am Marmorpostament,
auf das der Künstler seinen Zeigefinger stützt, eine Reliefdarstellung Michelangelos6\ Wie
seltsam ergreift uns diese Huldigung für den florentiner Bildhauer am Denkmal des eng-
lischen Malers mitten im gewaltigen Ruhmestempel der ungeheuren Stadt, an dem sich wie
schwellende Meereswogen die Lebensäußerungen eines großen Volkes brechen. Welch
einen tiefen Sinn besitzt dieses Zeugnis grenzenloser Bewunderung, die ein Genius dem
andern dargebracht hat! Das Bild Michelangelos wird hier zum Symbol menschlicher Größe.
Und dem Beschauer fallen die Worte ein, mit denen der greise Reynolds am i o. Dezember
1790 in der Royal Academie von seinen Schülern Abschied nahm: »Ich wünsche, daß das
letzte Wort, das ich in dieser Akademie und von diesem Platz an Euch richte, ein Name
sei, der Name — Michael Angelo7).«
Ia sottoscrizione A. S. e la data 1548^. Nagler (Monogrammisten I, 542) beschreibt sogar zwei mit A. S. Excudebat
1548 bezeichnete Stiche, von denen der eine Bandinelli, der andere Michelangelo darstellen soll. Beide Blätter aber sind,
wie mir Dr. Elfried Bock überzeugend nachgewiesen hat, identisch und stellen nicht Michelangelo sondern Bandinelli
dar. Salamanca war der Verleger. Für den Stecher hielt Nagler N. della Casa, daher die Angabe bei Passerini. — Die Be-
hauptung Baldinuccis (X, 171/72 ed. Manni), Alessandro Allori habe das Bildnis Michelangelos in dem Fresko rechts
in der Cappella Montauti in der Annunziata in Florenz angebracht, ist schon von Andreucci (II Fiorentino istruito nella
chiesa della Nunziata. Firenze 1858 p. 56), widerlegt worden.
1) Monatshefte für Kunstwissenschaft. I (1908), p. 656. August L. Mayer, Ein spanisches Porträt Michelangelos.
2) Dom. Rembadi, Sulla scoperta di due busti in terra-cotta rappresentanti 1’ uno Michelangelo Buonarroti e 1’ altro Vittoria
Colonna. Firenze 1874.
3) Über das Bild des Schweizers Fuessli, der Michelangelo malte, auf dem Rücken liegend, mit beiden Händen die
Sixtina-Decke malend, schreibt Gherardo de Rossi in der dritten Auflage der Vita Condivis. Pisa 1823, p. 193/194.
4) Nagler, Künstlerlexikon, 18, p. 517.
5) Die Büste des Alessandro d’Este war einst im Pantheon aufgestellt und wird heute im Conservatorenpalast bewahrt.
Vgl. G^attanij Mem. enciclopediche sulle antichitä e belle arti di Roma. Tom. II (1819), Tav. XII.
6) Die Statue ist bezeichnet: Flaxmann 1813.
7) Sir Joshua Reynolds, Discourses ed. Roger Fry. London 1905, p. 428.
15
97