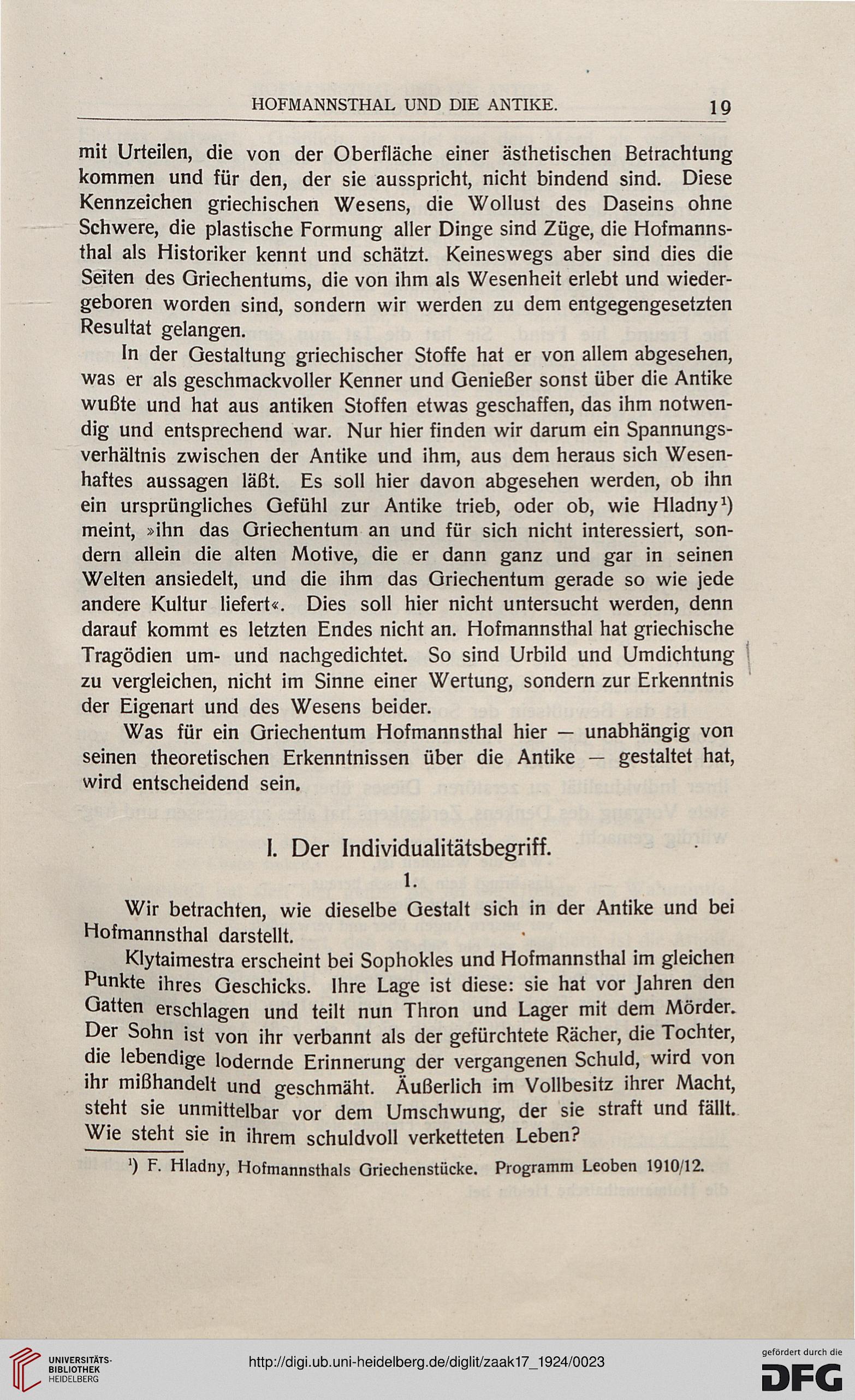HOFMANNSTHAL UND DIE ANTIKE. 1 g
mit Urteilen, die von der Oberfläche einer ästhetischen Betrachtung
kommen und für den, der sie ausspricht, nicht bindend sind. Diese
Kennzeichen griechischen Wesens, die Wollust des Daseins ohne
Schwere, die plastische Formung aller Dinge sind Züge, die Hofmanns-
thal als Historiker kennt und schätzt. Keineswegs aber sind dies die
Seiten des Griechentums, die von ihm als Wesenheit erlebt und wieder-
geboren worden sind, sondern wir werden zu dem entgegengesetzten
Resultat gelangen.
In der Gestaltung griechischer Stoffe hat er von allem abgesehen,
was er als geschmackvoller Kenner und Genießer sonst über die Antike
wußte und hat aus antiken Stoffen etwas geschaffen, das ihm notwen-
dig und entsprechend war. Nur hier finden wir darum ein Spannungs-
verhältnis zwischen der Antike und ihm, aus dem heraus sich Wesen-
haftes aussagen läßt. Es soll hier davon abgesehen werden, ob ihn
ein ursprüngliches Gefühl zur Antike trieb, oder ob, wie Hladny1)
meint, »ihn das Griechentum an und für sich nicht interessiert, son-
dern allein die alten Motive, die er dann ganz und gar in seinen
Welten ansiedelt, und die ihm das Griechentum gerade so wie jede
andere Kultur liefert«. Dies soll hier nicht untersucht werden, denn
darauf kommt es letzten Endes nicht an. Hofmannsthal hat griechische
Tragödien um- und nachgedichtet. So sind Urbild und Umdichtung
zu vergleichen, nicht im Sinne einer Wertung, sondern zur Erkenntnis
der Eigenart und des Wesens beider.
Was für ein Griechentum Hofmannsthal hier — unabhängig von
seinen theoretischen Erkenntnissen über die Antike — gestaltet hat,
wird entscheidend sein.
I. Der Individualitätsbegriff.
1.
Wir betrachten, wie dieselbe Gestalt sich in der Antike und bei
Hofmannsthal darstellt.
Klytaimestra erscheint bei Sophokles und Hofmannsthal im gleichen
Punkte ihres Geschicks. Ihre Lage ist diese: sie hat vor Jahren den
Gatten erschlagen und teilt nun Thron und Lager mit dem Mörder.
Der Sohn ist von ihr verbannt als der gefürchtete Rächer, die Tochter,
die lebendige lodernde Erinnerung der vergangenen Schuld, wird von
ihr mißhandelt und geschmäht. Äußerlich im Vollbesitz ihrer Macht,
steht sie unmittelbar vor dem Umschwung, der sie straft und fällt.
Wie steht sie in ihrem schuldvoll verketteten Leben?
') F. Hladny, Hofmannsthals Griechenstücke. Programm Leoben 1910/12.
mit Urteilen, die von der Oberfläche einer ästhetischen Betrachtung
kommen und für den, der sie ausspricht, nicht bindend sind. Diese
Kennzeichen griechischen Wesens, die Wollust des Daseins ohne
Schwere, die plastische Formung aller Dinge sind Züge, die Hofmanns-
thal als Historiker kennt und schätzt. Keineswegs aber sind dies die
Seiten des Griechentums, die von ihm als Wesenheit erlebt und wieder-
geboren worden sind, sondern wir werden zu dem entgegengesetzten
Resultat gelangen.
In der Gestaltung griechischer Stoffe hat er von allem abgesehen,
was er als geschmackvoller Kenner und Genießer sonst über die Antike
wußte und hat aus antiken Stoffen etwas geschaffen, das ihm notwen-
dig und entsprechend war. Nur hier finden wir darum ein Spannungs-
verhältnis zwischen der Antike und ihm, aus dem heraus sich Wesen-
haftes aussagen läßt. Es soll hier davon abgesehen werden, ob ihn
ein ursprüngliches Gefühl zur Antike trieb, oder ob, wie Hladny1)
meint, »ihn das Griechentum an und für sich nicht interessiert, son-
dern allein die alten Motive, die er dann ganz und gar in seinen
Welten ansiedelt, und die ihm das Griechentum gerade so wie jede
andere Kultur liefert«. Dies soll hier nicht untersucht werden, denn
darauf kommt es letzten Endes nicht an. Hofmannsthal hat griechische
Tragödien um- und nachgedichtet. So sind Urbild und Umdichtung
zu vergleichen, nicht im Sinne einer Wertung, sondern zur Erkenntnis
der Eigenart und des Wesens beider.
Was für ein Griechentum Hofmannsthal hier — unabhängig von
seinen theoretischen Erkenntnissen über die Antike — gestaltet hat,
wird entscheidend sein.
I. Der Individualitätsbegriff.
1.
Wir betrachten, wie dieselbe Gestalt sich in der Antike und bei
Hofmannsthal darstellt.
Klytaimestra erscheint bei Sophokles und Hofmannsthal im gleichen
Punkte ihres Geschicks. Ihre Lage ist diese: sie hat vor Jahren den
Gatten erschlagen und teilt nun Thron und Lager mit dem Mörder.
Der Sohn ist von ihr verbannt als der gefürchtete Rächer, die Tochter,
die lebendige lodernde Erinnerung der vergangenen Schuld, wird von
ihr mißhandelt und geschmäht. Äußerlich im Vollbesitz ihrer Macht,
steht sie unmittelbar vor dem Umschwung, der sie straft und fällt.
Wie steht sie in ihrem schuldvoll verketteten Leben?
') F. Hladny, Hofmannsthals Griechenstücke. Programm Leoben 1910/12.