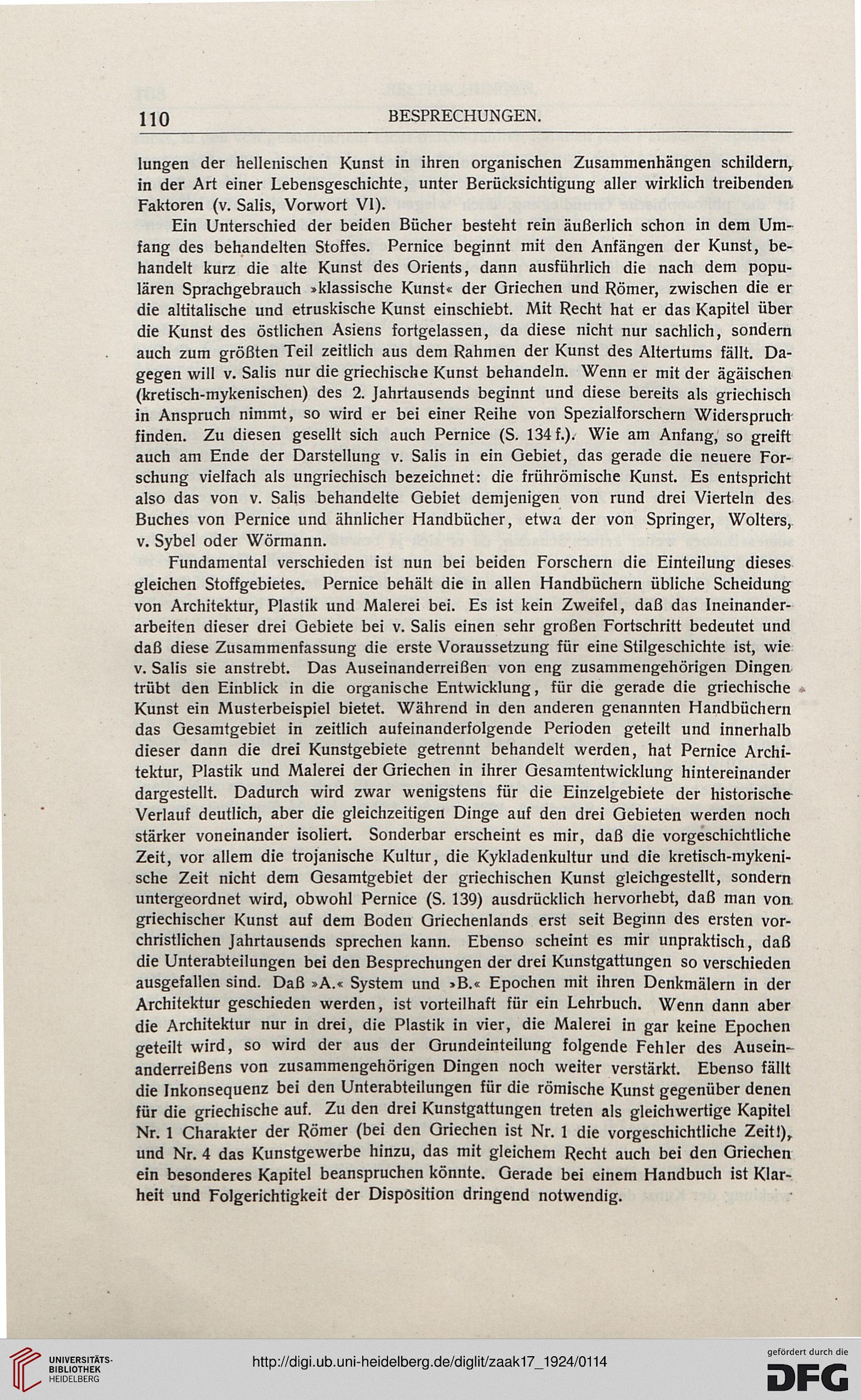110 BESPRECHUNGEN.
Iungen der hellenischen Kunst in ihren organischen Zusammenhängen schildern,
in der Art einer Lebensgeschichte, unter Berücksichtigung aller wirklich treibenden
Faktoren (v. Salis, Vorwort VI).
Ein Unterschied der beiden Bücher besteht rein äußerlich schon in dem Um-
fang des behandelten Stoffes. Pernice beginnt mit den Anfängen der Kunst, be-
handelt kurz die alte Kunst des Orients, dann ausführlich die nach dem popu-
lären Sprachgebrauch »klassische Kunst« der Griechen und Römer, zwischen die er
die altitalische und etruskische Kunst einschiebt. Mit Recht hat er das Kapitel über
die Kunst des östlichen Asiens fortgelassen, da diese nicht nur sachlich, sondern
auch zum größten Teil zeitlich aus dem Rahmen der Kunst des Altertums fällt. Da-
gegen will v. Salis nur die griechische Kunst behandeln. Wenn er mit der ägäischen
(kretisch-mykenischen) des 2. Jahrtausends beginnt und diese bereits als griechisch
in Anspruch nimmt, so wird er bei einer Reihe von Spezialforschern Widerspruch
finden. Zu diesen gesellt sich auch Pernice (S. 134 f.). Wie am Anfang, so greift
auch am Ende der Darstellung v. Salis in ein Gebiet, das gerade die neuere For-
schung vielfach als ungriechisch bezeichnet: die frührömische Kunst. Es entspricht
also das von v. Salis behandelte Gebiet demjenigen von rund drei Vierteln des
Buches von Pernice und ähnlicher Handbücher, etwa der von Springer, Wolters,
v. Sybel oder Wörmann.
Fundamental verschieden ist nun bei beiden Forschern die Einteilung dieses
gleichen Stoffgebietes. Pernice behält die in allen Handbüchern übliche Scheidung
von Architektur, Plastik und Malerei bei. Es ist kein Zweifel, daß das Ineinander-
arbeiten dieser drei Gebiete bei v. Salis einen sehr großen Fortschritt bedeutet und
daß diese Zusammenfassung die erste Voraussetzung für eine Stilgeschichte ist, wie
v. Salis sie anstrebt. Das Auseinanderreißen von eng zusammengehörigen Dingen
trübt den Einblick in die organische Entwicklung, für die gerade die griechische
Kunst ein Musterbeispiel bietet. Während in den anderen genannten Handbüchern
das Gesamtgebiet in zeitlich aufeinanderfolgende Perioden geteilt und innerhalb
dieser dann die drei Kunstgebiete getrennt behandelt werden, hat Pernice Archi-
tektur, Plastik und Malerei der Griechen in ihrer Gesamtentwicklung hintereinander
dargestellt. Dadurch wird zwar wenigstens für die Einzelgebiete der historische
Verlauf deutlich, aber die gleichzeitigen Dinge auf den drei Gebieten werden noch
stärker voneinander isoliert. Sonderbar erscheint es mir, daß die vorgeschichtliche
Zeit, vor allem die trojanische Kultur, die Kykladenkultur und die kretisch-mykeni-
sche Zeit nicht dem Gesamtgebiet der griechischen Kunst gleichgestellt, sondern
untergeordnet wird, obwohl Pernice (S. 139) ausdrücklich hervorhebt, daß man von.
griechischer Kunst auf dem Boden Griechenlands erst seit Beginn des ersten vor-
christlichen Jahrtausends sprechen kann. Ebenso scheint es mir unpraktisch, daß
die Unterabteilungen bei den Besprechungen der drei Kunstgattungen so verschieden
ausgefallen sind. Daß »A.« System und »B.« Epochen mit ihren Denkmälern in der
Architektur geschieden werden, ist vorteilhaft für ein Lehrbuch. Wenn dann aber
die Architektur nur in drei, die Plastik in vier, die Malerei in gar keine Epochen
geteilt wird, so wird der aus der Grundeinteilung folgende Fehler des Ausein-
anderreißens von zusammengehörigen Dingen noch weiter verstärkt. Ebenso fällt
die Inkonsequenz bei den Unterabteilungen für die römische Kunst gegenüber denen
für die griechische auf. Zu den drei Kunstgattungen treten als gleichwertige Kapitel
Nr. 1 Charakter der Römer (bei den Griechen ist Nr. 1 die vorgeschichtliche Zeit!),
und Nr. 4 das Kunstgewerbe hinzu, das mit gleichem Recht auch bei den Griechen
ein besonderes Kapitel beanspruchen könnte. Gerade bei einem Handbuch ist Klar-
heit und Folgerichtigkeit der Disposition dringend notwendig.
Iungen der hellenischen Kunst in ihren organischen Zusammenhängen schildern,
in der Art einer Lebensgeschichte, unter Berücksichtigung aller wirklich treibenden
Faktoren (v. Salis, Vorwort VI).
Ein Unterschied der beiden Bücher besteht rein äußerlich schon in dem Um-
fang des behandelten Stoffes. Pernice beginnt mit den Anfängen der Kunst, be-
handelt kurz die alte Kunst des Orients, dann ausführlich die nach dem popu-
lären Sprachgebrauch »klassische Kunst« der Griechen und Römer, zwischen die er
die altitalische und etruskische Kunst einschiebt. Mit Recht hat er das Kapitel über
die Kunst des östlichen Asiens fortgelassen, da diese nicht nur sachlich, sondern
auch zum größten Teil zeitlich aus dem Rahmen der Kunst des Altertums fällt. Da-
gegen will v. Salis nur die griechische Kunst behandeln. Wenn er mit der ägäischen
(kretisch-mykenischen) des 2. Jahrtausends beginnt und diese bereits als griechisch
in Anspruch nimmt, so wird er bei einer Reihe von Spezialforschern Widerspruch
finden. Zu diesen gesellt sich auch Pernice (S. 134 f.). Wie am Anfang, so greift
auch am Ende der Darstellung v. Salis in ein Gebiet, das gerade die neuere For-
schung vielfach als ungriechisch bezeichnet: die frührömische Kunst. Es entspricht
also das von v. Salis behandelte Gebiet demjenigen von rund drei Vierteln des
Buches von Pernice und ähnlicher Handbücher, etwa der von Springer, Wolters,
v. Sybel oder Wörmann.
Fundamental verschieden ist nun bei beiden Forschern die Einteilung dieses
gleichen Stoffgebietes. Pernice behält die in allen Handbüchern übliche Scheidung
von Architektur, Plastik und Malerei bei. Es ist kein Zweifel, daß das Ineinander-
arbeiten dieser drei Gebiete bei v. Salis einen sehr großen Fortschritt bedeutet und
daß diese Zusammenfassung die erste Voraussetzung für eine Stilgeschichte ist, wie
v. Salis sie anstrebt. Das Auseinanderreißen von eng zusammengehörigen Dingen
trübt den Einblick in die organische Entwicklung, für die gerade die griechische
Kunst ein Musterbeispiel bietet. Während in den anderen genannten Handbüchern
das Gesamtgebiet in zeitlich aufeinanderfolgende Perioden geteilt und innerhalb
dieser dann die drei Kunstgebiete getrennt behandelt werden, hat Pernice Archi-
tektur, Plastik und Malerei der Griechen in ihrer Gesamtentwicklung hintereinander
dargestellt. Dadurch wird zwar wenigstens für die Einzelgebiete der historische
Verlauf deutlich, aber die gleichzeitigen Dinge auf den drei Gebieten werden noch
stärker voneinander isoliert. Sonderbar erscheint es mir, daß die vorgeschichtliche
Zeit, vor allem die trojanische Kultur, die Kykladenkultur und die kretisch-mykeni-
sche Zeit nicht dem Gesamtgebiet der griechischen Kunst gleichgestellt, sondern
untergeordnet wird, obwohl Pernice (S. 139) ausdrücklich hervorhebt, daß man von.
griechischer Kunst auf dem Boden Griechenlands erst seit Beginn des ersten vor-
christlichen Jahrtausends sprechen kann. Ebenso scheint es mir unpraktisch, daß
die Unterabteilungen bei den Besprechungen der drei Kunstgattungen so verschieden
ausgefallen sind. Daß »A.« System und »B.« Epochen mit ihren Denkmälern in der
Architektur geschieden werden, ist vorteilhaft für ein Lehrbuch. Wenn dann aber
die Architektur nur in drei, die Plastik in vier, die Malerei in gar keine Epochen
geteilt wird, so wird der aus der Grundeinteilung folgende Fehler des Ausein-
anderreißens von zusammengehörigen Dingen noch weiter verstärkt. Ebenso fällt
die Inkonsequenz bei den Unterabteilungen für die römische Kunst gegenüber denen
für die griechische auf. Zu den drei Kunstgattungen treten als gleichwertige Kapitel
Nr. 1 Charakter der Römer (bei den Griechen ist Nr. 1 die vorgeschichtliche Zeit!),
und Nr. 4 das Kunstgewerbe hinzu, das mit gleichem Recht auch bei den Griechen
ein besonderes Kapitel beanspruchen könnte. Gerade bei einem Handbuch ist Klar-
heit und Folgerichtigkeit der Disposition dringend notwendig.