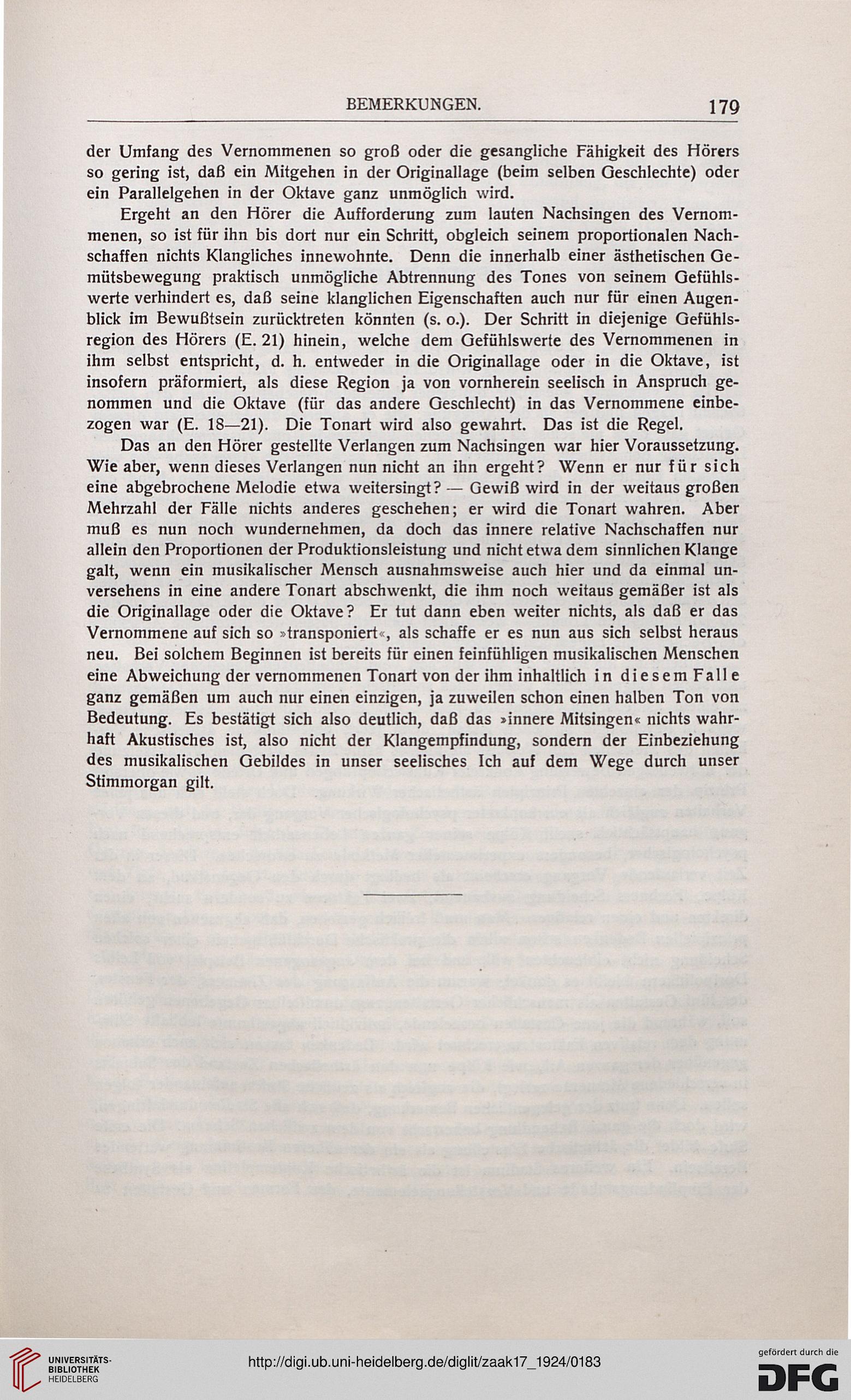BEMERKUNGEN. 179
der Umfang des Vernommenen so groß oder die gesangliche Fähigkeit des Hörers
so gering ist, daß ein Mitgehen in der Originallage (beim selben Geschlechte) oder
ein Parallelgehen in der Oktave ganz unmöglich wird.
Ergeht an den Hörer die Aufforderung zum lauten Nachsingen des Vernom-
menen, so ist für ihn bis dort nur ein Schritt, obgleich seinem proportionalen Nach-
schaffen nichts Klangliches innewohnte. Denn die innerhalb einer ästhetischen Ge-
mütsbewegung praktisch unmögliche Abtrennung des Tones von seinem Gefühls-
werte verhindert es, daß seine klanglichen Eigenschaften auch nur für einen Augen-
blick im Bewußtsein zurücktreten könnten (s. o.). Der Schritt in diejenige Gefühls-
region des Hörers (E. 21) hinein, welche dem Gefühlswerte des Vernommenen in
ihm selbst entspricht, d. h. entweder in die Originallage oder in die Oktave, ist
insofern präformiert, als diese Region ja von vornherein seelisch in Anspruch ge-
nommen und die Oktave (für das andere Geschlecht) in das Vernommene einbe-
zogen war (E. 18—21). Die Tonart wird also gewahrt. Das ist die Regel.
Das an den Hörer gestellte Verlangen zum Nachsingen war hier Voraussetzung.
Wie aber, wenn dieses Verlangen nun nicht an ihn ergeht? Wenn er nur für sich
eine abgebrochene Melodie etwa weitersingt? — Gewiß wird in der weitaus großen
Mehrzahl der Fälle nichts anderes geschehen; er wird die Tonart wahren. Aber
muß es nun noch wundernehmen, da doch das innere relative Nachschaffen nur
allein den Proportionen der Produktionsleistung und nicht etwa dem sinnlichen Klange
galt, wenn ein musikalischer Mensch ausnahmsweise auch hier und da einmal un-
versehens in eine andere Tonart abschwenkt, die ihm noch weitaus gemäßer ist als
die Originallage oder die Oktave? Er tut dann eben weiter nichts, als daß er das
Vernommene auf sich so »transponiert«, als schaffe er es nun aus sich selbst heraus
neu. Bei solchem Beginnen ist bereits für einen feinfühligen musikalischen Menschen
eine Abweichung der vernommenen Tonart von der ihm inhaltlich in diesemFalle
ganz gemäßen um auch nur einen einzigen, ja zuweilen schon einen halben Ton von
Bedeutung. Es bestätigt sich also deutlich, daß das »innere Mitsingen« nichts wahr-
haft Akustisches ist, also nicht der Klangempfindung, sondern der Einbeziehung
des musikalischen Gebildes in unser seelisches Ich auf dem Wege durch unser
Stimmorgan gilt.
der Umfang des Vernommenen so groß oder die gesangliche Fähigkeit des Hörers
so gering ist, daß ein Mitgehen in der Originallage (beim selben Geschlechte) oder
ein Parallelgehen in der Oktave ganz unmöglich wird.
Ergeht an den Hörer die Aufforderung zum lauten Nachsingen des Vernom-
menen, so ist für ihn bis dort nur ein Schritt, obgleich seinem proportionalen Nach-
schaffen nichts Klangliches innewohnte. Denn die innerhalb einer ästhetischen Ge-
mütsbewegung praktisch unmögliche Abtrennung des Tones von seinem Gefühls-
werte verhindert es, daß seine klanglichen Eigenschaften auch nur für einen Augen-
blick im Bewußtsein zurücktreten könnten (s. o.). Der Schritt in diejenige Gefühls-
region des Hörers (E. 21) hinein, welche dem Gefühlswerte des Vernommenen in
ihm selbst entspricht, d. h. entweder in die Originallage oder in die Oktave, ist
insofern präformiert, als diese Region ja von vornherein seelisch in Anspruch ge-
nommen und die Oktave (für das andere Geschlecht) in das Vernommene einbe-
zogen war (E. 18—21). Die Tonart wird also gewahrt. Das ist die Regel.
Das an den Hörer gestellte Verlangen zum Nachsingen war hier Voraussetzung.
Wie aber, wenn dieses Verlangen nun nicht an ihn ergeht? Wenn er nur für sich
eine abgebrochene Melodie etwa weitersingt? — Gewiß wird in der weitaus großen
Mehrzahl der Fälle nichts anderes geschehen; er wird die Tonart wahren. Aber
muß es nun noch wundernehmen, da doch das innere relative Nachschaffen nur
allein den Proportionen der Produktionsleistung und nicht etwa dem sinnlichen Klange
galt, wenn ein musikalischer Mensch ausnahmsweise auch hier und da einmal un-
versehens in eine andere Tonart abschwenkt, die ihm noch weitaus gemäßer ist als
die Originallage oder die Oktave? Er tut dann eben weiter nichts, als daß er das
Vernommene auf sich so »transponiert«, als schaffe er es nun aus sich selbst heraus
neu. Bei solchem Beginnen ist bereits für einen feinfühligen musikalischen Menschen
eine Abweichung der vernommenen Tonart von der ihm inhaltlich in diesemFalle
ganz gemäßen um auch nur einen einzigen, ja zuweilen schon einen halben Ton von
Bedeutung. Es bestätigt sich also deutlich, daß das »innere Mitsingen« nichts wahr-
haft Akustisches ist, also nicht der Klangempfindung, sondern der Einbeziehung
des musikalischen Gebildes in unser seelisches Ich auf dem Wege durch unser
Stimmorgan gilt.