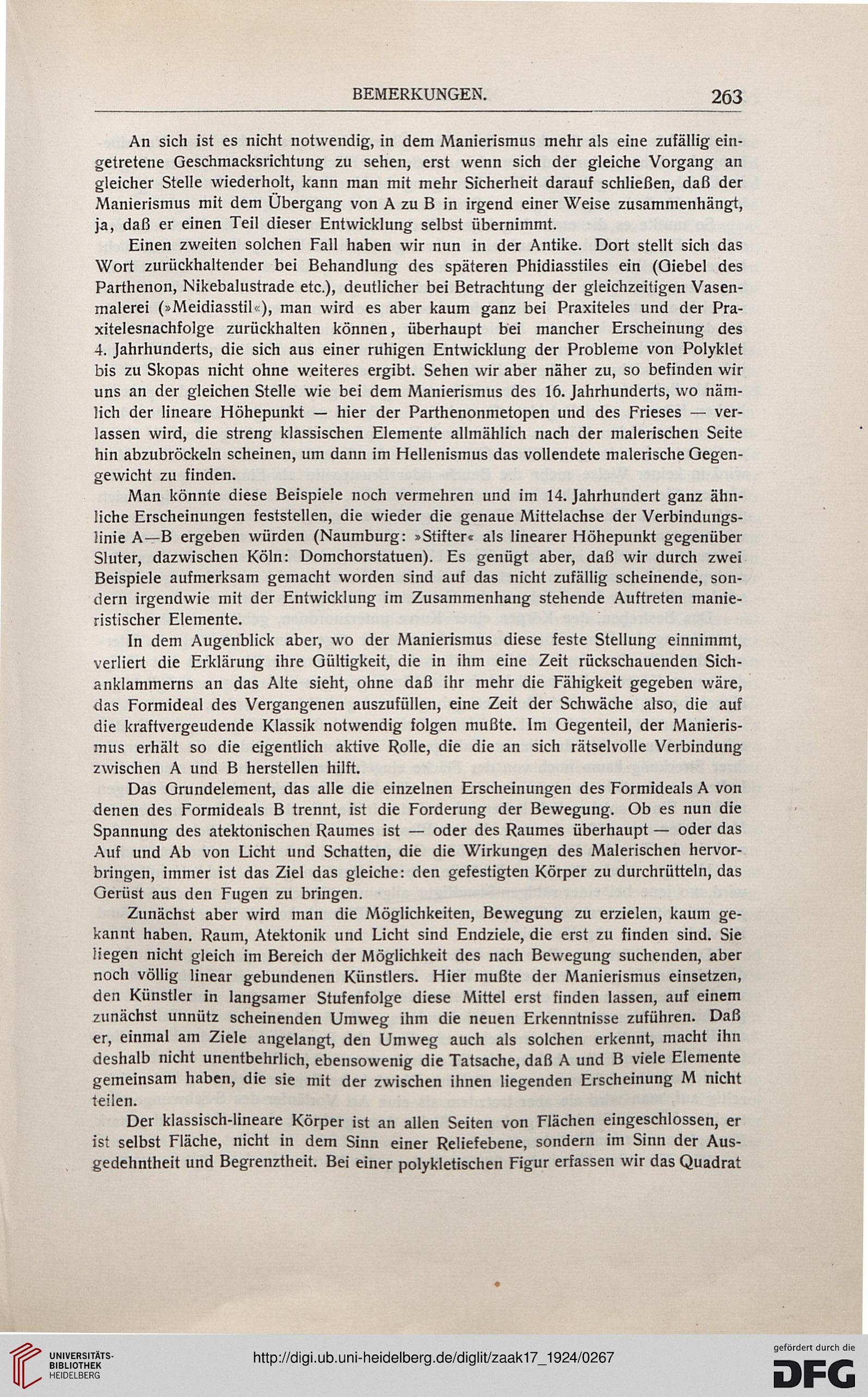BEMERKUNGEN. 263
An sich ist es nicht notwendig, in dem Manierismus mehr als eine zufällig ein-
getretene Geschmacksrichtung zu sehen, erst wenn sich der gleiche Vorgang an
gleicher Stelle wiederholt, kann man mit mehr Sicherheit darauf schließen, daß der
Manierismus mit dem Übergang von A zu B in irgend einer Weise zusammenhängt,
ja, daß er einen Teil dieser Entwicklung selbst übernimmt.
Einen zweiten solchen Fall haben wir nun in der Antike. Dort stellt sich das
Wort zurückhaltender bei Behandlung des späteren Phidiasstiles ein (Oiebel des
Parthenon, Nikebalustrade etc.), deutlicher bei Betrachtung der gleichzeitigen Vasen-
malerei (»Meidiasstil«), man wird es aber kaum ganz bei Praxiteles und der Pra-
xitelesnachfolge zurückhalten können, überhaupt bei mancher Erscheinung des
4. Jahrhunderts, die sich aus einer ruhigen Entwicklung der Probleme von Polyklet
bis zu Skopas nicht ohne weiteres ergibt. Sehen wir aber näher zu, so befinden wir
uns an der gleichen Stelle wie bei dem Manierismus des 16. Jahrhunderts, wo näm-
lich der lineare Höhepunkt — hier der Parthenonmetopen und des Frieses — ver-
lassen wird, die streng klassischen Elemente allmählich nach der malerischen Seite
hin abzubröckeln scheinen, um dann im Hellenismus das vollendete malerische Gegen-
gewicht zu finden.
Man könnte diese Beispiele noch vermehren und im 14. Jahrhundert ganz ähn-
liche Erscheinungen feststellen, die wieder die genaue Mittelachse der Verbindungs-
linie A—B ergeben würden (Naumburg: »Stifter« als linearer Höhepunkt gegenüber
Sluter, dazwischen Köln: Domchorstatuen). Es genügt aber, daß wir durch zwei
Beispiele aufmerksam gemacht worden sind auf das nicht zufällig scheinende, son-
dern irgendwie mit der Entwicklung im Zusammenhang stehende Auftreten manie-
ristischer Elemente.
In dem Augenblick aber, wo der Manierismus diese feste Stellung einnimmt,
verliert die Erklärung ihre Gültigkeit, die in ihm eine Zeit rückschauenden Sich-
anklammerns an das Alte sieht, ohne daß ihr mehr die Fähigkeit gegeben wäre,
das Formideal des Vergangenen auszufüllen, eine Zeit der Schwäche also, die auf
die kraftvergeudende Klassik notwendig folgen mußte. Im Gegenteil, der Manieris-
mus erhält so die eigentlich aktive Rolle, die die an sich rätselvolle Verbindung
zwischen A und B herstellen hilft.
Das Grundelement, das alle die einzelnen Erscheinungen des Formideals A von
denen des Formideals B trennt, ist die Forderung der Bewegung. Ob es nun die
Spannung des atektonischen Raumes ist — oder des Raumes überhaupt — oder das
Auf und Ab von Licht und Schatten, die die Wirkungen des Malerischen hervor-
bringen, immer ist das Ziel das gleiche: den gefestigten Körper zu durchrütteln, das
Gerüst aus den Fugen zu bringen.
Zunächst aber wird man die Möglichkeiten, Bewegung zu erzielen, kaum ge-
kannt haben. Raum, Atektonik und Licht sind Endziele, die erst zu finden sind. Sie
liegen nicht gleich im Bereich der Möglichkeit des nach Bewegung suchenden, aber
noch völlig linear gebundenen Künstlers. Hier mußte der Manierismus einsetzen,
den Künstler in langsamer Stufenfolge diese Mittel erst finden lassen, auf einem
zunächst unnütz scheinenden Umweg ihm die neuen Erkenntnisse zuführen. Daß
er, einmal am Ziele angelangt, den Umweg auch als solchen erkennt, macht ihn
deshalb nicht unentbehrlich, ebensowenig die Tatsache, daß A und B viele Elemente
gemeinsam haben, die sie mit der zwischen ihnen liegenden Erscheinung M nicht
teilen.
Der klassisch-lineare Körper ist an allen Seiten von Flächen eingeschlossen, er
ist selbst Fläche, nicht in dem Sinn einer Reliefebene, sondern im Sinn der Aus-
gedehntheit und Begrenztheit. Bei einer polykletischen Figur erfassen wir das Quadrat
An sich ist es nicht notwendig, in dem Manierismus mehr als eine zufällig ein-
getretene Geschmacksrichtung zu sehen, erst wenn sich der gleiche Vorgang an
gleicher Stelle wiederholt, kann man mit mehr Sicherheit darauf schließen, daß der
Manierismus mit dem Übergang von A zu B in irgend einer Weise zusammenhängt,
ja, daß er einen Teil dieser Entwicklung selbst übernimmt.
Einen zweiten solchen Fall haben wir nun in der Antike. Dort stellt sich das
Wort zurückhaltender bei Behandlung des späteren Phidiasstiles ein (Oiebel des
Parthenon, Nikebalustrade etc.), deutlicher bei Betrachtung der gleichzeitigen Vasen-
malerei (»Meidiasstil«), man wird es aber kaum ganz bei Praxiteles und der Pra-
xitelesnachfolge zurückhalten können, überhaupt bei mancher Erscheinung des
4. Jahrhunderts, die sich aus einer ruhigen Entwicklung der Probleme von Polyklet
bis zu Skopas nicht ohne weiteres ergibt. Sehen wir aber näher zu, so befinden wir
uns an der gleichen Stelle wie bei dem Manierismus des 16. Jahrhunderts, wo näm-
lich der lineare Höhepunkt — hier der Parthenonmetopen und des Frieses — ver-
lassen wird, die streng klassischen Elemente allmählich nach der malerischen Seite
hin abzubröckeln scheinen, um dann im Hellenismus das vollendete malerische Gegen-
gewicht zu finden.
Man könnte diese Beispiele noch vermehren und im 14. Jahrhundert ganz ähn-
liche Erscheinungen feststellen, die wieder die genaue Mittelachse der Verbindungs-
linie A—B ergeben würden (Naumburg: »Stifter« als linearer Höhepunkt gegenüber
Sluter, dazwischen Köln: Domchorstatuen). Es genügt aber, daß wir durch zwei
Beispiele aufmerksam gemacht worden sind auf das nicht zufällig scheinende, son-
dern irgendwie mit der Entwicklung im Zusammenhang stehende Auftreten manie-
ristischer Elemente.
In dem Augenblick aber, wo der Manierismus diese feste Stellung einnimmt,
verliert die Erklärung ihre Gültigkeit, die in ihm eine Zeit rückschauenden Sich-
anklammerns an das Alte sieht, ohne daß ihr mehr die Fähigkeit gegeben wäre,
das Formideal des Vergangenen auszufüllen, eine Zeit der Schwäche also, die auf
die kraftvergeudende Klassik notwendig folgen mußte. Im Gegenteil, der Manieris-
mus erhält so die eigentlich aktive Rolle, die die an sich rätselvolle Verbindung
zwischen A und B herstellen hilft.
Das Grundelement, das alle die einzelnen Erscheinungen des Formideals A von
denen des Formideals B trennt, ist die Forderung der Bewegung. Ob es nun die
Spannung des atektonischen Raumes ist — oder des Raumes überhaupt — oder das
Auf und Ab von Licht und Schatten, die die Wirkungen des Malerischen hervor-
bringen, immer ist das Ziel das gleiche: den gefestigten Körper zu durchrütteln, das
Gerüst aus den Fugen zu bringen.
Zunächst aber wird man die Möglichkeiten, Bewegung zu erzielen, kaum ge-
kannt haben. Raum, Atektonik und Licht sind Endziele, die erst zu finden sind. Sie
liegen nicht gleich im Bereich der Möglichkeit des nach Bewegung suchenden, aber
noch völlig linear gebundenen Künstlers. Hier mußte der Manierismus einsetzen,
den Künstler in langsamer Stufenfolge diese Mittel erst finden lassen, auf einem
zunächst unnütz scheinenden Umweg ihm die neuen Erkenntnisse zuführen. Daß
er, einmal am Ziele angelangt, den Umweg auch als solchen erkennt, macht ihn
deshalb nicht unentbehrlich, ebensowenig die Tatsache, daß A und B viele Elemente
gemeinsam haben, die sie mit der zwischen ihnen liegenden Erscheinung M nicht
teilen.
Der klassisch-lineare Körper ist an allen Seiten von Flächen eingeschlossen, er
ist selbst Fläche, nicht in dem Sinn einer Reliefebene, sondern im Sinn der Aus-
gedehntheit und Begrenztheit. Bei einer polykletischen Figur erfassen wir das Quadrat