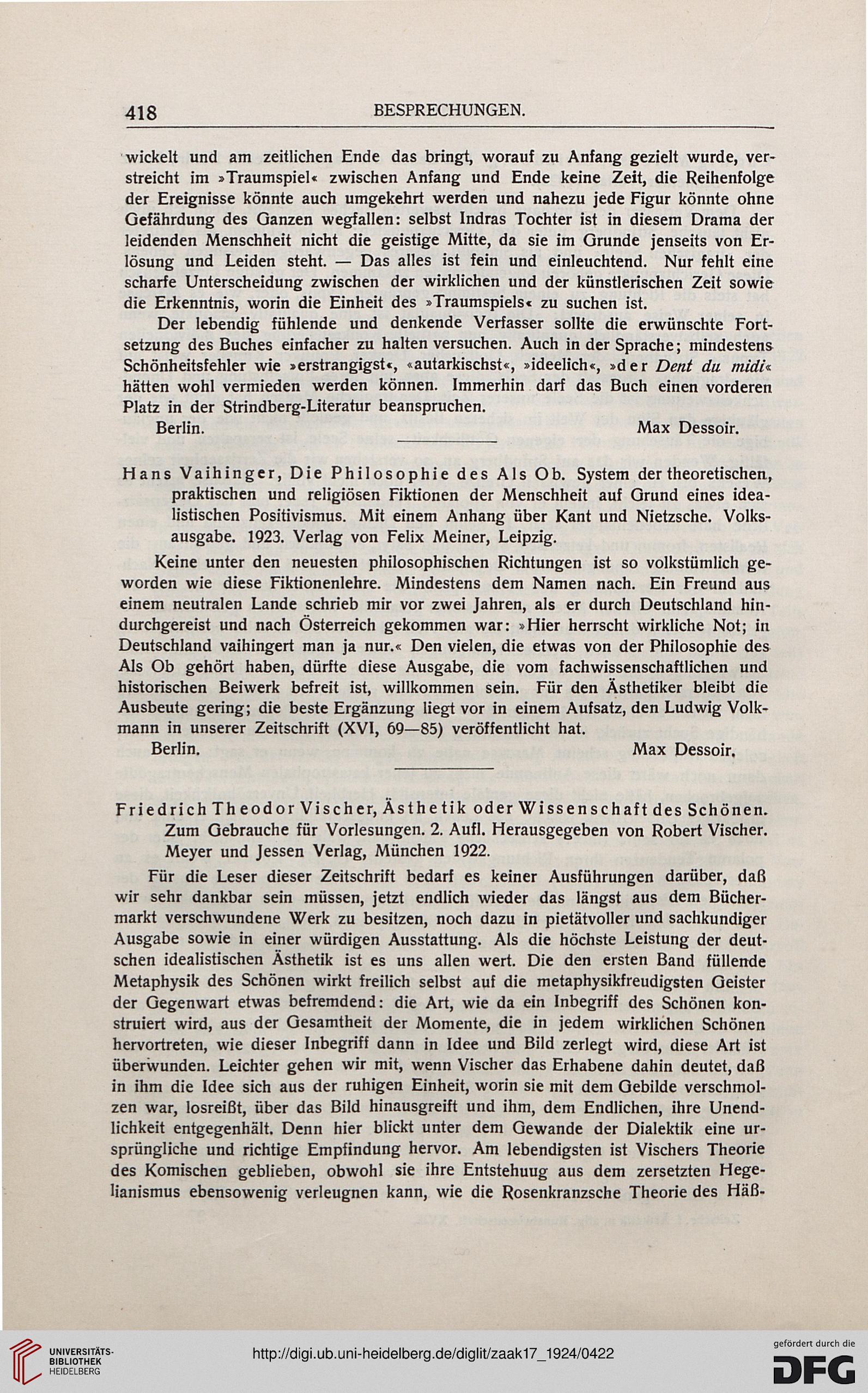418 BESPRECHUNGEN.
wickelt und am zeitlichen Ende das bringt, worauf zu Anfang gezielt wurde, ver-
streicht im »Traumspiel« zwischen Anfang und Ende keine Zeit, die Reihenfolge
der Ereignisse könnte auch umgekehrt werden und nahezu jede Figur könnte ohne
Gefährdung des Ganzen wegfallen: selbst Indras Tochter ist in diesem Drama der
leidenden Menschheit nicht die geistige Mitte, da sie im Grunde jenseits von Er-
lösung und Leiden steht. — Das alles ist fein und einleuchtend. Nur fehlt eine
scharfe Unterscheidung zwischen der wirklichen und der künstlerischen Zeit sowie
die Erkenntnis, worin die Einheit des »Traumspiels« zu suchen ist.
Der lebendig fühlende und denkende Verfasser sollte die erwünschte Fort-
setzung des Buches einfacher zu halten versuchen. Auch in der Sprache; mindestens
Schönheitsfehler wie »erstrangigst«, «autarkischst«, »ideelich«, »der Dent da midi«.
hätten wohl vermieden werden können. Immerhin darf das Buch einen vorderen
Platz in der Strindberg-Literatur beanspruchen.
Berlin. Max Dessoir.
Hans Vaihinger, Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen,
praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idea-
listischen Positivismus. Mit einem Anhang über Kant und Nietzsche. Volks-
ausgabe. 1923. Verlag von Felix Meiner, Leipzig.
Keine unter den neuesten philosophischen Richtungen ist so volkstümlich ge-
worden wie diese Fiktionenlehre. Mindestens dem Namen nach. Ein Freund aus
einem neutralen Lande schrieb mir vor zwei Jahren, als er durch Deutschland hin-
durchgereist und nach Österreich gekommen war: »Hier herrscht wirkliche Not; in
Deutschland vaihingert man ja nur.« Den vielen, die etwas von der Philosophie des
Als Ob gehört haben, dürfte diese Ausgabe, die vom fachwissenschaftlichen und
historischen Beiwerk befreit ist, willkommen sein. Für den Ästhetiker bleibt die
Ausbeute gering; die beste Ergänzung liegt vor in einem Aufsatz, den Ludwig Volk-
mann in unserer Zeitschrift (XVI, 69—85) veröffentlicht hat.
Berlin. Max Dessoir.
Friedrich Theodor Vischer, Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen.
Zum Gebrauche für Vorlesungen. 2. Aufl. Herausgegeben von Robert Vischer.
Meyer und Jessen Verlag, München 1922.
Für die Leser dieser Zeitschrift bedarf es keiner Ausführungen darüber, daß
wir sehr dankbar sein müssen, jetzt endlich wieder das längst aus dem Bücher-
markt verschwundene Werk zu besitzen, noch dazu in pietätvoller und sachkundiger
Ausgabe sowie in einer würdigen Ausstattung. Als die höchste Leistung der deut-
schen idealistischen Ästhetik ist es uns allen wert. Die den ersten Band füllende
Metaphysik des Schönen wirkt freilich selbst auf die metaphysikfreudigsten Geister
der Gegenwart etwas befremdend: die Art, wie da ein Inbegriff des Schönen kon-
struiert wird, aus der Gesamtheit der Momente, die in jedem wirklichen Schönen
hervortreten, wie dieser Inbegriff dann in Idee und Bild zerlegt wird, diese Art ist
überwunden. Leichter gehen wir mit, wenn Vischer das Erhabene dahin deutet, daß
in ihm die Idee sich aus der ruhigen Einheit, worin sie mit dem Gebilde verschmol-
zen war, losreißt, über das Bild hinausgreift und ihm, dem Endlichen, ihre Unend-
lichkeit entgegenhält. Denn hier blickt unter dem Gewände der Dialektik eine ur-
sprüngliche und richtige Empfindung hervor. Am lebendigsten ist Vischers Theorie
des Komischen geblieben, obwohl sie ihre Entstehuug aus dem zersetzten Hege-
lianismus ebensowenig verleugnen kann, wie die Rosenkranzsche Theorie des Haß-
wickelt und am zeitlichen Ende das bringt, worauf zu Anfang gezielt wurde, ver-
streicht im »Traumspiel« zwischen Anfang und Ende keine Zeit, die Reihenfolge
der Ereignisse könnte auch umgekehrt werden und nahezu jede Figur könnte ohne
Gefährdung des Ganzen wegfallen: selbst Indras Tochter ist in diesem Drama der
leidenden Menschheit nicht die geistige Mitte, da sie im Grunde jenseits von Er-
lösung und Leiden steht. — Das alles ist fein und einleuchtend. Nur fehlt eine
scharfe Unterscheidung zwischen der wirklichen und der künstlerischen Zeit sowie
die Erkenntnis, worin die Einheit des »Traumspiels« zu suchen ist.
Der lebendig fühlende und denkende Verfasser sollte die erwünschte Fort-
setzung des Buches einfacher zu halten versuchen. Auch in der Sprache; mindestens
Schönheitsfehler wie »erstrangigst«, «autarkischst«, »ideelich«, »der Dent da midi«.
hätten wohl vermieden werden können. Immerhin darf das Buch einen vorderen
Platz in der Strindberg-Literatur beanspruchen.
Berlin. Max Dessoir.
Hans Vaihinger, Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen,
praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idea-
listischen Positivismus. Mit einem Anhang über Kant und Nietzsche. Volks-
ausgabe. 1923. Verlag von Felix Meiner, Leipzig.
Keine unter den neuesten philosophischen Richtungen ist so volkstümlich ge-
worden wie diese Fiktionenlehre. Mindestens dem Namen nach. Ein Freund aus
einem neutralen Lande schrieb mir vor zwei Jahren, als er durch Deutschland hin-
durchgereist und nach Österreich gekommen war: »Hier herrscht wirkliche Not; in
Deutschland vaihingert man ja nur.« Den vielen, die etwas von der Philosophie des
Als Ob gehört haben, dürfte diese Ausgabe, die vom fachwissenschaftlichen und
historischen Beiwerk befreit ist, willkommen sein. Für den Ästhetiker bleibt die
Ausbeute gering; die beste Ergänzung liegt vor in einem Aufsatz, den Ludwig Volk-
mann in unserer Zeitschrift (XVI, 69—85) veröffentlicht hat.
Berlin. Max Dessoir.
Friedrich Theodor Vischer, Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen.
Zum Gebrauche für Vorlesungen. 2. Aufl. Herausgegeben von Robert Vischer.
Meyer und Jessen Verlag, München 1922.
Für die Leser dieser Zeitschrift bedarf es keiner Ausführungen darüber, daß
wir sehr dankbar sein müssen, jetzt endlich wieder das längst aus dem Bücher-
markt verschwundene Werk zu besitzen, noch dazu in pietätvoller und sachkundiger
Ausgabe sowie in einer würdigen Ausstattung. Als die höchste Leistung der deut-
schen idealistischen Ästhetik ist es uns allen wert. Die den ersten Band füllende
Metaphysik des Schönen wirkt freilich selbst auf die metaphysikfreudigsten Geister
der Gegenwart etwas befremdend: die Art, wie da ein Inbegriff des Schönen kon-
struiert wird, aus der Gesamtheit der Momente, die in jedem wirklichen Schönen
hervortreten, wie dieser Inbegriff dann in Idee und Bild zerlegt wird, diese Art ist
überwunden. Leichter gehen wir mit, wenn Vischer das Erhabene dahin deutet, daß
in ihm die Idee sich aus der ruhigen Einheit, worin sie mit dem Gebilde verschmol-
zen war, losreißt, über das Bild hinausgreift und ihm, dem Endlichen, ihre Unend-
lichkeit entgegenhält. Denn hier blickt unter dem Gewände der Dialektik eine ur-
sprüngliche und richtige Empfindung hervor. Am lebendigsten ist Vischers Theorie
des Komischen geblieben, obwohl sie ihre Entstehuug aus dem zersetzten Hege-
lianismus ebensowenig verleugnen kann, wie die Rosenkranzsche Theorie des Haß-