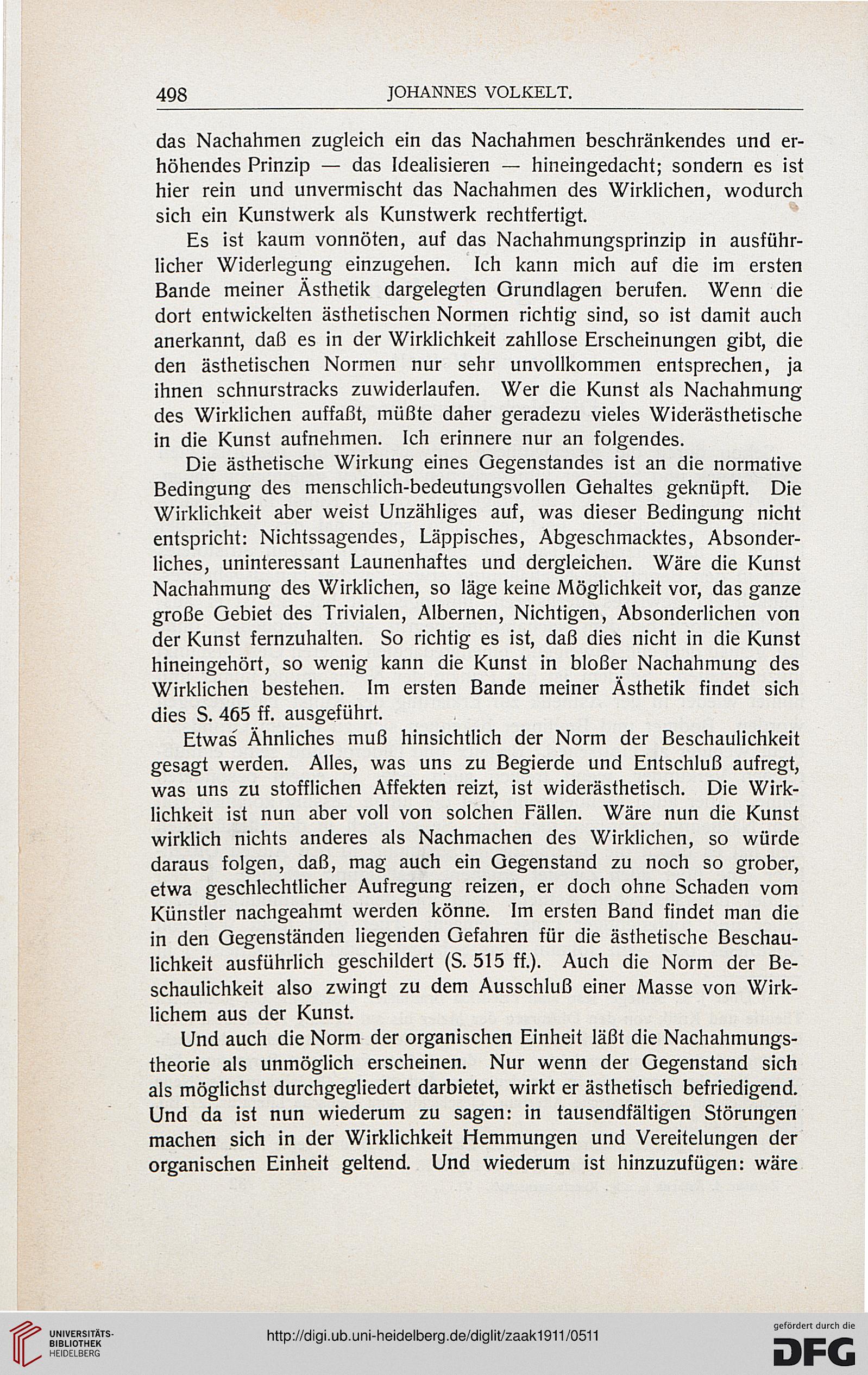498 JOHANNES VOLKELT.
das Nachahmen zugleich ein das Nachahmen beschränkendes und er-
höhendes Prinzip — das Idealisieren — hineingedacht; sondern es ist
hier rein und unvermischt das Nachahmen des Wirklichen, wodurch
sich ein Kunstwerk als Kunstwerk rechtfertigt.
Es ist kaum vonnöten, auf das Nachahmungsprinzip in ausführ-
licher Widerlegung einzugehen. Ich kann mich auf die im ersten
Bande meiner Ästhetik dargelegten Grundlagen berufen. Wenn die
dort entwickelten ästhetischen Normen richtig sind, so ist damit auch
anerkannt, daß es in der Wirklichkeit zahllose Erscheinungen gibt, die
den ästhetischen Normen nur sehr unvollkommen entsprechen, ja
ihnen schnurstracks zuwiderlaufen. Wer die Kunst als Nachahmung
des Wirklichen auffaßt, müßte daher geradezu vieles Widerästhetische
in die Kunst aufnehmen. Ich erinnere nur an folgendes.
Die ästhetische Wirkung eines Gegenstandes ist an die normative
Bedingung des menschlich-bedeutungsvollen Gehaltes geknüpft. Die
Wirklichkeit aber weist Unzähliges auf, was dieser Bedingung nicht
entspricht: Nichtssagendes, Läppisches, Abgeschmacktes, Absonder-
liches, uninteressant Launenhaftes und dergleichen. Wäre die Kunst
Nachahmung des Wirklichen, so läge keine Möglichkeit vor, das ganze
große Gebiet des Trivialen, Albernen, Nichtigen, Absonderlichen von
der Kunst fernzuhalten. So richtig es ist, daß dies nicht in die Kunst
hineingehört, so wenig kann die Kunst in bloßer Nachahmung des
Wirklichen bestehen. Im ersten Bande meiner Ästhetik findet sich
dies S. 465 ff. ausgeführt.
Etwas Ähnliches muß hinsichtlich der Norm der Beschaulichkeit
gesagt werden. Alles, was uns zu Begierde und Entschluß aufregt,
was uns zu stofflichen Affekten reizt, ist widerästhetisch. Die Wirk-
lichkeit ist nun aber voll von solchen Fällen. Wäre nun die Kunst
wirklich nichts anderes als Nachmachen des Wirklichen, so würde
daraus folgen, daß, mag auch ein Gegenstand zu noch so grober,
etwa geschlechtlicher Aufregung reizen, er doch ohne Schaden vom
Künstler nachgeahmt werden könne. Im ersten Band findet man die
in den Gegenständen liegenden Gefahren für die ästhetische Beschau-
lichkeit ausführlich geschildert (S. 515 ff.). Auch die Norm der Be-
schaulichkeit also zwingt zu dem Ausschluß einer Masse von Wirk-
lichem aus der Kunst.
Und auch die Norm der organischen Einheit läßt die Nachahmungs-
theorie als unmöglich erscheinen. Nur wenn der Gegenstand sich
als möglichst durchgegliedert darbietet, wirkt er ästhetisch befriedigend.
Und da ist nun wiederum zu sagen: in tausendfältigen Störungen
machen sich in der Wirklichkeit Hemmungen und Vereitelungen der
organischen Einheit geltend. Und wiederum ist hinzuzufügen: wäre
das Nachahmen zugleich ein das Nachahmen beschränkendes und er-
höhendes Prinzip — das Idealisieren — hineingedacht; sondern es ist
hier rein und unvermischt das Nachahmen des Wirklichen, wodurch
sich ein Kunstwerk als Kunstwerk rechtfertigt.
Es ist kaum vonnöten, auf das Nachahmungsprinzip in ausführ-
licher Widerlegung einzugehen. Ich kann mich auf die im ersten
Bande meiner Ästhetik dargelegten Grundlagen berufen. Wenn die
dort entwickelten ästhetischen Normen richtig sind, so ist damit auch
anerkannt, daß es in der Wirklichkeit zahllose Erscheinungen gibt, die
den ästhetischen Normen nur sehr unvollkommen entsprechen, ja
ihnen schnurstracks zuwiderlaufen. Wer die Kunst als Nachahmung
des Wirklichen auffaßt, müßte daher geradezu vieles Widerästhetische
in die Kunst aufnehmen. Ich erinnere nur an folgendes.
Die ästhetische Wirkung eines Gegenstandes ist an die normative
Bedingung des menschlich-bedeutungsvollen Gehaltes geknüpft. Die
Wirklichkeit aber weist Unzähliges auf, was dieser Bedingung nicht
entspricht: Nichtssagendes, Läppisches, Abgeschmacktes, Absonder-
liches, uninteressant Launenhaftes und dergleichen. Wäre die Kunst
Nachahmung des Wirklichen, so läge keine Möglichkeit vor, das ganze
große Gebiet des Trivialen, Albernen, Nichtigen, Absonderlichen von
der Kunst fernzuhalten. So richtig es ist, daß dies nicht in die Kunst
hineingehört, so wenig kann die Kunst in bloßer Nachahmung des
Wirklichen bestehen. Im ersten Bande meiner Ästhetik findet sich
dies S. 465 ff. ausgeführt.
Etwas Ähnliches muß hinsichtlich der Norm der Beschaulichkeit
gesagt werden. Alles, was uns zu Begierde und Entschluß aufregt,
was uns zu stofflichen Affekten reizt, ist widerästhetisch. Die Wirk-
lichkeit ist nun aber voll von solchen Fällen. Wäre nun die Kunst
wirklich nichts anderes als Nachmachen des Wirklichen, so würde
daraus folgen, daß, mag auch ein Gegenstand zu noch so grober,
etwa geschlechtlicher Aufregung reizen, er doch ohne Schaden vom
Künstler nachgeahmt werden könne. Im ersten Band findet man die
in den Gegenständen liegenden Gefahren für die ästhetische Beschau-
lichkeit ausführlich geschildert (S. 515 ff.). Auch die Norm der Be-
schaulichkeit also zwingt zu dem Ausschluß einer Masse von Wirk-
lichem aus der Kunst.
Und auch die Norm der organischen Einheit läßt die Nachahmungs-
theorie als unmöglich erscheinen. Nur wenn der Gegenstand sich
als möglichst durchgegliedert darbietet, wirkt er ästhetisch befriedigend.
Und da ist nun wiederum zu sagen: in tausendfältigen Störungen
machen sich in der Wirklichkeit Hemmungen und Vereitelungen der
organischen Einheit geltend. Und wiederum ist hinzuzufügen: wäre