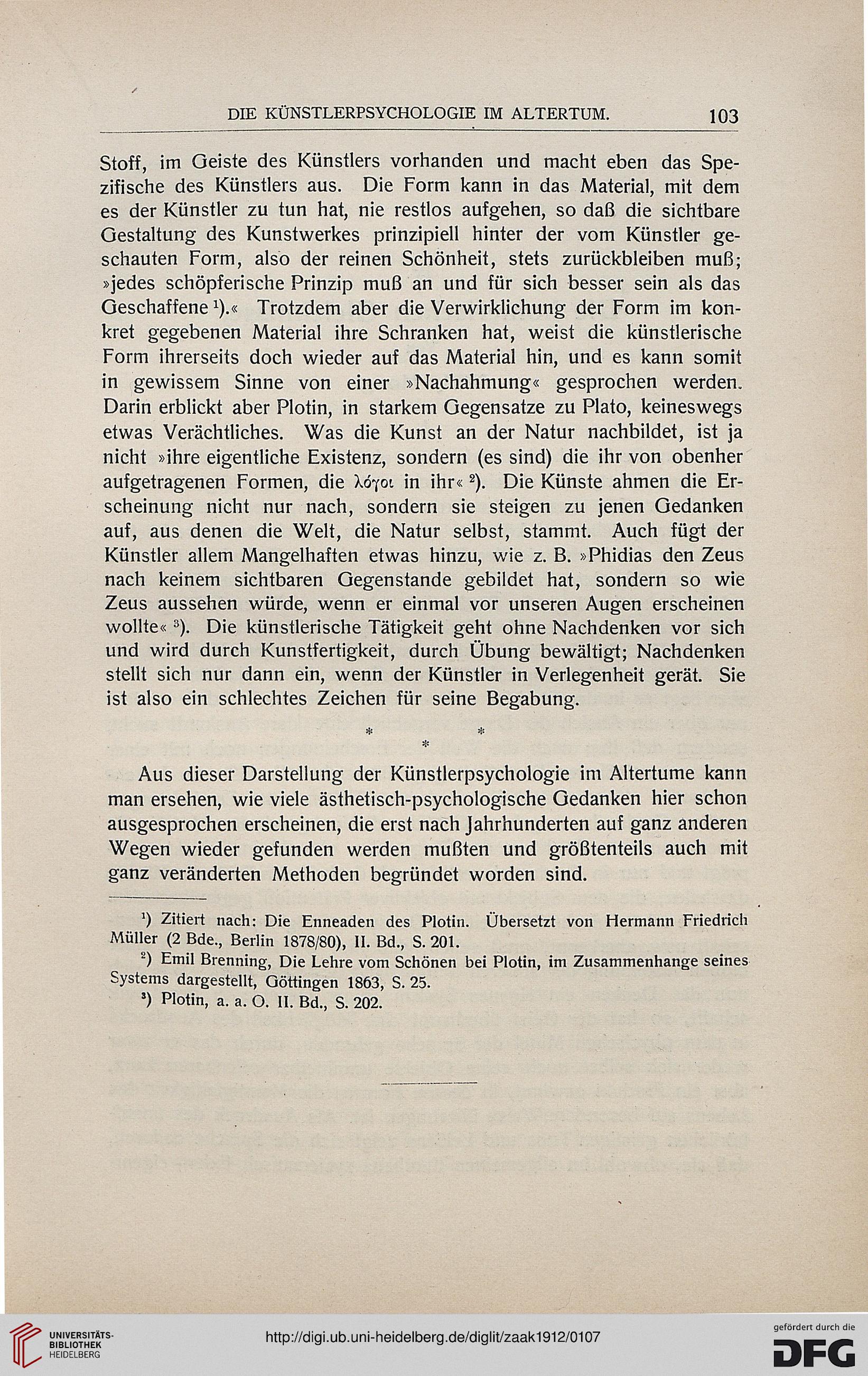DIE KÜNSTLERPSYCHOLOGIE IM ALTERTUM. 103
Stoff, im Geiste des Künstlers vorhanden und macht eben das Spe-
zifische des Künstlers aus. Die Form kann in das Material, mit dem
es der Künstler zu tun hat, nie restlos aufgehen, so daß die sichtbare
Gestaltung des Kunstwerkes prinzipiell hinter der vom Künstler ge-
schauten Form, also der reinen Schönheit, stets zurückbleiben muß;
»jedes schöpferische Prinzip muß an und für sich besser sein als das
Geschaffene1).« Trotzdem aber die Verwirklichung der Form im kon-
kret gegebenen Material ihre Schranken hat, weist die künstlerische
Form ihrerseits doch wieder auf das Material hin, und es kann somit
in gewissem Sinne von einer »Nachahmung« gesprochen werden.
Darin erblickt aber Plotin, in starkem Gegensatze zu Plato, keineswegs
etwas Verächtliches. Was die Kunst an der Natur nachbildet, ist ja
nicht »ihre eigentliche Existenz, sondern (es sind) die ihr von obenher
aufgetragenen Formen, die Xd-yoi in ihr«2). Die Künste ahmen die Er-
scheinung nicht nur nach, sondern sie steigen zu jenen Gedanken
auf, aus denen die Welt, die Natur selbst, stammt. Auch fügt der
Künstler allem Mangelhaften etwas hinzu, wie z. B. »Phidias den Zeus
nach keinem sichtbaren Gegenstande gebildet hat, sondern so wie
Zeus aussehen würde, wenn er einmal vor unseren Augen erscheinen
wollte« 3). Die künstlerische Tätigkeit geht ohne Nachdenken vor sich
und wird durch Kunstfertigkeit, durch Übung bewältigt; Nachdenken
stellt sich nur dann ein, wenn der Künstler in Verlegenheit gerät. Sie
ist also ein schlechtes Zeichen für seine Begabung.
Aus dieser Darstellung der Künstlerpsychologie im Altertume kann
man ersehen, wie viele ästhetisch-psychologische Gedanken hier schon
ausgesprochen erscheinen, die erst nach Jahrhunderten auf ganz anderen
Wegen wieder gefunden werden mußten und größtenteils auch mit
ganz veränderten Methoden begründet worden sind.
') Zitiert nach: Die Enneaden des Plotin. Übersetzt von Hermann Friedrich
Müller (2 Bde., Berlin 1878/80), II. Bd., S. 201.
2) Emil Brenning, Die Lehre vom Schönen bei Plotin, im Zusammenhange seines
Systems dargestellt, Göttingen 1863, S. 25.
') Plotin, a. a. O. II. Bd., S. 202.
Stoff, im Geiste des Künstlers vorhanden und macht eben das Spe-
zifische des Künstlers aus. Die Form kann in das Material, mit dem
es der Künstler zu tun hat, nie restlos aufgehen, so daß die sichtbare
Gestaltung des Kunstwerkes prinzipiell hinter der vom Künstler ge-
schauten Form, also der reinen Schönheit, stets zurückbleiben muß;
»jedes schöpferische Prinzip muß an und für sich besser sein als das
Geschaffene1).« Trotzdem aber die Verwirklichung der Form im kon-
kret gegebenen Material ihre Schranken hat, weist die künstlerische
Form ihrerseits doch wieder auf das Material hin, und es kann somit
in gewissem Sinne von einer »Nachahmung« gesprochen werden.
Darin erblickt aber Plotin, in starkem Gegensatze zu Plato, keineswegs
etwas Verächtliches. Was die Kunst an der Natur nachbildet, ist ja
nicht »ihre eigentliche Existenz, sondern (es sind) die ihr von obenher
aufgetragenen Formen, die Xd-yoi in ihr«2). Die Künste ahmen die Er-
scheinung nicht nur nach, sondern sie steigen zu jenen Gedanken
auf, aus denen die Welt, die Natur selbst, stammt. Auch fügt der
Künstler allem Mangelhaften etwas hinzu, wie z. B. »Phidias den Zeus
nach keinem sichtbaren Gegenstande gebildet hat, sondern so wie
Zeus aussehen würde, wenn er einmal vor unseren Augen erscheinen
wollte« 3). Die künstlerische Tätigkeit geht ohne Nachdenken vor sich
und wird durch Kunstfertigkeit, durch Übung bewältigt; Nachdenken
stellt sich nur dann ein, wenn der Künstler in Verlegenheit gerät. Sie
ist also ein schlechtes Zeichen für seine Begabung.
Aus dieser Darstellung der Künstlerpsychologie im Altertume kann
man ersehen, wie viele ästhetisch-psychologische Gedanken hier schon
ausgesprochen erscheinen, die erst nach Jahrhunderten auf ganz anderen
Wegen wieder gefunden werden mußten und größtenteils auch mit
ganz veränderten Methoden begründet worden sind.
') Zitiert nach: Die Enneaden des Plotin. Übersetzt von Hermann Friedrich
Müller (2 Bde., Berlin 1878/80), II. Bd., S. 201.
2) Emil Brenning, Die Lehre vom Schönen bei Plotin, im Zusammenhange seines
Systems dargestellt, Göttingen 1863, S. 25.
') Plotin, a. a. O. II. Bd., S. 202.