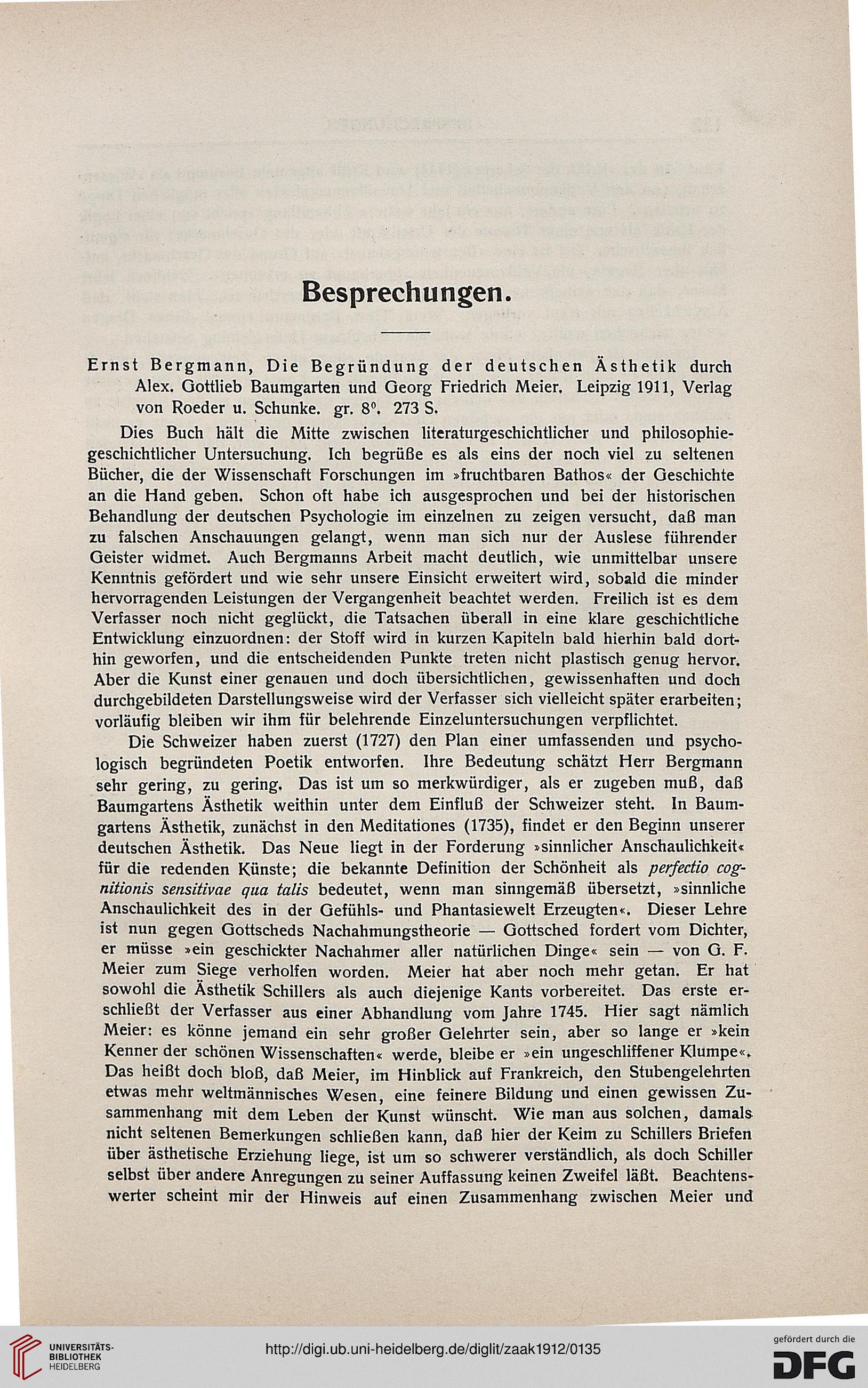Besprechungen.
Ernst Bergmann, Die Begründung der deutschen Ästhetik durch
Alex. Gottlieb Baumgarten und Georg Friedrich Meier. Leipzig 1911, Verlag
von Roeder u. Schunke. gr. 8°. 273 S.
Dies Buch hält die Mitte zwischen literaturgeschichtlicher und philosophie-
geschichtlicher Untersuchung. Ich begrüße es als eins der noch viel zu seltenen
Bücher, die der Wissenschaft Forschungen im »fruchtbaren Bathos« der Geschichte
an die Hand geben. Schon oft habe ich ausgesprochen und bei der historischen
Behandlung der deutschen Psychologie im einzelnen zu zeigen versucht, daß man
zu falschen Anschauungen gelangt, wenn man sich nur der Auslese führender
Geister widmet. Auch Bergmanns Arbeit macht deutlich, wie unmittelbar unsere
Kenntnis gefördert und wie sehr unsere Einsicht erweitert wird, sobald die minder
hervorragenden Leistungen der Vergangenheit beachtet werden. Freilich ist es dem
Verfasser noch nicht geglückt, die Tatsachen überall in eine klare geschichtliche
Entwicklung einzuordnen: der Stoff wird in kurzen Kapiteln bald hierhin bald dort-
hin geworfen, und die entscheidenden Punkte treten nicht plastisch genug hervor.
Aber die Kunst einer genauen und doch übersichtlichen, gewissenhaften und doch
durchgebildeten Darstellungsweise wird der Verfasser sich vielleicht später erarbeiten;
vorläufig bleiben wir ihm für belehrende Einzeluntersuchungen verpflichtet.
Die Schweizer haben zuerst (1727) den Plan einer umfassenden und psycho-
logisch begründeten Poetik entworfen. Ihre Bedeutung schätzt Herr Bergmann
sehr gering, zu gering. Das ist um so merkwürdiger, als er zugeben muß, daß
Baumgartens Ästhetik weithin unter dem Einfluß der Schweizer steht. In Baum-
gartens Ästhetik, zunächst in den Meditationes (1735), findet er den Beginn unserer
deutschen Ästhetik. Das Neue liegt in der Forderung »sinnlicher Anschaulichkeit«
für die redenden Künste; die bekannte Definition der Schönheit als perfectio cog-
nitionis sensitivae qua talis bedeutet, wenn man sinngemäß übersetzt, »sinnliche
Anschaulichkeit des in der Gefühls- und Phantasiewelt Erzeugten«. Dieser Lehre
ist nun gegen Gottscheds Nachahmungstheorie — Gottsched fordert vom Dichter,
er müsse »ein geschickter Nachahmer aller natürlichen Dinge« sein — von G. F.
Meier zum Siege verholten worden. Meier hat aber noch mehr getan. Er hat
sowohl die Ästhetik Schillers als auch diejenige Kants vorbereitet. Das erste er-
schließt der Verfasser aus einer Abhandlung vom Jahre 1745. Hier sagt nämlich
Meier: es könne jemand ein sehr großer Gelehrter sein, aber so lange er »kein
Kenner der schönen Wissenschaften« werde, bleibe er »ein ungeschliffener Klumpe«.
Das heißt doch bloß, daß Meier, im Hinblick auf Frankreich, den Stubengelehrten
etwas mehr weltmännisches Wesen, eine feinere Bildung und einen gewissen Zu-
sammenhang mit dem Leben der Kunst wünscht. Wie man aus solchen, damals
nicht seltenen Bemerkungen schließen kann, daß hier der Keim zu Schillers Briefen
über ästhetische Erziehung liege, ist um so schwerer verständlich, als doch Schiller
selbst über andere Anregungen zu seiner Auffassung keinen Zweifel läßt. Beachtens-
werter scheint mir der Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen Meier und
Ernst Bergmann, Die Begründung der deutschen Ästhetik durch
Alex. Gottlieb Baumgarten und Georg Friedrich Meier. Leipzig 1911, Verlag
von Roeder u. Schunke. gr. 8°. 273 S.
Dies Buch hält die Mitte zwischen literaturgeschichtlicher und philosophie-
geschichtlicher Untersuchung. Ich begrüße es als eins der noch viel zu seltenen
Bücher, die der Wissenschaft Forschungen im »fruchtbaren Bathos« der Geschichte
an die Hand geben. Schon oft habe ich ausgesprochen und bei der historischen
Behandlung der deutschen Psychologie im einzelnen zu zeigen versucht, daß man
zu falschen Anschauungen gelangt, wenn man sich nur der Auslese führender
Geister widmet. Auch Bergmanns Arbeit macht deutlich, wie unmittelbar unsere
Kenntnis gefördert und wie sehr unsere Einsicht erweitert wird, sobald die minder
hervorragenden Leistungen der Vergangenheit beachtet werden. Freilich ist es dem
Verfasser noch nicht geglückt, die Tatsachen überall in eine klare geschichtliche
Entwicklung einzuordnen: der Stoff wird in kurzen Kapiteln bald hierhin bald dort-
hin geworfen, und die entscheidenden Punkte treten nicht plastisch genug hervor.
Aber die Kunst einer genauen und doch übersichtlichen, gewissenhaften und doch
durchgebildeten Darstellungsweise wird der Verfasser sich vielleicht später erarbeiten;
vorläufig bleiben wir ihm für belehrende Einzeluntersuchungen verpflichtet.
Die Schweizer haben zuerst (1727) den Plan einer umfassenden und psycho-
logisch begründeten Poetik entworfen. Ihre Bedeutung schätzt Herr Bergmann
sehr gering, zu gering. Das ist um so merkwürdiger, als er zugeben muß, daß
Baumgartens Ästhetik weithin unter dem Einfluß der Schweizer steht. In Baum-
gartens Ästhetik, zunächst in den Meditationes (1735), findet er den Beginn unserer
deutschen Ästhetik. Das Neue liegt in der Forderung »sinnlicher Anschaulichkeit«
für die redenden Künste; die bekannte Definition der Schönheit als perfectio cog-
nitionis sensitivae qua talis bedeutet, wenn man sinngemäß übersetzt, »sinnliche
Anschaulichkeit des in der Gefühls- und Phantasiewelt Erzeugten«. Dieser Lehre
ist nun gegen Gottscheds Nachahmungstheorie — Gottsched fordert vom Dichter,
er müsse »ein geschickter Nachahmer aller natürlichen Dinge« sein — von G. F.
Meier zum Siege verholten worden. Meier hat aber noch mehr getan. Er hat
sowohl die Ästhetik Schillers als auch diejenige Kants vorbereitet. Das erste er-
schließt der Verfasser aus einer Abhandlung vom Jahre 1745. Hier sagt nämlich
Meier: es könne jemand ein sehr großer Gelehrter sein, aber so lange er »kein
Kenner der schönen Wissenschaften« werde, bleibe er »ein ungeschliffener Klumpe«.
Das heißt doch bloß, daß Meier, im Hinblick auf Frankreich, den Stubengelehrten
etwas mehr weltmännisches Wesen, eine feinere Bildung und einen gewissen Zu-
sammenhang mit dem Leben der Kunst wünscht. Wie man aus solchen, damals
nicht seltenen Bemerkungen schließen kann, daß hier der Keim zu Schillers Briefen
über ästhetische Erziehung liege, ist um so schwerer verständlich, als doch Schiller
selbst über andere Anregungen zu seiner Auffassung keinen Zweifel läßt. Beachtens-
werter scheint mir der Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen Meier und