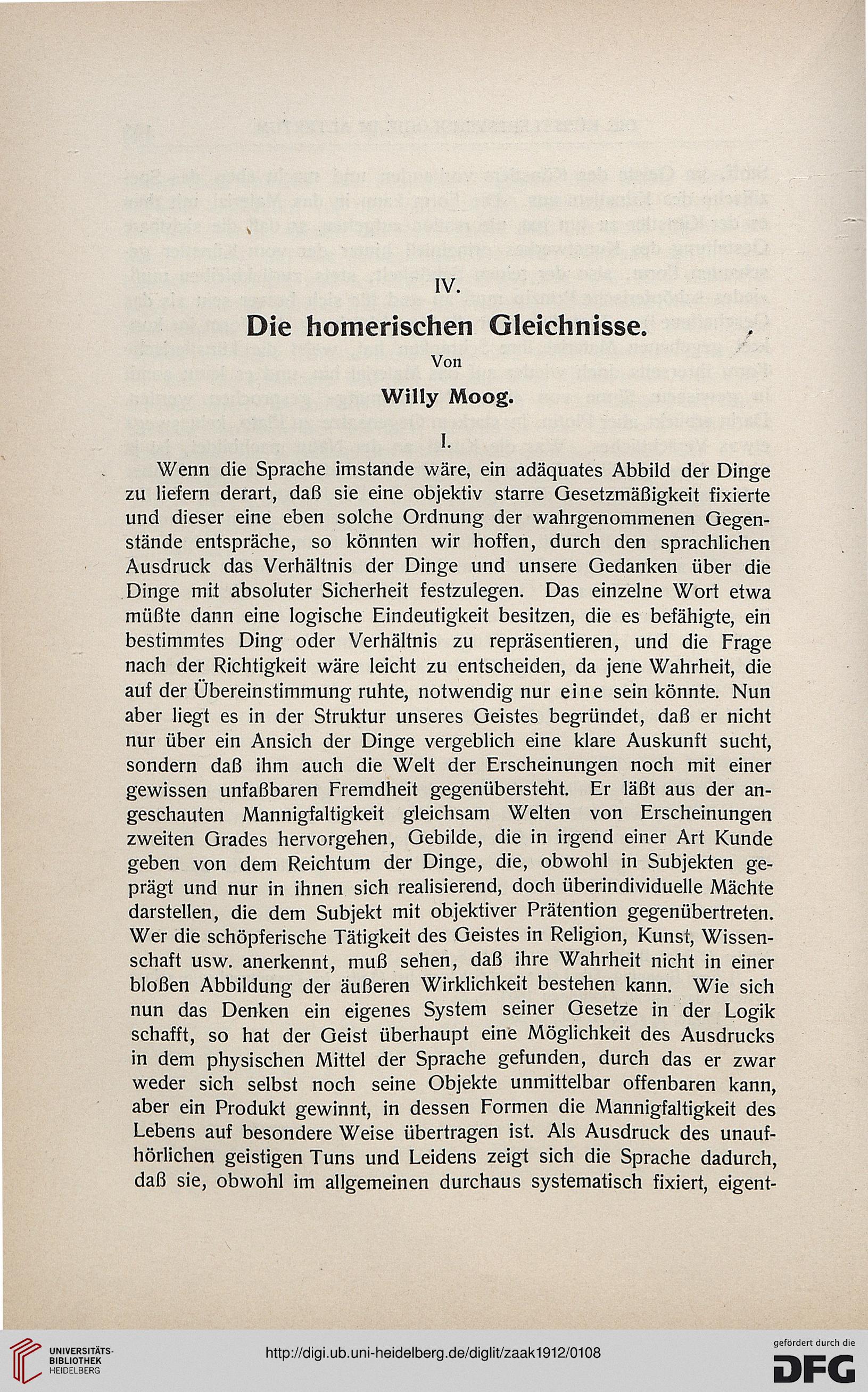IV.
Die homerischen Gleichnisse.
Von
Willy Moog.
I.
Wenn die Sprache imstande wäre, ein adäquates Abbild der Dinge
zu liefern derart, daß sie eine objektiv starre Gesetzmäßigkeit fixierte
und dieser eine eben solche Ordnung der wahrgenommenen Gegen-
stände entspräche, so könnten wir hoffen, durch den sprachlichen
Ausdruck das Verhältnis der Dinge und unsere Gedanken über die
Dinge mit absoluter Sicherheit festzulegen. Das einzelne Wort etwa
müßte dann eine logische Eindeutigkeit besitzen, die es befähigte, ein
bestimmtes Ding oder Verhältnis zu repräsentieren, und die Frage
nach der Richtigkeit wäre leicht zu entscheiden, da jene Wahrheit, die
auf der Übereinstimmung ruhte, notwendig nur eine sein könnte. Nun
aber liegt es in der Struktur unseres Geistes begründet, daß er nicht
nur über ein Ansich der Dinge vergeblich eine klare Auskunft sucht,
sondern daß ihm auch die Welt der Erscheinungen noch mit einer
gewissen unfaßbaren Fremdheit gegenübersteht. Er läßt aus der an-
geschauten Mannigfaltigkeit gleichsam Welten von Erscheinungen
zweiten Grades hervorgehen, Gebilde, die in irgend einer Art Kunde
geben von dem Reichtum der Dinge, die, obwohl in Subjekten ge-
prägt und nur in ihnen sich realisierend, doch überindividuelle Mächte
darstellen, die dem Subjekt mit objektiver Prätention gegenübertreten.
Wer die schöpferische Tätigkeit des Geistes in Religion, Kunst, Wissen-
schaft usw. anerkennt, muß sehen, daß ihre Wahrheit nicht in einer
bloßen Abbildung der äußeren Wirklichkeit bestehen kann. Wie sich
nun das Denken ein eigenes System seiner Gesetze in der Logik
schafft, so hat der Geist überhaupt eine Möglichkeit des Ausdrucks
in dem physischen Mittel der Sprache gefunden, durch das er zwar
weder sich selbst noch seine Objekte unmittelbar offenbaren kann,
aber ein Produkt gewinnt, in dessen Formen die Mannigfaltigkeit des
Lebens auf besondere Weise übertragen ist. Als Ausdruck des unauf-
hörlichen geistigen Tuns und Leidens zeigt sich die Sprache dadurch,
daß sie, obwohl im allgemeinen durchaus systematisch fixiert, eigent-
Die homerischen Gleichnisse.
Von
Willy Moog.
I.
Wenn die Sprache imstande wäre, ein adäquates Abbild der Dinge
zu liefern derart, daß sie eine objektiv starre Gesetzmäßigkeit fixierte
und dieser eine eben solche Ordnung der wahrgenommenen Gegen-
stände entspräche, so könnten wir hoffen, durch den sprachlichen
Ausdruck das Verhältnis der Dinge und unsere Gedanken über die
Dinge mit absoluter Sicherheit festzulegen. Das einzelne Wort etwa
müßte dann eine logische Eindeutigkeit besitzen, die es befähigte, ein
bestimmtes Ding oder Verhältnis zu repräsentieren, und die Frage
nach der Richtigkeit wäre leicht zu entscheiden, da jene Wahrheit, die
auf der Übereinstimmung ruhte, notwendig nur eine sein könnte. Nun
aber liegt es in der Struktur unseres Geistes begründet, daß er nicht
nur über ein Ansich der Dinge vergeblich eine klare Auskunft sucht,
sondern daß ihm auch die Welt der Erscheinungen noch mit einer
gewissen unfaßbaren Fremdheit gegenübersteht. Er läßt aus der an-
geschauten Mannigfaltigkeit gleichsam Welten von Erscheinungen
zweiten Grades hervorgehen, Gebilde, die in irgend einer Art Kunde
geben von dem Reichtum der Dinge, die, obwohl in Subjekten ge-
prägt und nur in ihnen sich realisierend, doch überindividuelle Mächte
darstellen, die dem Subjekt mit objektiver Prätention gegenübertreten.
Wer die schöpferische Tätigkeit des Geistes in Religion, Kunst, Wissen-
schaft usw. anerkennt, muß sehen, daß ihre Wahrheit nicht in einer
bloßen Abbildung der äußeren Wirklichkeit bestehen kann. Wie sich
nun das Denken ein eigenes System seiner Gesetze in der Logik
schafft, so hat der Geist überhaupt eine Möglichkeit des Ausdrucks
in dem physischen Mittel der Sprache gefunden, durch das er zwar
weder sich selbst noch seine Objekte unmittelbar offenbaren kann,
aber ein Produkt gewinnt, in dessen Formen die Mannigfaltigkeit des
Lebens auf besondere Weise übertragen ist. Als Ausdruck des unauf-
hörlichen geistigen Tuns und Leidens zeigt sich die Sprache dadurch,
daß sie, obwohl im allgemeinen durchaus systematisch fixiert, eigent-