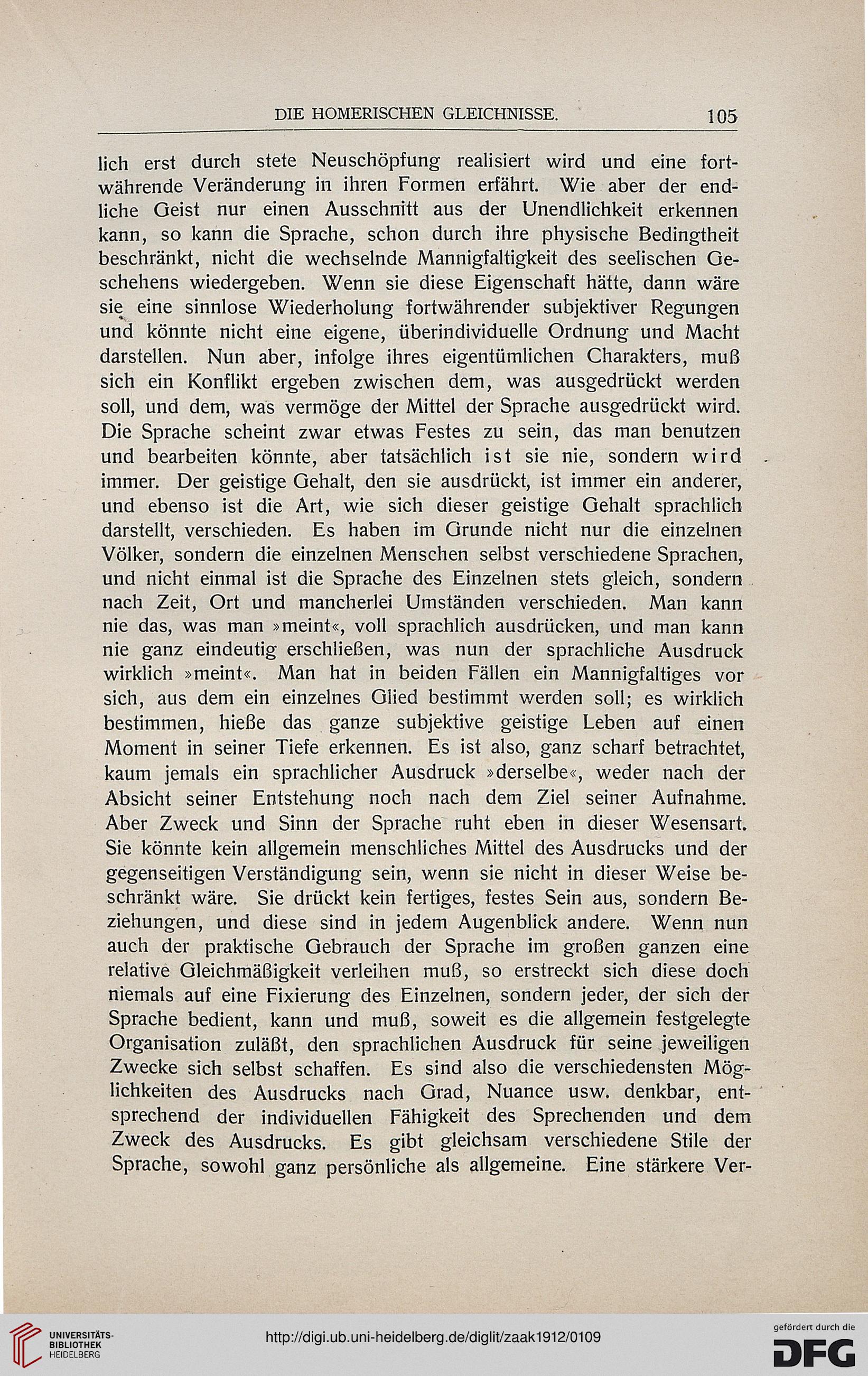DIE HOMERISCHEN GLEICHNISSE. 105
lieh erst durch stete Neuschöpfung realisiert wird und eine fort-
währende Veränderung in ihren Formen erfährt. Wie aber der end-
liche Geist nur einen Ausschnitt aus der Unendlichkeit erkennen
kann, so kann die Sprache, schon durch ihre physische Bedingtheit
beschränkt, nicht die wechselnde Mannigfaltigkeit des seelischen Ge-
schehens wiedergeben. Wenn sie diese Eigenschaft hätte, dann wäre
sie eine sinnlose Wiederholung fortwährender subjektiver Regungen
und könnte nicht eine eigene, überindividuelle Ordnung und Macht
darstellen. Nun aber, infolge ihres eigentümlichen Charakters, muß
sich ein Konflikt ergeben zwischen dem, was ausgedrückt werden
soll, und dem, was vermöge der Mittel der Sprache ausgedrückt wird.
Die Sprache scheint zwar etwas Festes zu sein, das man benutzen
und bearbeiten könnte, aber tatsächlich ist sie nie, sondern wird
immer. Der geistige Gehalt, den sie ausdrückt, ist immer ein anderer,
und ebenso ist die Art, wie sich dieser geistige Gehalt sprachlich
darstellt, verschieden. Es haben im Grunde nicht nur die einzelnen
Völker, sondern die einzelnen Menschen selbst verschiedene Sprachen,
und nicht einmal ist die Sprache des Einzelnen stets gleich, sondern .
nach Zeit, Ort und mancherlei Umständen verschieden. Man kann
nie das, was man »meint«, voll sprachlich ausdrücken, und man kann
nie ganz eindeutig erschließen, was nun der sprachliche Ausdruck
wirklich »meint«. Man hat in beiden Fällen ein Mannigfaltiges vor
sich, aus dem ein einzelnes Glied bestimmt werden soll; es wirklich
bestimmen, hieße das ganze subjektive geistige Leben auf einen
Moment in seiner Tiefe erkennen. Es ist also, ganz scharf betrachtet,
kaum jemals ein sprachlicher Ausdruck »derselbe«, weder nach der
Absicht seiner Entstehung noch nach dem Ziel seiner Aufnahme.
Aber Zweck und Sinn der Sprache ruht eben in dieser Wesensart.
Sie könnte kein allgemein menschliches Mittel des Ausdrucks und der
gegenseitigen Verständigung sein, wenn sie nicht in dieser Weise be-
schränkt wäre. Sie drückt kein fertiges, festes Sein aus, sondern Be-
ziehungen, und diese sind in jedem Augenblick andere. Wenn nun
auch der praktische Gebrauch der Sprache im großen ganzen eine
relative Gleichmäßigkeit verleihen muß, so erstreckt sich diese doch
niemals auf eine Fixierung des Einzelnen, sondern jeder, der sich der
Sprache bedient, kann und muß, soweit es die allgemein festgelegte
Organisation zuläßt, den sprachlichen Ausdruck für seine jeweiligen
Zwecke sich selbst schaffen. Es sind also die verschiedensten Mög-
lichkeiten des Ausdrucks nach Grad, Nuance usw. denkbar, ent-
sprechend der individuellen Fähigkeit des Sprechenden und dem
Zweck des Ausdrucks. Es gibt gleichsam verschiedene Stile der
Sprache, sowohl ganz persönliche als allgemeine. Eine stärkere Ver-
lieh erst durch stete Neuschöpfung realisiert wird und eine fort-
währende Veränderung in ihren Formen erfährt. Wie aber der end-
liche Geist nur einen Ausschnitt aus der Unendlichkeit erkennen
kann, so kann die Sprache, schon durch ihre physische Bedingtheit
beschränkt, nicht die wechselnde Mannigfaltigkeit des seelischen Ge-
schehens wiedergeben. Wenn sie diese Eigenschaft hätte, dann wäre
sie eine sinnlose Wiederholung fortwährender subjektiver Regungen
und könnte nicht eine eigene, überindividuelle Ordnung und Macht
darstellen. Nun aber, infolge ihres eigentümlichen Charakters, muß
sich ein Konflikt ergeben zwischen dem, was ausgedrückt werden
soll, und dem, was vermöge der Mittel der Sprache ausgedrückt wird.
Die Sprache scheint zwar etwas Festes zu sein, das man benutzen
und bearbeiten könnte, aber tatsächlich ist sie nie, sondern wird
immer. Der geistige Gehalt, den sie ausdrückt, ist immer ein anderer,
und ebenso ist die Art, wie sich dieser geistige Gehalt sprachlich
darstellt, verschieden. Es haben im Grunde nicht nur die einzelnen
Völker, sondern die einzelnen Menschen selbst verschiedene Sprachen,
und nicht einmal ist die Sprache des Einzelnen stets gleich, sondern .
nach Zeit, Ort und mancherlei Umständen verschieden. Man kann
nie das, was man »meint«, voll sprachlich ausdrücken, und man kann
nie ganz eindeutig erschließen, was nun der sprachliche Ausdruck
wirklich »meint«. Man hat in beiden Fällen ein Mannigfaltiges vor
sich, aus dem ein einzelnes Glied bestimmt werden soll; es wirklich
bestimmen, hieße das ganze subjektive geistige Leben auf einen
Moment in seiner Tiefe erkennen. Es ist also, ganz scharf betrachtet,
kaum jemals ein sprachlicher Ausdruck »derselbe«, weder nach der
Absicht seiner Entstehung noch nach dem Ziel seiner Aufnahme.
Aber Zweck und Sinn der Sprache ruht eben in dieser Wesensart.
Sie könnte kein allgemein menschliches Mittel des Ausdrucks und der
gegenseitigen Verständigung sein, wenn sie nicht in dieser Weise be-
schränkt wäre. Sie drückt kein fertiges, festes Sein aus, sondern Be-
ziehungen, und diese sind in jedem Augenblick andere. Wenn nun
auch der praktische Gebrauch der Sprache im großen ganzen eine
relative Gleichmäßigkeit verleihen muß, so erstreckt sich diese doch
niemals auf eine Fixierung des Einzelnen, sondern jeder, der sich der
Sprache bedient, kann und muß, soweit es die allgemein festgelegte
Organisation zuläßt, den sprachlichen Ausdruck für seine jeweiligen
Zwecke sich selbst schaffen. Es sind also die verschiedensten Mög-
lichkeiten des Ausdrucks nach Grad, Nuance usw. denkbar, ent-
sprechend der individuellen Fähigkeit des Sprechenden und dem
Zweck des Ausdrucks. Es gibt gleichsam verschiedene Stile der
Sprache, sowohl ganz persönliche als allgemeine. Eine stärkere Ver-