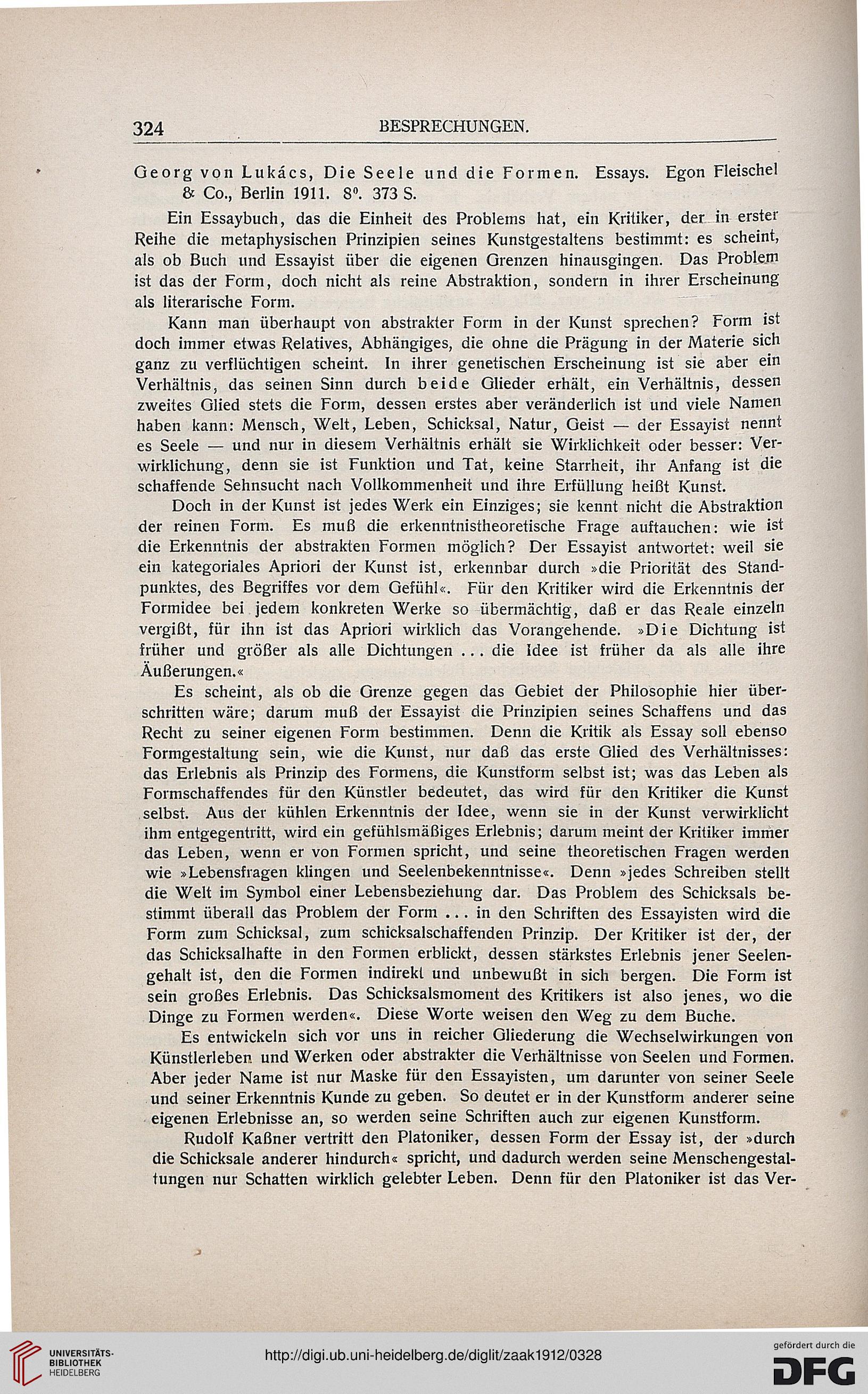324 BESPRECHUNGEN.
Georg von Lukäcs, Die Seele und die Formen. Essays. Egon Fleischel
& Co., Berlin 1911. 8°. 373 S.
Ein Essaybuch, das die Einheit des Problems hat, ein Kritiker, der in erster
Reihe die metaphysischen Prinzipien seines Kunstgestaltens bestimmt: es scheint,
als ob Buch und Essayist über die eigenen Grenzen hinausgingen. Das Problem
ist das der Form, doch nicht als reine Abstraktion, sondern in ihrer Erscheinung
als literarische Form.
Kann man überhaupt von abstrakter Form in der Kunst sprechen? Form ist
doch immer etwas Relatives, Abhängiges, die ohne die Prägung in der Materie sich
ganz zu verflüchtigen scheint. In ihrer genetischen Erscheinung ist sie aber ein
Verhältnis, das seinen Sinn durch beide Glieder erhält, ein Verhältnis, dessen
zweites Glied stets die Form, dessen erstes aber veränderlich ist und viele Namen
haben kann: Mensch, Welt, Leben, Schicksal, Natur, Geist — der Essayist nennt
es Seele — und nur in diesem Verhältnis erhält sie Wirklichkeit oder besser: Ver-
wirklichung, denn sie ist Funktion und Tat, keine Starrheit, ihr Anfang ist die
schaffende Sehnsucht nach Vollkommenheit und ihre Erfüllung heißt Kunst.
Doch in der Kunst ist jedes Werk ein Einziges; sie kennt nicht die Abstraktion
der reinen Form. Es muß die erkenntnistheoretische Frage auftauchen: wie ist
die Erkenntnis der abstrakten Formen möglich? Der Essayist antwortet: weil sie
ein kategoriales Apriori der Kunst ist, erkennbar durch »die Priorität des Stand-
punktes, des Begriffes vor dem Gefühl«. Für den Kritiker wird die Erkenntnis der
Formidee bei jedem konkreten Werke so übermächtig, daß er das Reale einzeln
vergißt, für ihn ist das Apriori wirklich das Vorangehende. »Die Dichtung ist
früher und größer als alle Dichtungen ... die Idee ist früher da als alle ihre
Äußerungen.«
Es scheint, als ob die Grenze gegen das Gebiet der Philosophie hier über-
schritten wäre; darum muß der Essayist die Prinzipien seines Schaffens und das
Recht zu seiner eigenen Form bestimmen. Denn die Kritik als Essay soll ebenso
Formgestaltung sein, wie die Kunst, nur daß das erste Glied des Verhältnisses:
das Erlebnis als Prinzip des Formens, die Kunstform selbst ist; was das Leben als
Formschaffendes für den Künstler bedeutet, das wird für den Kritiker die Kunst
selbst. Aus der kühlen Erkenntnis der Idee, wenn sie in der Kunst verwirklicht
ihm entgegentritt, wird ein gefühlsmäßiges Erlebnis; darum meint der Kritiker immer
das Leben, wenn er von Formen spricht, und seine theoretischen Fragen werden
wie »Lebensfragen klingen und Seelenbekenntnisse«. Denn »jedes Schreiben stellt
die Welt im Symbol einer Lebensbeziehung dar. Das Problem des Schicksals be-
stimmt überall das Problem der Form ... in den Schriften des Essayisten wird die
Form zum Schicksal, zum schicksalschaffenden Prinzip. Der Kritiker ist der, der
das Schicksalhafte in den Formen erblickt, dessen stärkstes Erlebnis jener Seelen-
gehalt ist, den die Formen indirekt und unbewußt in sich bergen. Die Form ist
sein großes Erlebnis. Das Schicksalsmoment des Kritikers ist also jenes, wo die
Dinge zu Formen weiden«. Diese Worte weisen den Weg zu dem Buche.
Es entwickeln sich vor uns in reicher Gliederung die Wechselwirkungen von
Künstlerleben und Werken oder abstrakter die Verhältnisse von Seelen und Formen.
Aber jeder Name ist nur Maske für den Essayisten, um darunter von seiner Seele
und seiner Erkenntnis Kunde zu geben. So deutet er in der Kunstform anderer seine
eigenen Erlebnisse an, so werden seine Schriften auch zur eigenen Kunstform.
Rudolf Kaßner vertritt den Platoniker, dessen Form der Essay ist, der »durch
die Schicksale anderer hindurch« spricht, und dadurch werden seine Menschengestal-
tungen nur Schatten wirklich gelebter Leben. Denn für den Platoniker ist das Ver-
Georg von Lukäcs, Die Seele und die Formen. Essays. Egon Fleischel
& Co., Berlin 1911. 8°. 373 S.
Ein Essaybuch, das die Einheit des Problems hat, ein Kritiker, der in erster
Reihe die metaphysischen Prinzipien seines Kunstgestaltens bestimmt: es scheint,
als ob Buch und Essayist über die eigenen Grenzen hinausgingen. Das Problem
ist das der Form, doch nicht als reine Abstraktion, sondern in ihrer Erscheinung
als literarische Form.
Kann man überhaupt von abstrakter Form in der Kunst sprechen? Form ist
doch immer etwas Relatives, Abhängiges, die ohne die Prägung in der Materie sich
ganz zu verflüchtigen scheint. In ihrer genetischen Erscheinung ist sie aber ein
Verhältnis, das seinen Sinn durch beide Glieder erhält, ein Verhältnis, dessen
zweites Glied stets die Form, dessen erstes aber veränderlich ist und viele Namen
haben kann: Mensch, Welt, Leben, Schicksal, Natur, Geist — der Essayist nennt
es Seele — und nur in diesem Verhältnis erhält sie Wirklichkeit oder besser: Ver-
wirklichung, denn sie ist Funktion und Tat, keine Starrheit, ihr Anfang ist die
schaffende Sehnsucht nach Vollkommenheit und ihre Erfüllung heißt Kunst.
Doch in der Kunst ist jedes Werk ein Einziges; sie kennt nicht die Abstraktion
der reinen Form. Es muß die erkenntnistheoretische Frage auftauchen: wie ist
die Erkenntnis der abstrakten Formen möglich? Der Essayist antwortet: weil sie
ein kategoriales Apriori der Kunst ist, erkennbar durch »die Priorität des Stand-
punktes, des Begriffes vor dem Gefühl«. Für den Kritiker wird die Erkenntnis der
Formidee bei jedem konkreten Werke so übermächtig, daß er das Reale einzeln
vergißt, für ihn ist das Apriori wirklich das Vorangehende. »Die Dichtung ist
früher und größer als alle Dichtungen ... die Idee ist früher da als alle ihre
Äußerungen.«
Es scheint, als ob die Grenze gegen das Gebiet der Philosophie hier über-
schritten wäre; darum muß der Essayist die Prinzipien seines Schaffens und das
Recht zu seiner eigenen Form bestimmen. Denn die Kritik als Essay soll ebenso
Formgestaltung sein, wie die Kunst, nur daß das erste Glied des Verhältnisses:
das Erlebnis als Prinzip des Formens, die Kunstform selbst ist; was das Leben als
Formschaffendes für den Künstler bedeutet, das wird für den Kritiker die Kunst
selbst. Aus der kühlen Erkenntnis der Idee, wenn sie in der Kunst verwirklicht
ihm entgegentritt, wird ein gefühlsmäßiges Erlebnis; darum meint der Kritiker immer
das Leben, wenn er von Formen spricht, und seine theoretischen Fragen werden
wie »Lebensfragen klingen und Seelenbekenntnisse«. Denn »jedes Schreiben stellt
die Welt im Symbol einer Lebensbeziehung dar. Das Problem des Schicksals be-
stimmt überall das Problem der Form ... in den Schriften des Essayisten wird die
Form zum Schicksal, zum schicksalschaffenden Prinzip. Der Kritiker ist der, der
das Schicksalhafte in den Formen erblickt, dessen stärkstes Erlebnis jener Seelen-
gehalt ist, den die Formen indirekt und unbewußt in sich bergen. Die Form ist
sein großes Erlebnis. Das Schicksalsmoment des Kritikers ist also jenes, wo die
Dinge zu Formen weiden«. Diese Worte weisen den Weg zu dem Buche.
Es entwickeln sich vor uns in reicher Gliederung die Wechselwirkungen von
Künstlerleben und Werken oder abstrakter die Verhältnisse von Seelen und Formen.
Aber jeder Name ist nur Maske für den Essayisten, um darunter von seiner Seele
und seiner Erkenntnis Kunde zu geben. So deutet er in der Kunstform anderer seine
eigenen Erlebnisse an, so werden seine Schriften auch zur eigenen Kunstform.
Rudolf Kaßner vertritt den Platoniker, dessen Form der Essay ist, der »durch
die Schicksale anderer hindurch« spricht, und dadurch werden seine Menschengestal-
tungen nur Schatten wirklich gelebter Leben. Denn für den Platoniker ist das Ver-