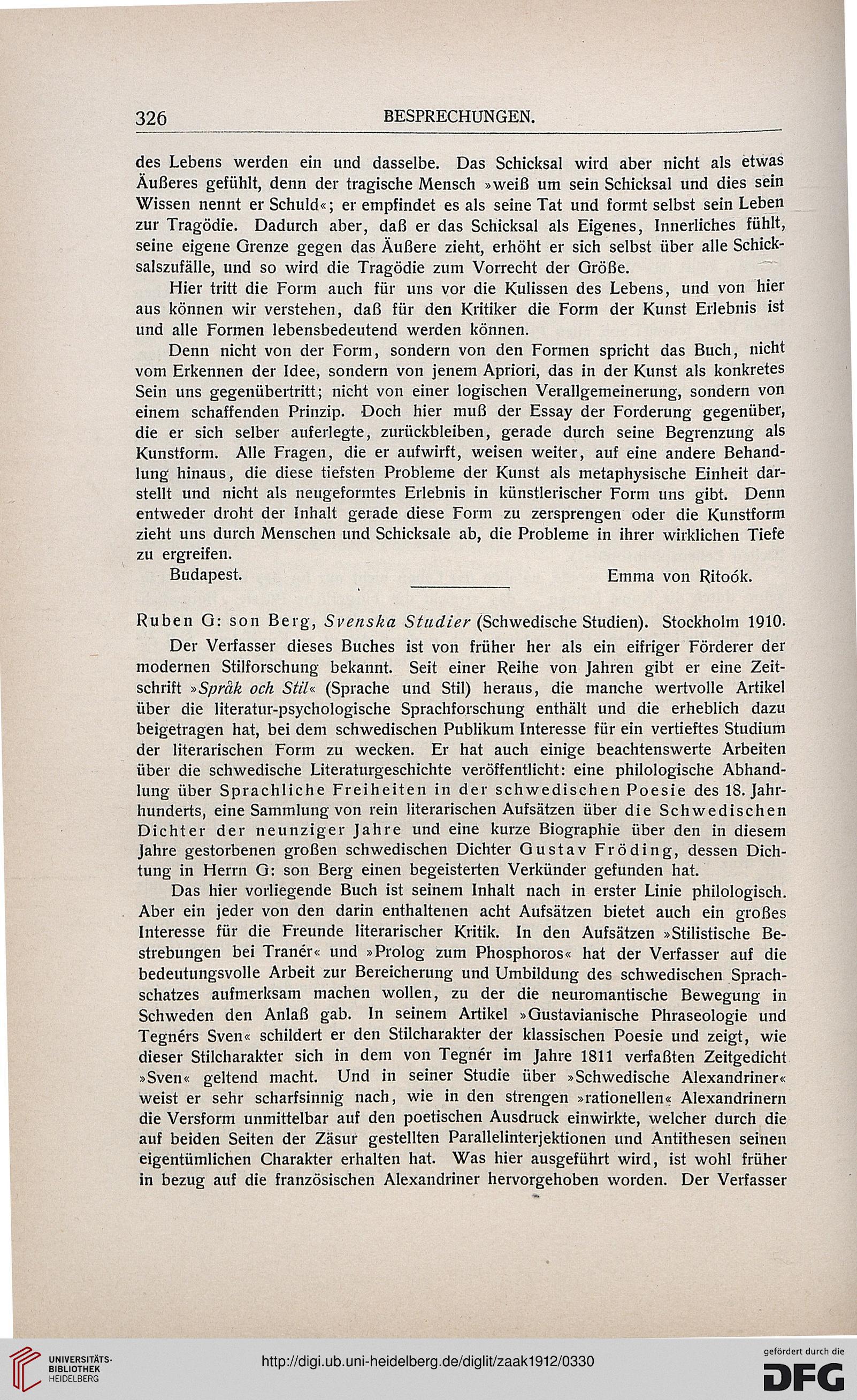326 BESPRECHUNGEN.
des Lebens weiden ein und dasselbe. Das Schicksal wird aber nicht als etwas
Äußeres gefühlt, denn der tragische Mensch »weiß um sein Schicksal und dies sein
Wissen nennt er Schuld«; er empfindet es als seine Tat und formt selbst sein Leben
zur Tragödie. Dadurch aber, daß er das Schicksal als Eigenes, Innerliches fühlt,
seine eigene Grenze gegen das Äußere zieht, erhöht er sich selbst über alle Schick-
salszufälle, und so wird die Tragödie zum Vorrecht der Größe.
Hier tritt die Form auch für uns vor die Kulissen des Lebens, und von hier
aus können wir verstehen, daß für den Kritiker die Form der Kunst Erlebnis ist
und alle Formen lebensbedeutend werden können.
Denn nicht von der Form, sondern von den Formen spricht das Buch, nicht
vom Erkennen der Idee, sondern von jenem Apriori, das in der Kunst als konkretes
Sein uns gegenübertritt; nicht von einer logischen Verallgemeinerung, sondern von
einem schaffenden Prinzip. Doch hier muß der Essay der Forderung gegenüber,
die er sich selber auferlegte, zurückbleiben, gerade durch seine Begrenzung als
Kunstform. Alle Fragen, die er aufwirft, weisen weiter, auf eine andere Behand-
lung hinaus, die diese tiefsten Probleme der Kunst als metaphysische Einheit dar-
stellt und nicht als neugeformtes Erlebnis in künstlerischer Form uns gibt. Denn
entweder droht der Inhalt gerade diese Form zu zersprengen oder die Kunstform
zieht uns durch Menschen und Schicksale ab, die Probleme in ihrer wirklichen Tiefe
zu ergreifen.
Budapest. ___________ Emma von Ritoök.
Rüben G: son Berg, Svenska Studier (Schwedische Studien). Stockholm 1910.
Der Verfasser dieses Buches ist von früher her als ein eifriger Förderer der
modernen Stilforschung bekannt. Seit einer Reihe von Jahren gibt er eine Zeit-
schrift »Spräk och Stil« (Sprache und Stil) heraus, die manche wertvolle Artikel
über die literatur-psychologische Sprachforschung enthält und die erheblich dazu
beigetragen hat, bei dem schwedischen Publikum Interesse für ein vertieftes Studium
der literarischen Form zu wecken. Er hat auch einige beachtenswerte Arbeiten
über die schwedische Literaturgeschichte veröffentlicht: eine philologische Abhand-
lung über Sprachliche Freiheiten in der schwedischen Poesie des 18. Jahr-
hunderts, eine Sammlung von rein literarischen Aufsätzen über die Schwedischen
Dichter der neunziger Jahre und eine kurze Biographie über den in diesem
Jahre gestorbenen großen schwedischen Dichter Gustav Fröding, dessen Dich-
tung in Herrn G: son Berg einen begeisterten Verkünder gefunden hat.
Das hier vorliegende Buch ist seinem Inhalt nach in erster Linie philologisch.
Aber ein jeder von den darin enthaltenen acht Aufsätzen bietet auch ein großes
Interesse für die Freunde literarischer Kritik. In den Aufsätzen »Stilistische Be-
strebungen bei Traner« und »Prolog zum Phosphoros« hat der Verfasser auf die
bedeutungsvolle Arbeit zur Bereicherung und Umbildung des schwedischen Sprach-
schatzes aufmerksam machen wollen, zu der die neuromantische Bewegung in
Schweden den Anlaß gab. In seinem Artikel »Gustavianische Phraseologie und
Tegners Sven« schildert er den Stilcharakter der klassischen Poesie und zeigt, wie
dieser Stilcharakter sich in dem von Tegner im Jahre 1811 verfaßten Zeitgedicht
»Sven« geltend macht. Und in seiner Studie über »Schwedische Alexandriner«
weist er sehr scharfsinnig nach, wie in den strengen »rationellen« Alexandrinern
die Versform unmittelbar auf den poetischen Ausdruck einwirkte, welcher durch die
auf beiden Seiten der Zäsur gestellten Parallelinterjektionen und Antithesen seinen
eigentümlichen Charakter erhalten hat. Was hier ausgeführt wird, ist wohl früher
in bezug auf die französischen Alexandriner hervorgehoben worden. Der Verfasser
des Lebens weiden ein und dasselbe. Das Schicksal wird aber nicht als etwas
Äußeres gefühlt, denn der tragische Mensch »weiß um sein Schicksal und dies sein
Wissen nennt er Schuld«; er empfindet es als seine Tat und formt selbst sein Leben
zur Tragödie. Dadurch aber, daß er das Schicksal als Eigenes, Innerliches fühlt,
seine eigene Grenze gegen das Äußere zieht, erhöht er sich selbst über alle Schick-
salszufälle, und so wird die Tragödie zum Vorrecht der Größe.
Hier tritt die Form auch für uns vor die Kulissen des Lebens, und von hier
aus können wir verstehen, daß für den Kritiker die Form der Kunst Erlebnis ist
und alle Formen lebensbedeutend werden können.
Denn nicht von der Form, sondern von den Formen spricht das Buch, nicht
vom Erkennen der Idee, sondern von jenem Apriori, das in der Kunst als konkretes
Sein uns gegenübertritt; nicht von einer logischen Verallgemeinerung, sondern von
einem schaffenden Prinzip. Doch hier muß der Essay der Forderung gegenüber,
die er sich selber auferlegte, zurückbleiben, gerade durch seine Begrenzung als
Kunstform. Alle Fragen, die er aufwirft, weisen weiter, auf eine andere Behand-
lung hinaus, die diese tiefsten Probleme der Kunst als metaphysische Einheit dar-
stellt und nicht als neugeformtes Erlebnis in künstlerischer Form uns gibt. Denn
entweder droht der Inhalt gerade diese Form zu zersprengen oder die Kunstform
zieht uns durch Menschen und Schicksale ab, die Probleme in ihrer wirklichen Tiefe
zu ergreifen.
Budapest. ___________ Emma von Ritoök.
Rüben G: son Berg, Svenska Studier (Schwedische Studien). Stockholm 1910.
Der Verfasser dieses Buches ist von früher her als ein eifriger Förderer der
modernen Stilforschung bekannt. Seit einer Reihe von Jahren gibt er eine Zeit-
schrift »Spräk och Stil« (Sprache und Stil) heraus, die manche wertvolle Artikel
über die literatur-psychologische Sprachforschung enthält und die erheblich dazu
beigetragen hat, bei dem schwedischen Publikum Interesse für ein vertieftes Studium
der literarischen Form zu wecken. Er hat auch einige beachtenswerte Arbeiten
über die schwedische Literaturgeschichte veröffentlicht: eine philologische Abhand-
lung über Sprachliche Freiheiten in der schwedischen Poesie des 18. Jahr-
hunderts, eine Sammlung von rein literarischen Aufsätzen über die Schwedischen
Dichter der neunziger Jahre und eine kurze Biographie über den in diesem
Jahre gestorbenen großen schwedischen Dichter Gustav Fröding, dessen Dich-
tung in Herrn G: son Berg einen begeisterten Verkünder gefunden hat.
Das hier vorliegende Buch ist seinem Inhalt nach in erster Linie philologisch.
Aber ein jeder von den darin enthaltenen acht Aufsätzen bietet auch ein großes
Interesse für die Freunde literarischer Kritik. In den Aufsätzen »Stilistische Be-
strebungen bei Traner« und »Prolog zum Phosphoros« hat der Verfasser auf die
bedeutungsvolle Arbeit zur Bereicherung und Umbildung des schwedischen Sprach-
schatzes aufmerksam machen wollen, zu der die neuromantische Bewegung in
Schweden den Anlaß gab. In seinem Artikel »Gustavianische Phraseologie und
Tegners Sven« schildert er den Stilcharakter der klassischen Poesie und zeigt, wie
dieser Stilcharakter sich in dem von Tegner im Jahre 1811 verfaßten Zeitgedicht
»Sven« geltend macht. Und in seiner Studie über »Schwedische Alexandriner«
weist er sehr scharfsinnig nach, wie in den strengen »rationellen« Alexandrinern
die Versform unmittelbar auf den poetischen Ausdruck einwirkte, welcher durch die
auf beiden Seiten der Zäsur gestellten Parallelinterjektionen und Antithesen seinen
eigentümlichen Charakter erhalten hat. Was hier ausgeführt wird, ist wohl früher
in bezug auf die französischen Alexandriner hervorgehoben worden. Der Verfasser