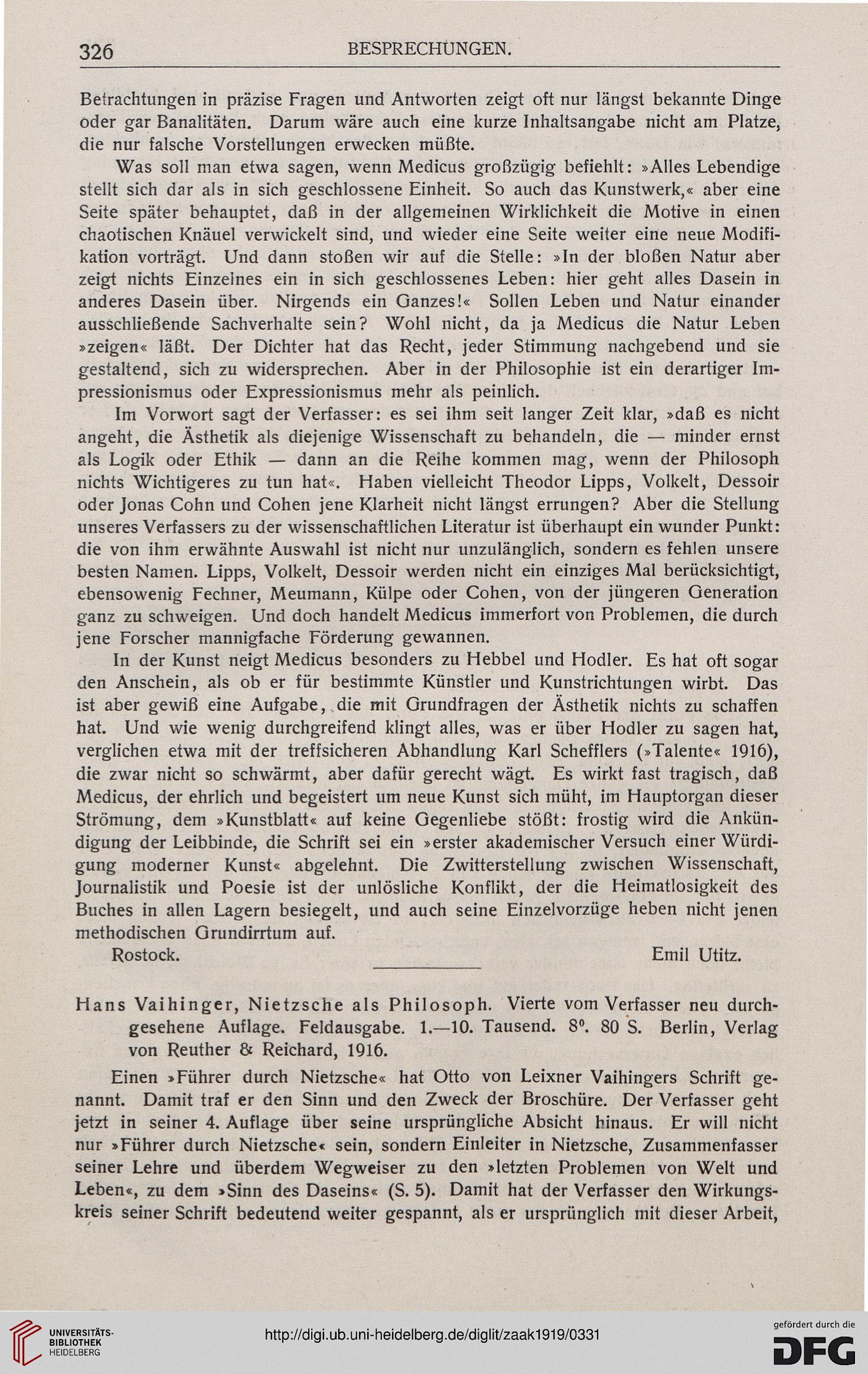326 BESPRECHUNGEN.
Befrachtungen in präzise Fragen und Antworten zeigt oft nur längst bekannte Dinge
oder gar Banalitäten. Darum wäre auch eine kurze Inhaltsangabe nicht am Platze,
die nur falsche Vorstellungen erwecken müßte.
Was soll man etwa sagen, wenn Medicus großzügig befiehlt: »Alles Lebendige
stellt sich dar als in sich geschlossene Einheit. So auch das Kunstwerk,« aber eine
Seite später behauptet, daß in der allgemeinen Wirklichkeit die Motive in einen
chaotischen Knäuel verwickelt sind, und wieder eine Seite weiter eine neue Modifi-
kation vorträgt. Und dann stoßen wir auf die Stelle: »In der bloßen Natur aber
zeigt nichts Einzelnes ein in sich geschlossenes Leben: hier geht alles Dasein in
anderes Dasein über. Nirgends ein Ganzes!« Sollen Leben und Natur einander
ausschließende Sachverhalte sein? Wohl nicht, da ja Medicus die Natur Leben
»zeigen« läßt. Der Dichter hat das Recht, jeder Stimmung nachgebend und sie
gestaltend, sich zu widersprechen. Aber in der Philosophie ist ein derartiger Im-
pressionismus oder Expressionismus mehr als peinlich.
Im Vorwort sagt der Verfasser: es sei ihm seit langer Zeit klar, »daß es nicht
angeht, die Ästhetik als diejenige Wissenschaft zu behandeln, die — minder ernst
als Logik oder Ethik — dann an die Reihe kommen mag, wenn der Philosoph
nichts Wichtigeres zu tun hat«. Haben vielleicht Theodor Lipps, Volkelt, Dessoir
oder Jonas Cohn und Cohen jene Klarheit nicht längst errungen? Aber die Stellung
unseres Verfassers zu der wissenschaftlichen Literatur ist überhaupt ein wunder Punkt:
die von ihm erwähnte Auswahl ist nicht nur unzulänglich, sondern es fehlen unsere
besten Namen. Lipps, Volkelt, Dessoir werden nicht ein einziges Mal berücksichtigt,
ebensowenig Fechner, Meumann, Külpe oder Cohen, von der jüngeren Generation
ganz zu schweigen. Und doch handelt Medicus immerfort von Problemen, die durch
jene Forscher mannigfache Förderung gewannen.
In der Kunst neigt Medicus besonders zu Hebbel und Hodler. Es hat oft sogar
den Anschein, als ob er für bestimmte Künstler und Kunstrichtungen wirbt. Das
ist aber gewiß eine Aufgabe, die mit Grundfragen der Ästhetik nichts zu schaffen
hat. Und wie wenig durchgreifend klingt alles, was er über Hodler zu sagen hat,
verglichen etwa mit der treffsicheren Abhandlung Karl Schefflers (»Talente« 1916),
die zwar nicht so schwärmt, aber dafür gerecht wägt. Es wirkt fast tragisch, daß
Medicus, der ehrlich und begeistert um neue Kunst sich müht, im Hauptorgan dieser
Strömung, dem »Kunstblatt« auf keine Gegenliebe stößt: frostig wird die Ankün-
digung der Leibbinde, die Schrift sei ein »erster akademischer Versuch einer Würdi-
gung moderner Kunst« abgelehnt. Die Zwitterstellung zwischen Wissenschaft,
Journalistik und Poesie ist der unlösliche Konflikt, der die Heimatlosigkeit des
Buches in allen Lagern besiegelt, und auch seine Einzelvorzüge heben nicht jenen
methodischen Grundirrtum auf.
Rostock. Emil Utitz.
Hans Vaihinger, Nietzsche als Philosoph. Vierte vom Verfasser neu durch-
gesehene Auflage. Feldausgabe. 1.—10. Tausend. 8°. 80 S. Berlin, Verlag
von Reuther & Reichard, 1916.
Einen »Führer durch Nietzsche« hat Otto von Leixner Vaihingers Schrift ge-
nannt. Damit traf er den Sinn und den Zweck der Broschüre. Der Verfasser geht
jetzt in seiner 4. Auflage über seine ursprüngliche Absicht hinaus. Er will nicht
nur »Führer durch Nietzsche« sein, sondern Einleiter in Nietzsche, Zusammenfasser
seiner Lehre und überdem Wegweiser zu den »letzten Problemen von Welt und
Leben«, zu dem »Sinn des Daseins« (S. 5). Damit hat der Verfasser den Wirkungs-
kreis seiner Schrift bedeutend weiter gespannt, als er ursprünglich mit dieser Arbeit,
Befrachtungen in präzise Fragen und Antworten zeigt oft nur längst bekannte Dinge
oder gar Banalitäten. Darum wäre auch eine kurze Inhaltsangabe nicht am Platze,
die nur falsche Vorstellungen erwecken müßte.
Was soll man etwa sagen, wenn Medicus großzügig befiehlt: »Alles Lebendige
stellt sich dar als in sich geschlossene Einheit. So auch das Kunstwerk,« aber eine
Seite später behauptet, daß in der allgemeinen Wirklichkeit die Motive in einen
chaotischen Knäuel verwickelt sind, und wieder eine Seite weiter eine neue Modifi-
kation vorträgt. Und dann stoßen wir auf die Stelle: »In der bloßen Natur aber
zeigt nichts Einzelnes ein in sich geschlossenes Leben: hier geht alles Dasein in
anderes Dasein über. Nirgends ein Ganzes!« Sollen Leben und Natur einander
ausschließende Sachverhalte sein? Wohl nicht, da ja Medicus die Natur Leben
»zeigen« läßt. Der Dichter hat das Recht, jeder Stimmung nachgebend und sie
gestaltend, sich zu widersprechen. Aber in der Philosophie ist ein derartiger Im-
pressionismus oder Expressionismus mehr als peinlich.
Im Vorwort sagt der Verfasser: es sei ihm seit langer Zeit klar, »daß es nicht
angeht, die Ästhetik als diejenige Wissenschaft zu behandeln, die — minder ernst
als Logik oder Ethik — dann an die Reihe kommen mag, wenn der Philosoph
nichts Wichtigeres zu tun hat«. Haben vielleicht Theodor Lipps, Volkelt, Dessoir
oder Jonas Cohn und Cohen jene Klarheit nicht längst errungen? Aber die Stellung
unseres Verfassers zu der wissenschaftlichen Literatur ist überhaupt ein wunder Punkt:
die von ihm erwähnte Auswahl ist nicht nur unzulänglich, sondern es fehlen unsere
besten Namen. Lipps, Volkelt, Dessoir werden nicht ein einziges Mal berücksichtigt,
ebensowenig Fechner, Meumann, Külpe oder Cohen, von der jüngeren Generation
ganz zu schweigen. Und doch handelt Medicus immerfort von Problemen, die durch
jene Forscher mannigfache Förderung gewannen.
In der Kunst neigt Medicus besonders zu Hebbel und Hodler. Es hat oft sogar
den Anschein, als ob er für bestimmte Künstler und Kunstrichtungen wirbt. Das
ist aber gewiß eine Aufgabe, die mit Grundfragen der Ästhetik nichts zu schaffen
hat. Und wie wenig durchgreifend klingt alles, was er über Hodler zu sagen hat,
verglichen etwa mit der treffsicheren Abhandlung Karl Schefflers (»Talente« 1916),
die zwar nicht so schwärmt, aber dafür gerecht wägt. Es wirkt fast tragisch, daß
Medicus, der ehrlich und begeistert um neue Kunst sich müht, im Hauptorgan dieser
Strömung, dem »Kunstblatt« auf keine Gegenliebe stößt: frostig wird die Ankün-
digung der Leibbinde, die Schrift sei ein »erster akademischer Versuch einer Würdi-
gung moderner Kunst« abgelehnt. Die Zwitterstellung zwischen Wissenschaft,
Journalistik und Poesie ist der unlösliche Konflikt, der die Heimatlosigkeit des
Buches in allen Lagern besiegelt, und auch seine Einzelvorzüge heben nicht jenen
methodischen Grundirrtum auf.
Rostock. Emil Utitz.
Hans Vaihinger, Nietzsche als Philosoph. Vierte vom Verfasser neu durch-
gesehene Auflage. Feldausgabe. 1.—10. Tausend. 8°. 80 S. Berlin, Verlag
von Reuther & Reichard, 1916.
Einen »Führer durch Nietzsche« hat Otto von Leixner Vaihingers Schrift ge-
nannt. Damit traf er den Sinn und den Zweck der Broschüre. Der Verfasser geht
jetzt in seiner 4. Auflage über seine ursprüngliche Absicht hinaus. Er will nicht
nur »Führer durch Nietzsche« sein, sondern Einleiter in Nietzsche, Zusammenfasser
seiner Lehre und überdem Wegweiser zu den »letzten Problemen von Welt und
Leben«, zu dem »Sinn des Daseins« (S. 5). Damit hat der Verfasser den Wirkungs-
kreis seiner Schrift bedeutend weiter gespannt, als er ursprünglich mit dieser Arbeit,