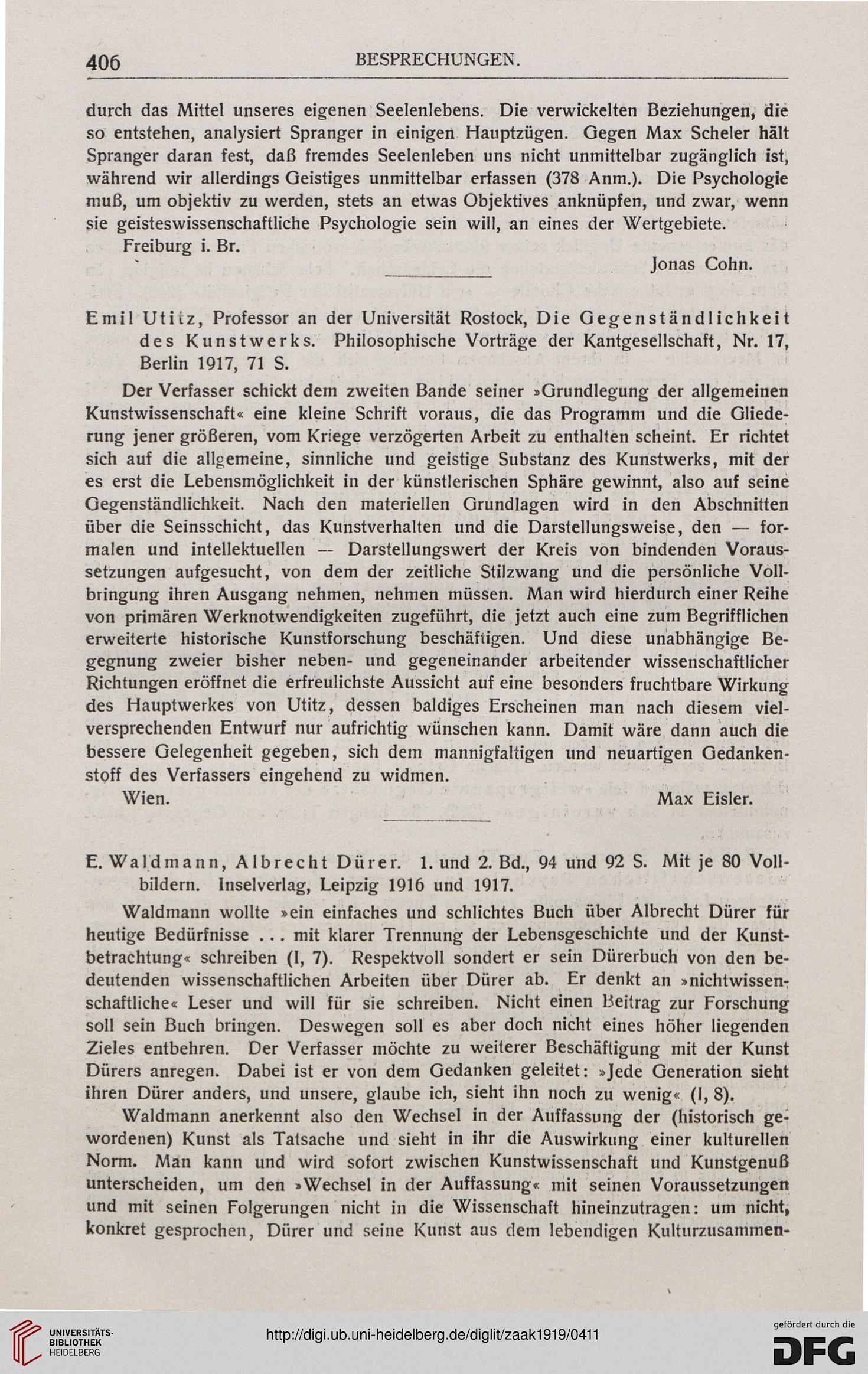406 BESPRECHUNGEN.
durch das Mittel unseres eigenen Seelenlebens. Die verwickelten Beziehungen, die
so entstehen, analysiert Spranger in einigen Hauptzügen. Gegen Max Scheler hält
Spranger daran fest, daß fremdes Seelenleben uns nicht unmittelbar zugänglich ist,
während wir allerdings Geistiges unmittelbar erfassen (378 Anm.). Die Psychologie
muß, um objektiv zu werden, stets an etwas Objektives anknüpfen, und zwar, wenn
sie geisteswissenschaftliche Psychologie sein will, an eines der Wertgebiete.
Freiburg i. Br.
Jonas Cohn.
Emil Utiiz, Professor an der Universität Rostock, Die Gegenständlichkeit
des Kunstwerks. Philosophische Vorträge der Kantgesellschaft, Nr. 17,
Berlin 1917, 71 S.
Der Verfasser schickt dem zweiten Bande seiner »Grundlegung der allgemeinen
Kunstwissenschaft« eine kleine Schrift voraus, die das Programm und die Gliede-
rung jener größeren, vom Kriege verzögerten Arbeit zu enthalten scheint. Er richtet
sich auf die allgemeine, sinnliche und geistige Substanz des Kunstwerks, mit der
es erst die Lebensmöglichkeit in der künstlerischen Sphäre gewinnt, also auf seine
Gegenständlichkeit. Nach den materiellen Grundlagen wird in den Abschnitten
über die Seinsschicht, das Kunstverhalten und die Darstellungsweise, den — for-
malen und intellektuellen — Darstellungswert der Kreis von bindenden Voraus-
setzungen aufgesucht, von dem der zeitliche Stilzwang und die persönliche Voll-
bringung ihren Ausgang nehmen, nehmen müssen. Man wird hierdurch einer Reihe
von primären Werknotwendigkeiten zugeführt, die jetzt auch eine zum Begrifflichen
erweiterte historische Kunstforschung beschäftigen. Und diese unabhängige Be-
gegnung zweier bisher neben- und gegeneinander arbeitender wissenschaftlicher
Richtungen eröffnet die erfreulichste Aussicht auf eine besonders fruchtbare Wirkung
des Hauptwerkes von Utitz, dessen baldiges Erscheinen man nach diesem viel-
versprechenden Entwurf nur aufrichtig wünschen kann. Damit wäre dann auch die
bessere Gelegenheit gegeben, sich dem mannigfaltigen und neuartigen Gedanken-
stoff des Verfassers eingehend zu widmen.
Wien. Max Eisler.
E. Waldmann, Albrecht Dürer. 1. und 2. Bd., 94 und 92 S. Mit je 80 Voll-
bildern. Inselverlag, Leipzig 1916 und 1917.
Waldmann wollte »ein einfaches und schlichtes Buch über Albrecht Dürer für
heutige Bedürfnisse ... mit klarer Trennung der Lebensgeschichte und der Kunst-
betrachtung« schreiben (I, 7). Respektvoll sondert er sein Dürerbuch von den be-
deutenden wissenschaftlichen Arbeiten über Dürer ab. Er denkt an »nichtwissen:
schaftliche« Leser und will für sie schreiben. Nicht einen Beitrag zur Forschung
soll sein Buch bringen. Deswegen soll es aber doch nicht eines höher liegenden
Zieles entbehren. Der Verfasser möchte zu weiterer Beschäftigung mit der Kunst
Dürers anregen. Dabei ist er von dem Gedanken geleitet: »Jede Generation sieht
ihren Dürer anders, und unsere, glaube ich, sieht ihn noch zu wenig« (I, 8).
Waldmann anerkennt also den Wechsel in der Auffassung der (historisch ge-
wordenen) Kunst als Tatsache und sieht in ihr die Auswirkung einer kulturellen
Norm. Man kann und wird sofort zwischen Kunstwissenschaft und Kunstgenuß
unterscheiden, um den »Wechsel in der Auffassung« mit seinen Voraussetzungen
und mit seinen Folgerungen nicht in die Wissenschaft hineinzutragen: um nicht,
konkret gesprochen, Dürer und seine Kunst aus dem lebendigen Kulturzusammen-
durch das Mittel unseres eigenen Seelenlebens. Die verwickelten Beziehungen, die
so entstehen, analysiert Spranger in einigen Hauptzügen. Gegen Max Scheler hält
Spranger daran fest, daß fremdes Seelenleben uns nicht unmittelbar zugänglich ist,
während wir allerdings Geistiges unmittelbar erfassen (378 Anm.). Die Psychologie
muß, um objektiv zu werden, stets an etwas Objektives anknüpfen, und zwar, wenn
sie geisteswissenschaftliche Psychologie sein will, an eines der Wertgebiete.
Freiburg i. Br.
Jonas Cohn.
Emil Utiiz, Professor an der Universität Rostock, Die Gegenständlichkeit
des Kunstwerks. Philosophische Vorträge der Kantgesellschaft, Nr. 17,
Berlin 1917, 71 S.
Der Verfasser schickt dem zweiten Bande seiner »Grundlegung der allgemeinen
Kunstwissenschaft« eine kleine Schrift voraus, die das Programm und die Gliede-
rung jener größeren, vom Kriege verzögerten Arbeit zu enthalten scheint. Er richtet
sich auf die allgemeine, sinnliche und geistige Substanz des Kunstwerks, mit der
es erst die Lebensmöglichkeit in der künstlerischen Sphäre gewinnt, also auf seine
Gegenständlichkeit. Nach den materiellen Grundlagen wird in den Abschnitten
über die Seinsschicht, das Kunstverhalten und die Darstellungsweise, den — for-
malen und intellektuellen — Darstellungswert der Kreis von bindenden Voraus-
setzungen aufgesucht, von dem der zeitliche Stilzwang und die persönliche Voll-
bringung ihren Ausgang nehmen, nehmen müssen. Man wird hierdurch einer Reihe
von primären Werknotwendigkeiten zugeführt, die jetzt auch eine zum Begrifflichen
erweiterte historische Kunstforschung beschäftigen. Und diese unabhängige Be-
gegnung zweier bisher neben- und gegeneinander arbeitender wissenschaftlicher
Richtungen eröffnet die erfreulichste Aussicht auf eine besonders fruchtbare Wirkung
des Hauptwerkes von Utitz, dessen baldiges Erscheinen man nach diesem viel-
versprechenden Entwurf nur aufrichtig wünschen kann. Damit wäre dann auch die
bessere Gelegenheit gegeben, sich dem mannigfaltigen und neuartigen Gedanken-
stoff des Verfassers eingehend zu widmen.
Wien. Max Eisler.
E. Waldmann, Albrecht Dürer. 1. und 2. Bd., 94 und 92 S. Mit je 80 Voll-
bildern. Inselverlag, Leipzig 1916 und 1917.
Waldmann wollte »ein einfaches und schlichtes Buch über Albrecht Dürer für
heutige Bedürfnisse ... mit klarer Trennung der Lebensgeschichte und der Kunst-
betrachtung« schreiben (I, 7). Respektvoll sondert er sein Dürerbuch von den be-
deutenden wissenschaftlichen Arbeiten über Dürer ab. Er denkt an »nichtwissen:
schaftliche« Leser und will für sie schreiben. Nicht einen Beitrag zur Forschung
soll sein Buch bringen. Deswegen soll es aber doch nicht eines höher liegenden
Zieles entbehren. Der Verfasser möchte zu weiterer Beschäftigung mit der Kunst
Dürers anregen. Dabei ist er von dem Gedanken geleitet: »Jede Generation sieht
ihren Dürer anders, und unsere, glaube ich, sieht ihn noch zu wenig« (I, 8).
Waldmann anerkennt also den Wechsel in der Auffassung der (historisch ge-
wordenen) Kunst als Tatsache und sieht in ihr die Auswirkung einer kulturellen
Norm. Man kann und wird sofort zwischen Kunstwissenschaft und Kunstgenuß
unterscheiden, um den »Wechsel in der Auffassung« mit seinen Voraussetzungen
und mit seinen Folgerungen nicht in die Wissenschaft hineinzutragen: um nicht,
konkret gesprochen, Dürer und seine Kunst aus dem lebendigen Kulturzusammen-