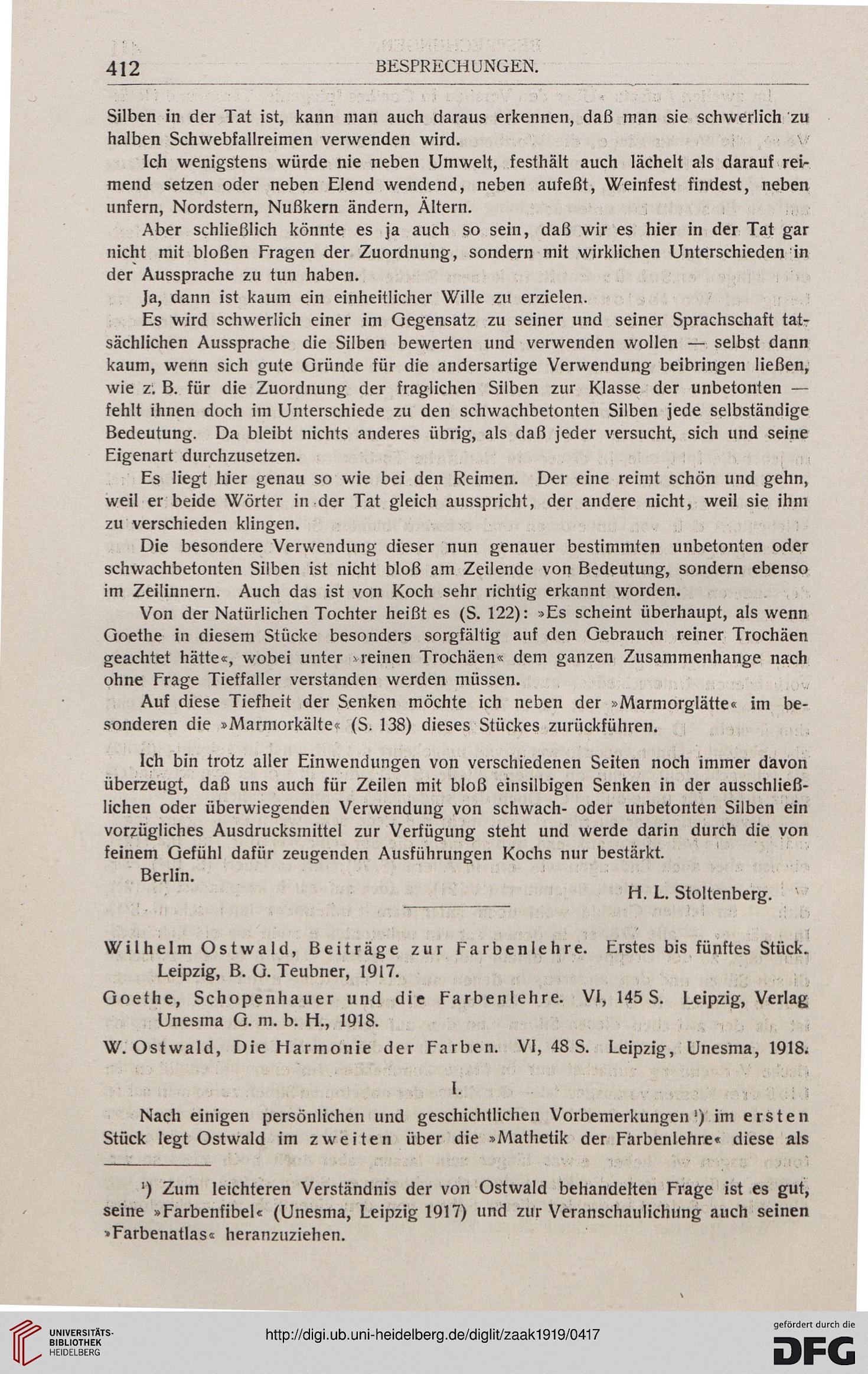412 BESPRECHUNGEN.
Silben in der Tat ist, kann man auch daraus erkennen, daß man sie schwerlich zu
halben Schwebfallreimen verwenden wird.
Ich wenigstens würde nie neben Umwelt, festhält auch lächelt als darauf rei-
mend setzen oder neben Elend wendend, neben aufeßt, Weinfest findest, neben
unfern, Nordstern, Nußkern ändern, Altern.
Aber schließlich könnte es ja auch so sein, daß wir es hier in der Tat gar
nicht mit bloßen Fragen der Zuordnung, sondern mit wirklichen Unterschieden in
der Aussprache zu tun haben.
Ja, dann ist kaum ein einheitlicher Wille zu erzielen.
Es wird schwerlich einer im Gegensatz zu seiner und seiner Sprachschaft tat-
sächlichen Aussprache die Silben bewerten und verwenden wollen — selbst dann
kaum, wenn sich gute Gründe für die andersartige Verwendung beibringen ließen,
wie z. B. für die Zuordnung der fraglichen Silben zur Klasse der unbetonten —
fehlt ihnen doch im Unterschiede zu den schwachbetonten Silben jede selbständige
Bedeutung. Da bleibt nichts anderes übrig, als daß jeder versucht, sich und seine
Eigenart durchzusetzen.
Es liegt hier genau so wie bei den Reimen. Der eine reimt schön und gehn,
weil er beide Wörter in der Tat gleich ausspricht, der andere nicht, weil sie ihm
zu verschieden klingen.
Die besondere Verwendung dieser nun genauer bestimmten unbetonten oder
schwachbetonten Silben ist nicht bloß am Zeilende von Bedeutung, sondern ebenso
im Zeilinnern. Auch das ist von Koch sehr richtig erkannt worden.
Von der Natürlichen Tochter heißt es (S. 122): »Es scheint überhaupt, als wenn
Goethe in diesem Stücke besonders sorgfältig auf den Gebrauch reiner Trochäen
geachtet hätte«, wobei unter * reinen Trochäen« dem ganzen Zusammenhange nach
ohne Frage Tieffaller verstanden werden müssen.
Auf diese Tiefheit der Senken möchte ich neben der »Marmorglätte« im be-
sonderen die »Marmorkälte« (S. 138) dieses Stückes zurückführen.
Ich bin trotz aller Einwendungen von verschiedenen Seiten noch immer davon
überzeugt, daß uns auch für Zeilen mit bloß einsilbigen Senken in der ausschließ-
lichen oder überwiegenden Verwendung von schwach- oder unbetonten Silben ein
vorzügliches Ausdrucksrnittel zur Verfügung steht und werde darin durch die von
feinem Gefühl dafür zeugenden Ausführungen Kochs nur bestärkt.
Berlin.
H. L. Stoltenberg.
Wilhelm Ostwald, Beiträge zur Farbenlehre. Erstes bis fünftes Stück.
Leipzig, B. G. Teubner, 1917.
Goethe, Schopenhauer und die Farbenlehre. VI, 145 S. Leipzig, Verlag
Unesma G. m. b. FL, 1918.
W. Ostwald, Die Harmonie der Farben. VI, 48 S. Leipzig, Unesma, 1918;
h
Nach einigen persönlichen und geschichtlichen Vorbemerkungen1) im ersten
Stück legt Ostwald im zweiten über die »Mathetik der Färbenlehre« diese als
') Zum leichteren Verständnis der von Ostwald behandelten Frage ist es gut,
seine »Farbenfibel« (Unesma, Leipzig 1917) und zur Veranschaulichung auch seinen
»Farbenatlas« heranzuziehen.
Silben in der Tat ist, kann man auch daraus erkennen, daß man sie schwerlich zu
halben Schwebfallreimen verwenden wird.
Ich wenigstens würde nie neben Umwelt, festhält auch lächelt als darauf rei-
mend setzen oder neben Elend wendend, neben aufeßt, Weinfest findest, neben
unfern, Nordstern, Nußkern ändern, Altern.
Aber schließlich könnte es ja auch so sein, daß wir es hier in der Tat gar
nicht mit bloßen Fragen der Zuordnung, sondern mit wirklichen Unterschieden in
der Aussprache zu tun haben.
Ja, dann ist kaum ein einheitlicher Wille zu erzielen.
Es wird schwerlich einer im Gegensatz zu seiner und seiner Sprachschaft tat-
sächlichen Aussprache die Silben bewerten und verwenden wollen — selbst dann
kaum, wenn sich gute Gründe für die andersartige Verwendung beibringen ließen,
wie z. B. für die Zuordnung der fraglichen Silben zur Klasse der unbetonten —
fehlt ihnen doch im Unterschiede zu den schwachbetonten Silben jede selbständige
Bedeutung. Da bleibt nichts anderes übrig, als daß jeder versucht, sich und seine
Eigenart durchzusetzen.
Es liegt hier genau so wie bei den Reimen. Der eine reimt schön und gehn,
weil er beide Wörter in der Tat gleich ausspricht, der andere nicht, weil sie ihm
zu verschieden klingen.
Die besondere Verwendung dieser nun genauer bestimmten unbetonten oder
schwachbetonten Silben ist nicht bloß am Zeilende von Bedeutung, sondern ebenso
im Zeilinnern. Auch das ist von Koch sehr richtig erkannt worden.
Von der Natürlichen Tochter heißt es (S. 122): »Es scheint überhaupt, als wenn
Goethe in diesem Stücke besonders sorgfältig auf den Gebrauch reiner Trochäen
geachtet hätte«, wobei unter * reinen Trochäen« dem ganzen Zusammenhange nach
ohne Frage Tieffaller verstanden werden müssen.
Auf diese Tiefheit der Senken möchte ich neben der »Marmorglätte« im be-
sonderen die »Marmorkälte« (S. 138) dieses Stückes zurückführen.
Ich bin trotz aller Einwendungen von verschiedenen Seiten noch immer davon
überzeugt, daß uns auch für Zeilen mit bloß einsilbigen Senken in der ausschließ-
lichen oder überwiegenden Verwendung von schwach- oder unbetonten Silben ein
vorzügliches Ausdrucksrnittel zur Verfügung steht und werde darin durch die von
feinem Gefühl dafür zeugenden Ausführungen Kochs nur bestärkt.
Berlin.
H. L. Stoltenberg.
Wilhelm Ostwald, Beiträge zur Farbenlehre. Erstes bis fünftes Stück.
Leipzig, B. G. Teubner, 1917.
Goethe, Schopenhauer und die Farbenlehre. VI, 145 S. Leipzig, Verlag
Unesma G. m. b. FL, 1918.
W. Ostwald, Die Harmonie der Farben. VI, 48 S. Leipzig, Unesma, 1918;
h
Nach einigen persönlichen und geschichtlichen Vorbemerkungen1) im ersten
Stück legt Ostwald im zweiten über die »Mathetik der Färbenlehre« diese als
') Zum leichteren Verständnis der von Ostwald behandelten Frage ist es gut,
seine »Farbenfibel« (Unesma, Leipzig 1917) und zur Veranschaulichung auch seinen
»Farbenatlas« heranzuziehen.