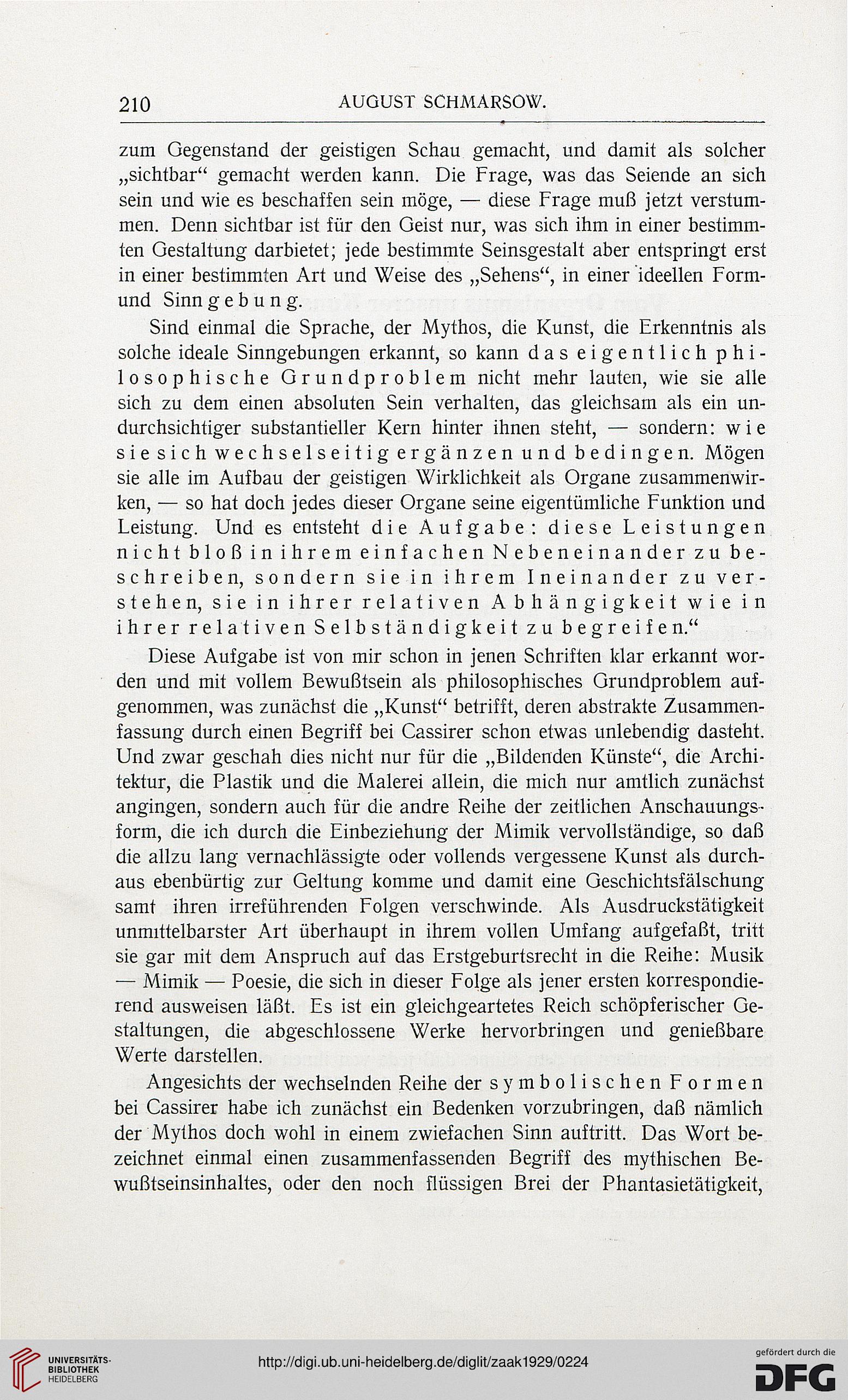210
AUGUST SCHMARSOW.
zum Gegenstand der geistigen Schau gemacht, und damit als solcher
„sichtbar" gemacht werden kann. Die Frage, was das Seiende an sich
sein und wie es beschaffen sein möge, — diese Frage muß jetzt verstum-
men. Denn sichtbar ist für den Geist nur, was sich ihm in einer bestimm-
ten Gestaltung darbietet; jede bestimmte Seinsgestalt aber entspringt erst
in einer bestimmten Art und Weise des „Sehens", in einer ideellen Form-
und Sinn g e b u n g.
Sind einmal die Sprache, der Mythos, die Kunst, die Erkenntnis als
solche ideale Sinngebungen erkannt, so kann das eigentlich phi-
losophische Grundproblem nicht mehr lauten, wie sie alle
sich zu dem einen absoluten Sein verhalten, das gleichsam als ein un-
durchsichtiger substantieller Kern hinter ihnen steht, — sondern: wie
sie sich wechselseitig ergänzen und bedingen. Mögen
sie alle im Aufbau der geistigen Wirklichkeit als Organe zusammenwir-
ken, — so hat doch jedes dieser Organe seine eigentümliche Funktion und
Leistung. Und es entsteht die Aufgabe: diese Leistungen
nicht bloß in ihrem einfachen Nebeneinander zu be-
schreiben, sondern sie in ihrem Ineinander zu ver-
stehen, sie in ihrer relativen Abhängigkeit wie in
ihrer relativen Selbständigkeit zu begreife n."
Diese Aufgabe ist von mir schon in jenen Schriften klar erkannt wor-
den und mit vollem Bewußtsein als philosophisches Grundproblem auf-
genommen, was zunächst die „Kunst" betrifft, deren abstrakte Zusammen-
fassung durch einen Begriff bei Cassirer schon etwas unlebendig dasteht.
Und zwar geschah dies nicht nur für die „Bildenden Künste", die Archi-
tektur, die Plastik und die Malerei allein, die mich nur amtlich zunächst
angingen, sondern auch für die andre Reihe der zeitlichen Anschauungs-
form, die ich durch die Einbeziehung der Mimik vervollständige, so daß
die allzu lang vernachlässigte oder vollends vergessene Kunst als durch-
aus ebenbürtig zur Geltung komme und damit eine Geschichtsfälschung
samt ihren irreführenden Folgen verschwinde. Als Ausdruckstätigkeit
unmittelbarster Art überhaupt in ihrem vollen Umfang aufgefaßt, tritt
sie gar mit dem Anspruch auf das Erstgeburtsrecht in die Reihe: Musik
— Mimik — Poesie, die sich in dieser Folge als jener ersten korrespondie-
rend ausweisen läßt. Es ist ein gleichgeartetes Reich schöpferischer Ge-
staltungen, die abgeschlossene Werke hervorbringen und genießbare
Werte darstellen.
Angesichts der wechselnden Reihe der symbolischen Formen
bei Cassirer habe ich zunächst ein Bedenken vorzubringen, daß nämlich
der Mythos doch wohl in einem zwiefachen Sinn auftritt. Das Wort be-
zeichnet einmal einen zusammenfassenden Begriff des mythischen Be-
wußtseinsinhaltes, oder den noch flüssigen Brei der Phantasietätigkeit,
AUGUST SCHMARSOW.
zum Gegenstand der geistigen Schau gemacht, und damit als solcher
„sichtbar" gemacht werden kann. Die Frage, was das Seiende an sich
sein und wie es beschaffen sein möge, — diese Frage muß jetzt verstum-
men. Denn sichtbar ist für den Geist nur, was sich ihm in einer bestimm-
ten Gestaltung darbietet; jede bestimmte Seinsgestalt aber entspringt erst
in einer bestimmten Art und Weise des „Sehens", in einer ideellen Form-
und Sinn g e b u n g.
Sind einmal die Sprache, der Mythos, die Kunst, die Erkenntnis als
solche ideale Sinngebungen erkannt, so kann das eigentlich phi-
losophische Grundproblem nicht mehr lauten, wie sie alle
sich zu dem einen absoluten Sein verhalten, das gleichsam als ein un-
durchsichtiger substantieller Kern hinter ihnen steht, — sondern: wie
sie sich wechselseitig ergänzen und bedingen. Mögen
sie alle im Aufbau der geistigen Wirklichkeit als Organe zusammenwir-
ken, — so hat doch jedes dieser Organe seine eigentümliche Funktion und
Leistung. Und es entsteht die Aufgabe: diese Leistungen
nicht bloß in ihrem einfachen Nebeneinander zu be-
schreiben, sondern sie in ihrem Ineinander zu ver-
stehen, sie in ihrer relativen Abhängigkeit wie in
ihrer relativen Selbständigkeit zu begreife n."
Diese Aufgabe ist von mir schon in jenen Schriften klar erkannt wor-
den und mit vollem Bewußtsein als philosophisches Grundproblem auf-
genommen, was zunächst die „Kunst" betrifft, deren abstrakte Zusammen-
fassung durch einen Begriff bei Cassirer schon etwas unlebendig dasteht.
Und zwar geschah dies nicht nur für die „Bildenden Künste", die Archi-
tektur, die Plastik und die Malerei allein, die mich nur amtlich zunächst
angingen, sondern auch für die andre Reihe der zeitlichen Anschauungs-
form, die ich durch die Einbeziehung der Mimik vervollständige, so daß
die allzu lang vernachlässigte oder vollends vergessene Kunst als durch-
aus ebenbürtig zur Geltung komme und damit eine Geschichtsfälschung
samt ihren irreführenden Folgen verschwinde. Als Ausdruckstätigkeit
unmittelbarster Art überhaupt in ihrem vollen Umfang aufgefaßt, tritt
sie gar mit dem Anspruch auf das Erstgeburtsrecht in die Reihe: Musik
— Mimik — Poesie, die sich in dieser Folge als jener ersten korrespondie-
rend ausweisen läßt. Es ist ein gleichgeartetes Reich schöpferischer Ge-
staltungen, die abgeschlossene Werke hervorbringen und genießbare
Werte darstellen.
Angesichts der wechselnden Reihe der symbolischen Formen
bei Cassirer habe ich zunächst ein Bedenken vorzubringen, daß nämlich
der Mythos doch wohl in einem zwiefachen Sinn auftritt. Das Wort be-
zeichnet einmal einen zusammenfassenden Begriff des mythischen Be-
wußtseinsinhaltes, oder den noch flüssigen Brei der Phantasietätigkeit,