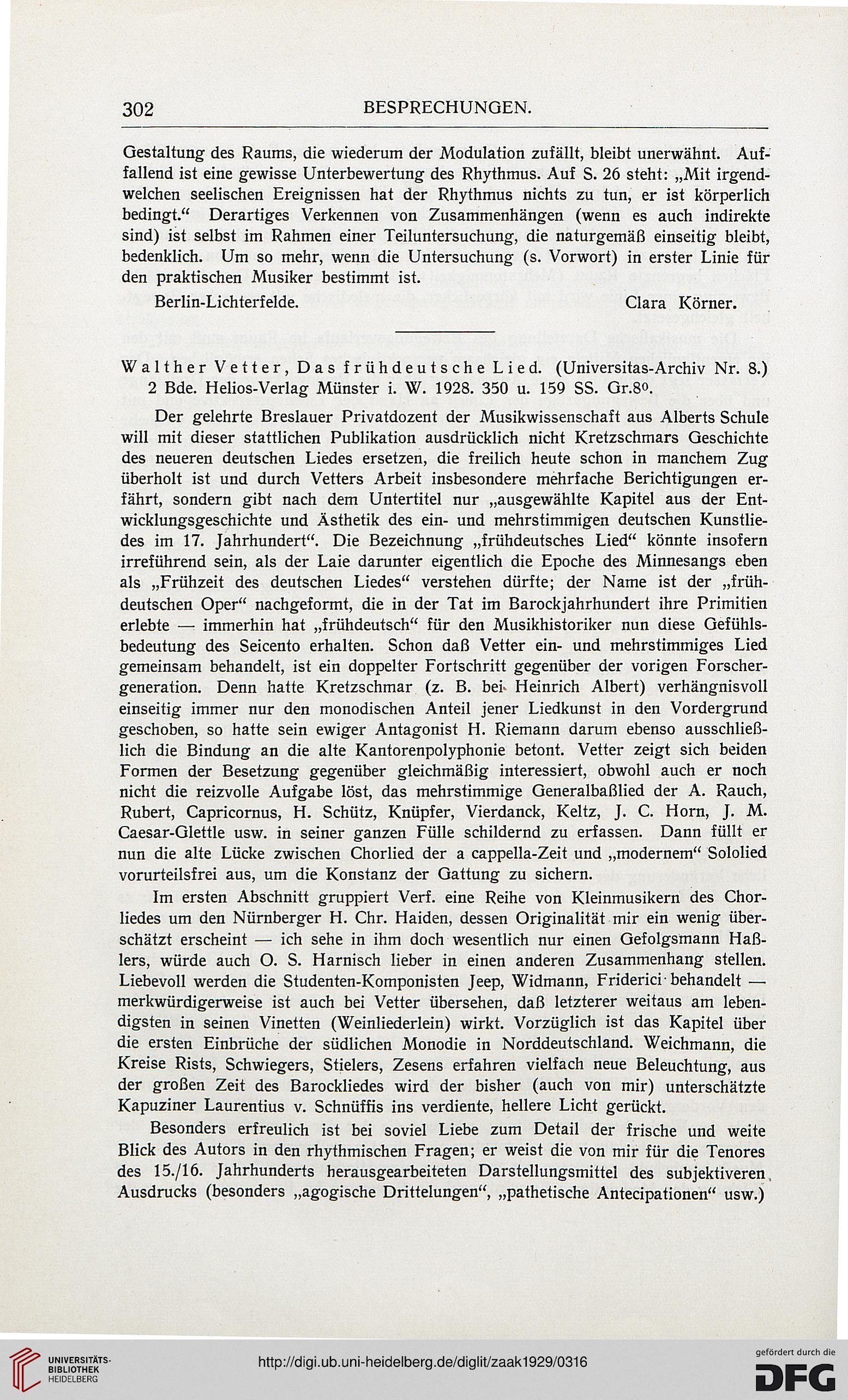302
BESPRECHUNGEN.
Gestaltung des Raums, die wiederum der Modulation zufällt, bleibt unerwähnt. Auf-
fallend ist eine gewisse Unterbewertung des Rhythmus. Auf S. 26 steht: „Mit irgend-
welchen seelischen Ereignissen hat der Rhythmus nichts zu tun, er ist körperlich
bedingt." Derartiges Verkennen von Zusammenhängen (wenn es auch indirekte
sind) ist selbst im Rahmen einer Teiluntersuchung, die naturgemäß einseitig bleibt,
bedenklich. Um so mehr, wenn die Untersuchung (s. Vorwort) in erster Linie für
den praktischen Musiker bestimmt ist.
Berlin-Lichterfelde. Clara Körner.
Walther Vetter, Das frühdeutsche Lied. (Universitas-Archiv Nr. 8.)
2 Bde. Helios-Verlag Münster i. W. 1928. 350 u. 159 SS. Gr.8o.
Der gelehrte Breslauer Privatdozent der Musikwissenschaft aus Alberts Schule
will mit dieser stattlichen Publikation ausdrücklich nicht Kretzschmars Geschichte
des neueren deutschen Liedes ersetzen, die freilich heute schon in manchem Zug
überholt ist und durch Vetters Arbeit insbesondere mehrfache Berichtigungen er-
fährt, sondern gibt nach dem Untertitel nur „ausgewählte Kapitel aus der Ent-
wicklungsgeschichte und Ästhetik des ein- und mehrstimmigen deutschen Kunstlie-
des im 17. Jahrhundert". Die Bezeichnung „frühdeutsches Lied" könnte insofern
irreführend sein, als der Laie darunter eigentlich die Epoche des Minnesangs eben
als „Frühzeit des deutschen Liedes" verstehen dürfte; der Name ist der „früh-
deutschen Oper" nachgeformt, die in der Tat im Barockjahrhundert ihre Primitien
erlebte — immerhin hat „frühdeutsch" für den Musikhistoriker nun diese Gefühls-
bedeutung des Seicento erhalten. Schon daß Vetter ein- und mehrstimmiges Lied
gemeinsam behandelt, ist ein doppelter Fortschritt gegenüber der vorigen Forscher-
generation. Denn hatte Kretzschmar (z. B. bei- Heinrich Albert) verhängnisvoll
einseitig immer nur den monodischen Anteil jener Liedkunst in den Vordergrund
geschoben, so hatte sein ewiger Antagonist H. Riemann darum ebenso ausschließ-
lich die Bindung an die alte Kantorenpolyphonie betont. Vetter zeigt sich beiden
Formen der Besetzung gegenüber gleichmäßig interessiert, obwohl auch er noch
nicht die reizvolle Aufgabe löst, das mehrstimmige Generalbaßlied der A. Rauch,
Rubert, Capricornus, H. Schütz, Knüpfer, Vierdanck, Keltz, J. C. Horn, J. M.
Caesar-Glettle usw. in seiner ganzen Fülle schildernd zu erfassen. Dann füllt er
nun die alte Lücke zwischen Chorlied der a cappella-Zeit und „modernem" Sololied
vorurteilsfrei aus, um die Konstanz der Gattung zu sichern.
Im ersten Abschnitt gruppiert Verf. eine Reihe von Kleinmusikern des Chor-
liedes um den Nürnberger H. Chr. Haiden, dessen Originalität mir ein wenig über-
schätzt erscheint — ich sehe in ihm doch wesentlich nur einen Gefolgsmann Haß-
lers, würde auch O. S. Harnisch lieber in einen anderen Zusammenhang stellen.
Liebevoll werden die Studenten-Komponisten Jeep, Widmann, Fridericr behandelt —
merkwürdigerweise ist auch bei Vetter übersehen, daß letzterer weitaus am leben-
digsten in seinen Vinetten (Weinliederlein) wirkt. Vorzüglich ist das Kapitel über
die ersten Einbrüche der südlichen Monodie in Norddeutschland. Weichmann, die
Kreise Rists, Schwiegers, Stielers, Zesens erfahren vielfach neue Beleuchtung, aus
der großen Zeit des Barockliedes wird der bisher (auch von mir) unterschätzte
Kapuziner Laurentius v. Schnüffis ins verdiente, hellere Licht gerückt.
Besonders erfreulich ist bei soviel Liebe zum Detail der frische und weite
Blick des Autors in den rhythmischen Fragen; er weist die von mir für die Tenores
des 15./16. Jahrhunderts herausgearbeiteten Darstellungsmittel des subjektiveren
Ausdrucks (besonders „agogische Drittelungen", „pathetische Antecipationen" usw.)
BESPRECHUNGEN.
Gestaltung des Raums, die wiederum der Modulation zufällt, bleibt unerwähnt. Auf-
fallend ist eine gewisse Unterbewertung des Rhythmus. Auf S. 26 steht: „Mit irgend-
welchen seelischen Ereignissen hat der Rhythmus nichts zu tun, er ist körperlich
bedingt." Derartiges Verkennen von Zusammenhängen (wenn es auch indirekte
sind) ist selbst im Rahmen einer Teiluntersuchung, die naturgemäß einseitig bleibt,
bedenklich. Um so mehr, wenn die Untersuchung (s. Vorwort) in erster Linie für
den praktischen Musiker bestimmt ist.
Berlin-Lichterfelde. Clara Körner.
Walther Vetter, Das frühdeutsche Lied. (Universitas-Archiv Nr. 8.)
2 Bde. Helios-Verlag Münster i. W. 1928. 350 u. 159 SS. Gr.8o.
Der gelehrte Breslauer Privatdozent der Musikwissenschaft aus Alberts Schule
will mit dieser stattlichen Publikation ausdrücklich nicht Kretzschmars Geschichte
des neueren deutschen Liedes ersetzen, die freilich heute schon in manchem Zug
überholt ist und durch Vetters Arbeit insbesondere mehrfache Berichtigungen er-
fährt, sondern gibt nach dem Untertitel nur „ausgewählte Kapitel aus der Ent-
wicklungsgeschichte und Ästhetik des ein- und mehrstimmigen deutschen Kunstlie-
des im 17. Jahrhundert". Die Bezeichnung „frühdeutsches Lied" könnte insofern
irreführend sein, als der Laie darunter eigentlich die Epoche des Minnesangs eben
als „Frühzeit des deutschen Liedes" verstehen dürfte; der Name ist der „früh-
deutschen Oper" nachgeformt, die in der Tat im Barockjahrhundert ihre Primitien
erlebte — immerhin hat „frühdeutsch" für den Musikhistoriker nun diese Gefühls-
bedeutung des Seicento erhalten. Schon daß Vetter ein- und mehrstimmiges Lied
gemeinsam behandelt, ist ein doppelter Fortschritt gegenüber der vorigen Forscher-
generation. Denn hatte Kretzschmar (z. B. bei- Heinrich Albert) verhängnisvoll
einseitig immer nur den monodischen Anteil jener Liedkunst in den Vordergrund
geschoben, so hatte sein ewiger Antagonist H. Riemann darum ebenso ausschließ-
lich die Bindung an die alte Kantorenpolyphonie betont. Vetter zeigt sich beiden
Formen der Besetzung gegenüber gleichmäßig interessiert, obwohl auch er noch
nicht die reizvolle Aufgabe löst, das mehrstimmige Generalbaßlied der A. Rauch,
Rubert, Capricornus, H. Schütz, Knüpfer, Vierdanck, Keltz, J. C. Horn, J. M.
Caesar-Glettle usw. in seiner ganzen Fülle schildernd zu erfassen. Dann füllt er
nun die alte Lücke zwischen Chorlied der a cappella-Zeit und „modernem" Sololied
vorurteilsfrei aus, um die Konstanz der Gattung zu sichern.
Im ersten Abschnitt gruppiert Verf. eine Reihe von Kleinmusikern des Chor-
liedes um den Nürnberger H. Chr. Haiden, dessen Originalität mir ein wenig über-
schätzt erscheint — ich sehe in ihm doch wesentlich nur einen Gefolgsmann Haß-
lers, würde auch O. S. Harnisch lieber in einen anderen Zusammenhang stellen.
Liebevoll werden die Studenten-Komponisten Jeep, Widmann, Fridericr behandelt —
merkwürdigerweise ist auch bei Vetter übersehen, daß letzterer weitaus am leben-
digsten in seinen Vinetten (Weinliederlein) wirkt. Vorzüglich ist das Kapitel über
die ersten Einbrüche der südlichen Monodie in Norddeutschland. Weichmann, die
Kreise Rists, Schwiegers, Stielers, Zesens erfahren vielfach neue Beleuchtung, aus
der großen Zeit des Barockliedes wird der bisher (auch von mir) unterschätzte
Kapuziner Laurentius v. Schnüffis ins verdiente, hellere Licht gerückt.
Besonders erfreulich ist bei soviel Liebe zum Detail der frische und weite
Blick des Autors in den rhythmischen Fragen; er weist die von mir für die Tenores
des 15./16. Jahrhunderts herausgearbeiteten Darstellungsmittel des subjektiveren
Ausdrucks (besonders „agogische Drittelungen", „pathetische Antecipationen" usw.)