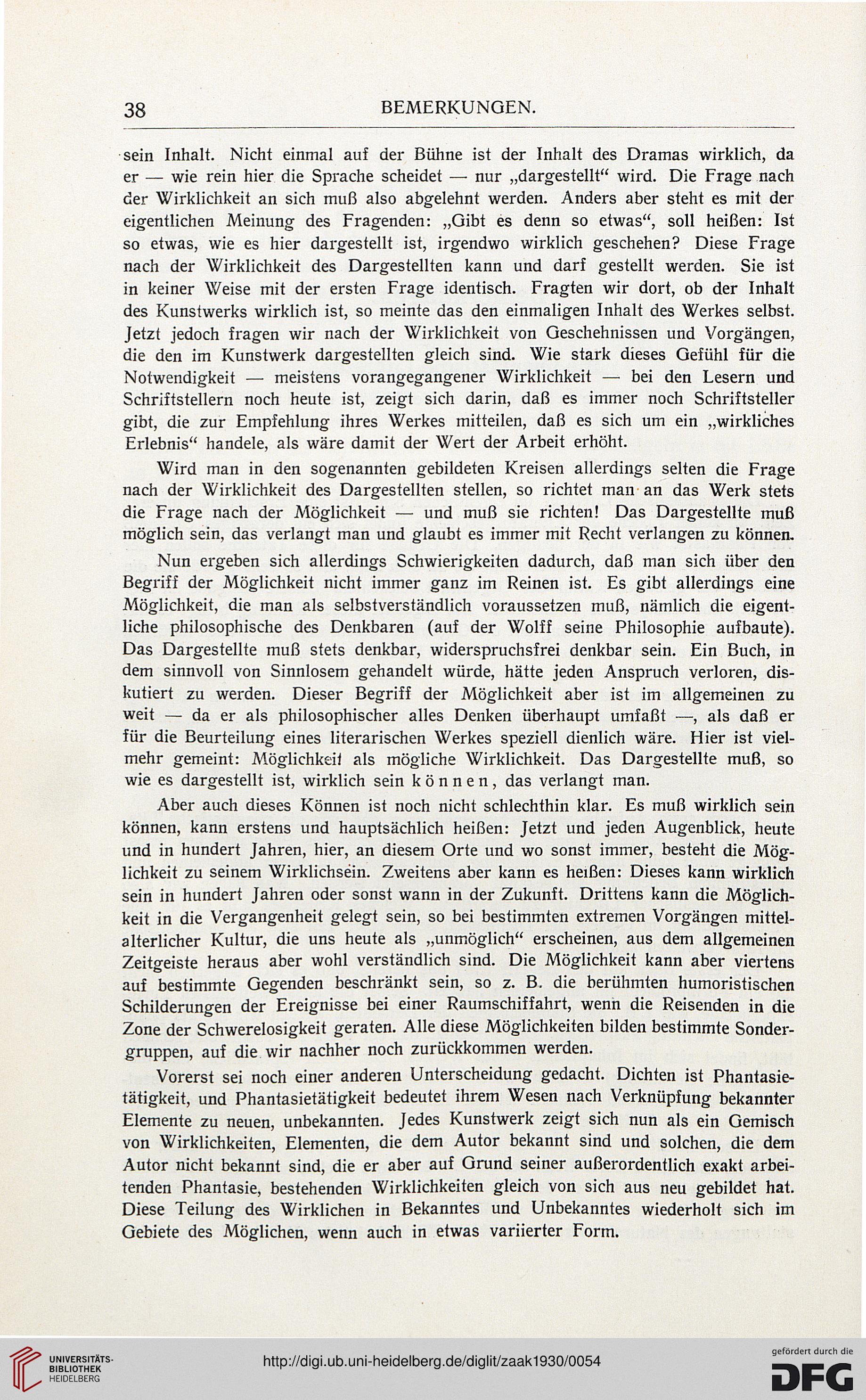38
BEMERKUNGEN.
sein Inhalt. Nicht einmal auf der Bühne ist der Inhalt des Dramas wirklich, da
er — wie rein hier die Sprache scheidet — nur „dargestellt" wird. Die Frage nach
der Wirklichkeit an sich muß also abgelehnt werden. Anders aber steht es mit der
eigentlichen Meinung des Fragenden: „Gibt es denn so etwas", soll heißen: Ist
so etwas, wie es hier dargestellt ist, irgendwo wirklich geschehen? Diese Frage
nach der Wirklichkeit des Dargestellten kann und darf gestellt werden. Sie ist
in keiner Weise mit der ersten Frage identisch. Fragten wir dort, ob der Inhalt
des Kunstwerks wirklich ist, so meinte das den einmaligen Inhalt des Werkes selbst.
Jetzt jedoch fragen wir nach der Wirklichkeit von Geschehnissen und Vorgängen,
die den im Kunstwerk dargestellten gleich sind. Wie stark dieses Gefühl für die
Notwendigkeit — meistens vorangegangener Wirklichkeit — bei den Lesern und
Schriftstellern noch heute ist, zeigt sich darin, daß es immer noch Schriftsteller
gibt, die zur Empfehlung ihres Werkes mitteilen, daß es sich um ein „wirkliches
Erlebnis" handele, als wäre damit der Wert der Arbeit erhöht.
Wird man in den sogenannten gebildeten Kreisen allerdings selten die Frage
nach der Wirklichkeit des Dargestellten stellen, so richtet man an das Werk stets
die Frage nach der Möglichkeit — und muß sie richten! Das Dargestellte muß
möglich sein, das verlangt man und glaubt es immer mit Recht verlangen zu können.
Nun ergeben sich allerdings Schwierigkeiten dadurch, daß man sich über den
Begriff der Möglichkeit nicht immer ganz im Reinen ist. Es gibt allerdings eine
Möglichkeit, die man als selbstverständlich voraussetzen muß, nämlich die eigent-
liche philosophische des Denkbaren (auf der Wolff seine Philosophie aufbaute).
Das Dargestellte muß stets denkbar, widerspruchsfrei denkbar sein. Ein Buch, in
dem sinnvoll von Sinnlosem gehandelt würde, hätte jeden Anspruch verloren, dis-
kutiert zu werden. Dieser Begriff der Möglichkeit aber ist im allgemeinen zu
weit — da er als philosophischer alles Denken überhaupt umfaßt —, als daß er
für die Beurteilung eines literarischen Werkes speziell dienlich wäre. Hier ist viel-
mehr gemeint: Möglichkeii als mögliche Wirklichkeit. Das Dargestellte muß, so
wie es dargestellt ist, wirklich sein können, das verlangt man.
Aber auch dieses Können ist noch nicht schlechthin klar. Es muß wirklich sein
können, kann erstens und hauptsächlich heißen: Jetzt und jeden Augenblick, heute
und in hundert Jahren, hier, an diesem Orte und wo sonst immer, besteht die Mög-
lichkeit zu seinem Wirklichsein. Zweitens aber kann es heißen: Dieses kann wirklich
sein in hundert Jahren oder sonst wann in der Zukunft. Drittens kann die Möglich-
keit in die Vergangenheit gelegt sein, so bei bestimmten extremen Vorgängen mittel-
alterlicher Kultur, die uns heute als „unmöglich" erscheinen, aus dem allgemeinen
Zeitgeiste heraus aber wohl verständlich sind. Die Möglichkeit kann aber viertens
auf bestimmte Gegenden beschränkt sein, so z. B. die berühmten humoristischen
Schilderungen der Ereignisse bei einer Raumschiffahrt, wenn die Reisenden in die
Zone der Schwerelosigkeit geraten. Alle diese Möglichkeiten bilden bestimmte Sonder-
gruppen, auf die wir nachher noch zurückkommen werden.
Vorerst sei noch einer anderen Unterscheidung gedacht. Dichten ist Phantasie-
tätigkeit, und Phantasietätigkeit bedeutet ihrem Wesen nach Verknüpfung bekannter
Elemente zu neuen, unbekannten. Jedes Kunstwerk zeigt sich nun als ein Gemisch
von Wirklichkeiten, Elementen, die dem Autor bekannt sind und solchen, die dem
Autor nicht bekannt sind, die er aber auf Grund seiner außerordentlich exakt arbei-
tenden Phantasie, bestehenden Wirklichkeiten gleich von sich aus neu gebildet hat.
Diese Teilung des Wirklichen in Bekanntes und Unbekanntes wiederholt sich im
Gebiete des Möglichen, wenn auch in etwas variierter Form.
BEMERKUNGEN.
sein Inhalt. Nicht einmal auf der Bühne ist der Inhalt des Dramas wirklich, da
er — wie rein hier die Sprache scheidet — nur „dargestellt" wird. Die Frage nach
der Wirklichkeit an sich muß also abgelehnt werden. Anders aber steht es mit der
eigentlichen Meinung des Fragenden: „Gibt es denn so etwas", soll heißen: Ist
so etwas, wie es hier dargestellt ist, irgendwo wirklich geschehen? Diese Frage
nach der Wirklichkeit des Dargestellten kann und darf gestellt werden. Sie ist
in keiner Weise mit der ersten Frage identisch. Fragten wir dort, ob der Inhalt
des Kunstwerks wirklich ist, so meinte das den einmaligen Inhalt des Werkes selbst.
Jetzt jedoch fragen wir nach der Wirklichkeit von Geschehnissen und Vorgängen,
die den im Kunstwerk dargestellten gleich sind. Wie stark dieses Gefühl für die
Notwendigkeit — meistens vorangegangener Wirklichkeit — bei den Lesern und
Schriftstellern noch heute ist, zeigt sich darin, daß es immer noch Schriftsteller
gibt, die zur Empfehlung ihres Werkes mitteilen, daß es sich um ein „wirkliches
Erlebnis" handele, als wäre damit der Wert der Arbeit erhöht.
Wird man in den sogenannten gebildeten Kreisen allerdings selten die Frage
nach der Wirklichkeit des Dargestellten stellen, so richtet man an das Werk stets
die Frage nach der Möglichkeit — und muß sie richten! Das Dargestellte muß
möglich sein, das verlangt man und glaubt es immer mit Recht verlangen zu können.
Nun ergeben sich allerdings Schwierigkeiten dadurch, daß man sich über den
Begriff der Möglichkeit nicht immer ganz im Reinen ist. Es gibt allerdings eine
Möglichkeit, die man als selbstverständlich voraussetzen muß, nämlich die eigent-
liche philosophische des Denkbaren (auf der Wolff seine Philosophie aufbaute).
Das Dargestellte muß stets denkbar, widerspruchsfrei denkbar sein. Ein Buch, in
dem sinnvoll von Sinnlosem gehandelt würde, hätte jeden Anspruch verloren, dis-
kutiert zu werden. Dieser Begriff der Möglichkeit aber ist im allgemeinen zu
weit — da er als philosophischer alles Denken überhaupt umfaßt —, als daß er
für die Beurteilung eines literarischen Werkes speziell dienlich wäre. Hier ist viel-
mehr gemeint: Möglichkeii als mögliche Wirklichkeit. Das Dargestellte muß, so
wie es dargestellt ist, wirklich sein können, das verlangt man.
Aber auch dieses Können ist noch nicht schlechthin klar. Es muß wirklich sein
können, kann erstens und hauptsächlich heißen: Jetzt und jeden Augenblick, heute
und in hundert Jahren, hier, an diesem Orte und wo sonst immer, besteht die Mög-
lichkeit zu seinem Wirklichsein. Zweitens aber kann es heißen: Dieses kann wirklich
sein in hundert Jahren oder sonst wann in der Zukunft. Drittens kann die Möglich-
keit in die Vergangenheit gelegt sein, so bei bestimmten extremen Vorgängen mittel-
alterlicher Kultur, die uns heute als „unmöglich" erscheinen, aus dem allgemeinen
Zeitgeiste heraus aber wohl verständlich sind. Die Möglichkeit kann aber viertens
auf bestimmte Gegenden beschränkt sein, so z. B. die berühmten humoristischen
Schilderungen der Ereignisse bei einer Raumschiffahrt, wenn die Reisenden in die
Zone der Schwerelosigkeit geraten. Alle diese Möglichkeiten bilden bestimmte Sonder-
gruppen, auf die wir nachher noch zurückkommen werden.
Vorerst sei noch einer anderen Unterscheidung gedacht. Dichten ist Phantasie-
tätigkeit, und Phantasietätigkeit bedeutet ihrem Wesen nach Verknüpfung bekannter
Elemente zu neuen, unbekannten. Jedes Kunstwerk zeigt sich nun als ein Gemisch
von Wirklichkeiten, Elementen, die dem Autor bekannt sind und solchen, die dem
Autor nicht bekannt sind, die er aber auf Grund seiner außerordentlich exakt arbei-
tenden Phantasie, bestehenden Wirklichkeiten gleich von sich aus neu gebildet hat.
Diese Teilung des Wirklichen in Bekanntes und Unbekanntes wiederholt sich im
Gebiete des Möglichen, wenn auch in etwas variierter Form.