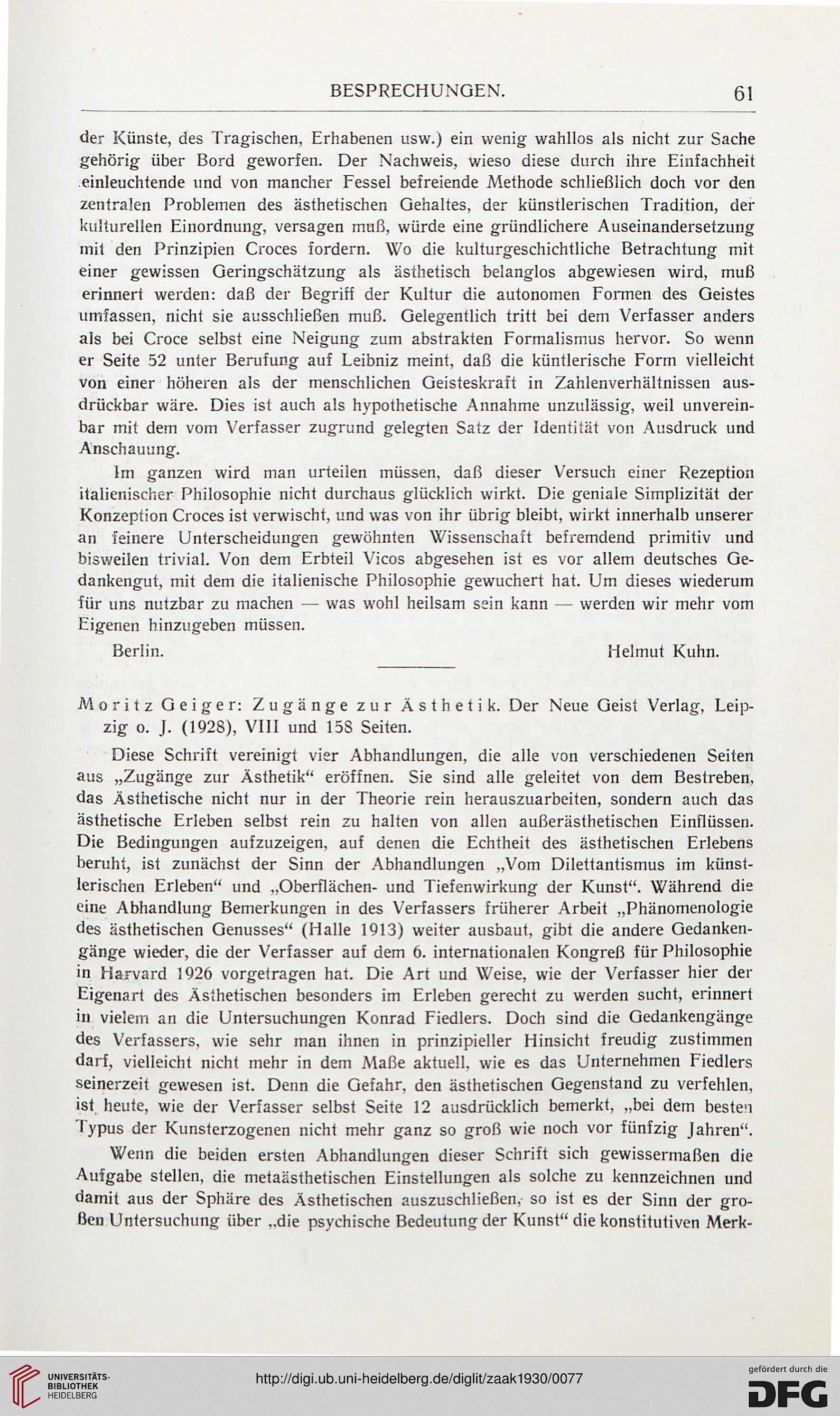BESPRECHUNGEN.
61
der Künste, des Tragischen, Erhabenen usw.) ein wenig wahllos als nicht zur Sache
gehörig über Bord geworfen. Der Nachweis, wieso diese durch ihre Einfachheit
einleuchtende und von mancher Fessel befreiende Methode schließlich doch vor den
zentralen Problemen des ästhetischen Gehaltes, der künstlerischen Tradition, der
kulturellen Einordnung, versagen muß, würde eine gründlichere Auseinandersetzung
mit den Prinzipien Croces fordern. Wo die kulturgeschichtliche Betrachtung mit
einer gewissen Geringschätzung als ästhetisch belanglos abgewiesen wird, muß
erinnert werden: daß der Begriff der Kultur die autonomen Formen des Geistes
umfassen, nicht sie ausschließen muß. Gelegentlich tritt bei dem Verfasser anders
als bei Croce selbst eine Neigung zum abstrakten Formalismus hervor. So wenn
er Seite 52 unter Berufung auf Leibniz meint, daß die küntlerische Form vielleicht
von einer höheren als der menschlichen Geisteskraft in Zahlenverhältnissen aus-
drückbar wäre. Dies ist auch als hypothetische Annahme unzulässig, weil unverein-
bar mit dem vom Verfasser zugrund gelegten Satz der Identität von Ausdruck und
Anschauung.
Im ganzen wird man urteilen müssen, daß dieser Versuch einer Rezeption
italienischer Philosophie nicht durchaus glücklich wirkt. Die geniale Simplizität der
Konzeption Croces ist verwischt, und was von ihr übrig bleibt, wirkt innerhalb unserer
an feinere Unterscheidungen gewöhnten Wissenschaft befremdend primitiv und
bisweilen trivial. Von dem Erbteil Vicos abgesehen ist es vor allem deutsches Ge-
dankengut, mit dem die italienische Philosophie gewuchert hat. Um dieses wiederum
für uns nutzbar zu machen — was wohl heilsam sein kann — werden wir mehr vom
Eigenen hinzugeben müssen.
Berlin. Helmut Kuhn.
Moritz Geiger: Zugänge zur Ästhetik. Der Neue Geist Verlag, Leip-
zig o. J. (1928), VIII und 158 Seiten.
Diese Schrift vereinigt vier Abhandlungen, die alle von verschiedenen Seiten
aus „Zugänge zur Ästhetik" eröffnen. Sie sind alle geleitet von dem Bestreben,
das Ästhetische nicht nur in der Theorie rein herauszuarbeiten, sondern auch das
ästhetische Erleben selbst rein zu halten von allen außerästhetischen Einflüssen.
Die Bedingungen aufzuzeigen, auf denen die Echtheit des ästhetischen Erlebens
beruht, ist zunächst der Sinn der Abhandlungen „Vom Dilettantismus im künst-
lerischen Erleben" und „Oberflächen- und Tiefenwirkung der Kunst". Während die
eine Abhandlung Bemerkungen in des Verfassers früherer Arbeit „Phänomenologie
des ästhetischen Genusses" (Halle 1913) weiter ausbaut, gibt die andere Gedanken-
gänge wieder, die der Verfasser auf dem 6. internationalen Kongreß für Philosophie
in Harvard 1926 vorgetragen hat. Die Art und Weise, wie der Verfasser hier der
Eigenart des Ästhetischen besonders im Erleben gerecht zu werden sucht, erinnert
in vielem an die Untersuchungen Konrad Fiedlers. Doch sind die Gedankengänge
des Verfassers, wie sehr man ihnen in prinzipieller Hinsicht freudig zustimmen
darf, vielleicht nicht mehr in dem Maße aktuell, wie es das Unternehmen Fiedlers
seinerzeit gewesen ist. Denn die Gefahr, den ästhetischen Gegenstand zu verfehlen,
ist heute, wie der Verfasser selbst Seite 12 ausdrücklich bemerkt, „bei dem besten
Typus der Kunsterzogenen nicht mehr ganz so groß wie noch vor fünfzig Jahren".
Wenn die beiden ersten Abhandlungen dieser Schrift sich gewissermaßen die
Aufgabe stellen, die metaästhetischen Einstellungen als solche zu kennzeichnen und
damit aus der Sphäre des Ästhetischen auszuschließen, so ist es der Sinn der gro-
ßen Untersuchung über „die psychische Bedeutung der Kunst" die konstitutiven Merk-
61
der Künste, des Tragischen, Erhabenen usw.) ein wenig wahllos als nicht zur Sache
gehörig über Bord geworfen. Der Nachweis, wieso diese durch ihre Einfachheit
einleuchtende und von mancher Fessel befreiende Methode schließlich doch vor den
zentralen Problemen des ästhetischen Gehaltes, der künstlerischen Tradition, der
kulturellen Einordnung, versagen muß, würde eine gründlichere Auseinandersetzung
mit den Prinzipien Croces fordern. Wo die kulturgeschichtliche Betrachtung mit
einer gewissen Geringschätzung als ästhetisch belanglos abgewiesen wird, muß
erinnert werden: daß der Begriff der Kultur die autonomen Formen des Geistes
umfassen, nicht sie ausschließen muß. Gelegentlich tritt bei dem Verfasser anders
als bei Croce selbst eine Neigung zum abstrakten Formalismus hervor. So wenn
er Seite 52 unter Berufung auf Leibniz meint, daß die küntlerische Form vielleicht
von einer höheren als der menschlichen Geisteskraft in Zahlenverhältnissen aus-
drückbar wäre. Dies ist auch als hypothetische Annahme unzulässig, weil unverein-
bar mit dem vom Verfasser zugrund gelegten Satz der Identität von Ausdruck und
Anschauung.
Im ganzen wird man urteilen müssen, daß dieser Versuch einer Rezeption
italienischer Philosophie nicht durchaus glücklich wirkt. Die geniale Simplizität der
Konzeption Croces ist verwischt, und was von ihr übrig bleibt, wirkt innerhalb unserer
an feinere Unterscheidungen gewöhnten Wissenschaft befremdend primitiv und
bisweilen trivial. Von dem Erbteil Vicos abgesehen ist es vor allem deutsches Ge-
dankengut, mit dem die italienische Philosophie gewuchert hat. Um dieses wiederum
für uns nutzbar zu machen — was wohl heilsam sein kann — werden wir mehr vom
Eigenen hinzugeben müssen.
Berlin. Helmut Kuhn.
Moritz Geiger: Zugänge zur Ästhetik. Der Neue Geist Verlag, Leip-
zig o. J. (1928), VIII und 158 Seiten.
Diese Schrift vereinigt vier Abhandlungen, die alle von verschiedenen Seiten
aus „Zugänge zur Ästhetik" eröffnen. Sie sind alle geleitet von dem Bestreben,
das Ästhetische nicht nur in der Theorie rein herauszuarbeiten, sondern auch das
ästhetische Erleben selbst rein zu halten von allen außerästhetischen Einflüssen.
Die Bedingungen aufzuzeigen, auf denen die Echtheit des ästhetischen Erlebens
beruht, ist zunächst der Sinn der Abhandlungen „Vom Dilettantismus im künst-
lerischen Erleben" und „Oberflächen- und Tiefenwirkung der Kunst". Während die
eine Abhandlung Bemerkungen in des Verfassers früherer Arbeit „Phänomenologie
des ästhetischen Genusses" (Halle 1913) weiter ausbaut, gibt die andere Gedanken-
gänge wieder, die der Verfasser auf dem 6. internationalen Kongreß für Philosophie
in Harvard 1926 vorgetragen hat. Die Art und Weise, wie der Verfasser hier der
Eigenart des Ästhetischen besonders im Erleben gerecht zu werden sucht, erinnert
in vielem an die Untersuchungen Konrad Fiedlers. Doch sind die Gedankengänge
des Verfassers, wie sehr man ihnen in prinzipieller Hinsicht freudig zustimmen
darf, vielleicht nicht mehr in dem Maße aktuell, wie es das Unternehmen Fiedlers
seinerzeit gewesen ist. Denn die Gefahr, den ästhetischen Gegenstand zu verfehlen,
ist heute, wie der Verfasser selbst Seite 12 ausdrücklich bemerkt, „bei dem besten
Typus der Kunsterzogenen nicht mehr ganz so groß wie noch vor fünfzig Jahren".
Wenn die beiden ersten Abhandlungen dieser Schrift sich gewissermaßen die
Aufgabe stellen, die metaästhetischen Einstellungen als solche zu kennzeichnen und
damit aus der Sphäre des Ästhetischen auszuschließen, so ist es der Sinn der gro-
ßen Untersuchung über „die psychische Bedeutung der Kunst" die konstitutiven Merk-