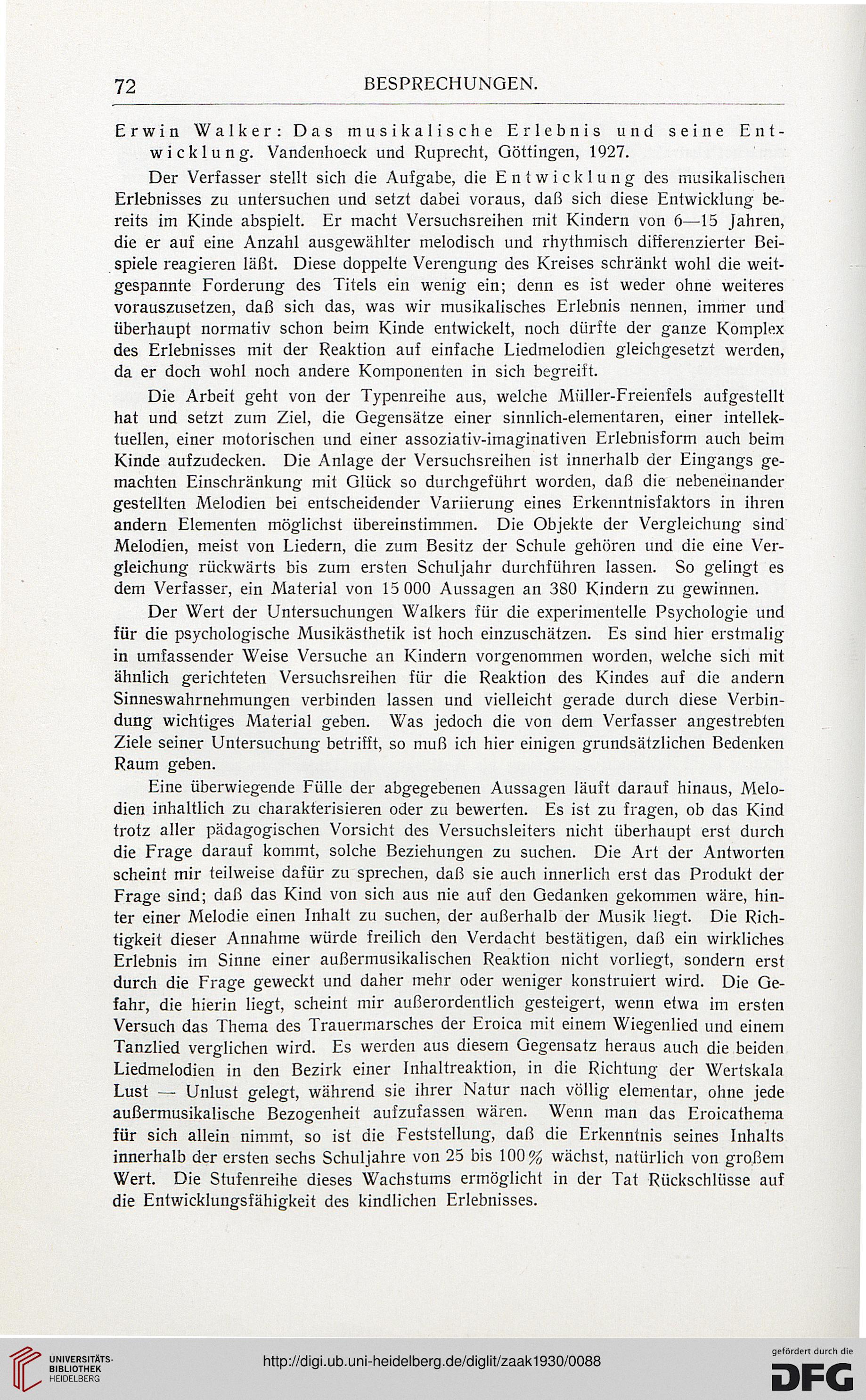72
BESPRECHUNGEN.
Erwin Walker: Das musikalische Erlebnis und seine Ent-
wicklung. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1927.
Der Verfasser stellt sich die Aufgabe, die Entwicklung des musikalischen
Erlebnisses zu untersuchen und setzt dabei voraus, daß sich diese Entwicklung be-
reits im Kinde abspielt. Er macht Versuchsreihen mit Kindern von 6—15 Jahren,
die er auf eine Anzahl ausgewählter melodisch und rhythmisch differenzierter Bei-
spiele reagieren läßt. Diese doppelte Verengung des Kreises schränkt wohl die weit-
gespannte Forderung des Titels ein wenig ein; denn es ist weder ohne weiteres
vorauszusetzen, daß sich das, was wir musikalisches Erlebnis nennen, immer und
überhaupt normativ schon beim Kinde entwickelt, noch dürfte der ganze Komplex
des Erlebnisses mit der Reaktion auf einfache Liedmelodien gleichgesetzt werden,
da er doch wohl noch andere Komponenten in sich begreift.
Die Arbeit geht von der Typenreihe aus, welche Müller-Freienfels aufgestellt
hat und setzt zum Ziel, die Gegensätze einer sinnlich-elementaren, einer intellek-
tuellen, einer motorischen und einer assoziativ-imaginativen Erlebnisform auch beim
Kinde aufzudecken. Die Anlage der Versuchsreihen ist innerhalb der Eingangs ge-
machten Einschränkung mit Glück so durchgeführt worden, daß die nebeneinander
gestellten Melodien bei entscheidender Variierung eines Erkenntnisfaktors in ihren
andern Elementen möglichst übereinstimmen. Die Objekte der Vergleichung sind
Melodien, meist von Liedern, die zum Besitz der Schule gehören und die eine Ver-
gleichung rückwärts bis zum ersten Schuljahr durchführen lassen. So gelingt es
dem Verfasser, ein Material von 15 000 Aussagen an 380 Kindern zu gewinnen.
Der Wert der Untersuchungen Walkers für die experimentelle Psychologie und
für die psychologische Musikästhetik ist hoch einzuschätzen. Es sind hier erstmalig
in umfassender Weise Versuche an Kindern vorgenommen worden, welche sich mit
ähnlich gerichteten Versuchsreihen für die Reaktion des Kindes auf die andern
Sinneswahrnehmungen verbinden lassen und vielleicht gerade durch diese Verbin-
dung wichtiges Material geben. Was jedoch die von dem Verfasser angestrebten
Ziele seiner Untersuchung betrifft, so muß ich hier einigen grundsätzlichen Bedenken
Raum geben.
Eine überwiegende Fülle der abgegebenen Aussagen läuft darauf hinaus, Melo-
dien inhaltlich zu charakterisieren oder zu bewerten. Es ist zu fragen, ob das Kind
trotz aller pädagogischen Vorsicht des Versuchsleiters nicht überhaupt erst durch
die Frage darauf kommt, solche Beziehungen zu suchen. Die Art der Antworten
scheint mir teilweise dafür zu sprechen, daß sie auch innerlich erst das Produkt der
Frage sind; daß das Kind von sich aus nie auf den Gedanken gekommen wäre, hin-
ter einer Melodie einen Inhalt zu suchen, der außerhalb der Musik liegt. Die Rich-
tigkeit dieser Annahme würde freilich den Verdacht bestätigen, daß ein wirkliches
Erlebnis im Sinne einer außermusikalischen Reaktion nicht vorliegt, sondern erst
durch die Frage geweckt und daher mehr oder weniger konstruiert wird. Die Ge-
fahr, die hierin liegt, scheint mir außerordentlich gesteigert, wenn etwa im ersten
Versuch das Thema des Trauermarsches der Eroica mit einem Wiegenlied und einem
Tanzlied verglichen wird. Es werden aus diesem Gegensatz heraus auch die beiden
Liedmelodien in den Bezirk einer Inhaltreaktion, in die Richtung der Wertskala
Lust — Unlust gelegt, während sie ihrer Natur nach völlig elementar, ohne jede
außermusikalische Bezogenheit aufzufassen wären. Wenn man das Eroicathema
für sich allein nimmt, so ist die Feststellung, daß die Erkenntnis seines Inhalts
innerhalb der ersten sechs Schuljahre von 25 bis 100% wächst, natürlich von großem
Wert. Die Stufenreihe dieses Wachstums ermöglicht in der Tat Rückschlüsse auf
die Entwicklungsfähigkeit des kindlichen Erlebnisses.
BESPRECHUNGEN.
Erwin Walker: Das musikalische Erlebnis und seine Ent-
wicklung. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1927.
Der Verfasser stellt sich die Aufgabe, die Entwicklung des musikalischen
Erlebnisses zu untersuchen und setzt dabei voraus, daß sich diese Entwicklung be-
reits im Kinde abspielt. Er macht Versuchsreihen mit Kindern von 6—15 Jahren,
die er auf eine Anzahl ausgewählter melodisch und rhythmisch differenzierter Bei-
spiele reagieren läßt. Diese doppelte Verengung des Kreises schränkt wohl die weit-
gespannte Forderung des Titels ein wenig ein; denn es ist weder ohne weiteres
vorauszusetzen, daß sich das, was wir musikalisches Erlebnis nennen, immer und
überhaupt normativ schon beim Kinde entwickelt, noch dürfte der ganze Komplex
des Erlebnisses mit der Reaktion auf einfache Liedmelodien gleichgesetzt werden,
da er doch wohl noch andere Komponenten in sich begreift.
Die Arbeit geht von der Typenreihe aus, welche Müller-Freienfels aufgestellt
hat und setzt zum Ziel, die Gegensätze einer sinnlich-elementaren, einer intellek-
tuellen, einer motorischen und einer assoziativ-imaginativen Erlebnisform auch beim
Kinde aufzudecken. Die Anlage der Versuchsreihen ist innerhalb der Eingangs ge-
machten Einschränkung mit Glück so durchgeführt worden, daß die nebeneinander
gestellten Melodien bei entscheidender Variierung eines Erkenntnisfaktors in ihren
andern Elementen möglichst übereinstimmen. Die Objekte der Vergleichung sind
Melodien, meist von Liedern, die zum Besitz der Schule gehören und die eine Ver-
gleichung rückwärts bis zum ersten Schuljahr durchführen lassen. So gelingt es
dem Verfasser, ein Material von 15 000 Aussagen an 380 Kindern zu gewinnen.
Der Wert der Untersuchungen Walkers für die experimentelle Psychologie und
für die psychologische Musikästhetik ist hoch einzuschätzen. Es sind hier erstmalig
in umfassender Weise Versuche an Kindern vorgenommen worden, welche sich mit
ähnlich gerichteten Versuchsreihen für die Reaktion des Kindes auf die andern
Sinneswahrnehmungen verbinden lassen und vielleicht gerade durch diese Verbin-
dung wichtiges Material geben. Was jedoch die von dem Verfasser angestrebten
Ziele seiner Untersuchung betrifft, so muß ich hier einigen grundsätzlichen Bedenken
Raum geben.
Eine überwiegende Fülle der abgegebenen Aussagen läuft darauf hinaus, Melo-
dien inhaltlich zu charakterisieren oder zu bewerten. Es ist zu fragen, ob das Kind
trotz aller pädagogischen Vorsicht des Versuchsleiters nicht überhaupt erst durch
die Frage darauf kommt, solche Beziehungen zu suchen. Die Art der Antworten
scheint mir teilweise dafür zu sprechen, daß sie auch innerlich erst das Produkt der
Frage sind; daß das Kind von sich aus nie auf den Gedanken gekommen wäre, hin-
ter einer Melodie einen Inhalt zu suchen, der außerhalb der Musik liegt. Die Rich-
tigkeit dieser Annahme würde freilich den Verdacht bestätigen, daß ein wirkliches
Erlebnis im Sinne einer außermusikalischen Reaktion nicht vorliegt, sondern erst
durch die Frage geweckt und daher mehr oder weniger konstruiert wird. Die Ge-
fahr, die hierin liegt, scheint mir außerordentlich gesteigert, wenn etwa im ersten
Versuch das Thema des Trauermarsches der Eroica mit einem Wiegenlied und einem
Tanzlied verglichen wird. Es werden aus diesem Gegensatz heraus auch die beiden
Liedmelodien in den Bezirk einer Inhaltreaktion, in die Richtung der Wertskala
Lust — Unlust gelegt, während sie ihrer Natur nach völlig elementar, ohne jede
außermusikalische Bezogenheit aufzufassen wären. Wenn man das Eroicathema
für sich allein nimmt, so ist die Feststellung, daß die Erkenntnis seines Inhalts
innerhalb der ersten sechs Schuljahre von 25 bis 100% wächst, natürlich von großem
Wert. Die Stufenreihe dieses Wachstums ermöglicht in der Tat Rückschlüsse auf
die Entwicklungsfähigkeit des kindlichen Erlebnisses.