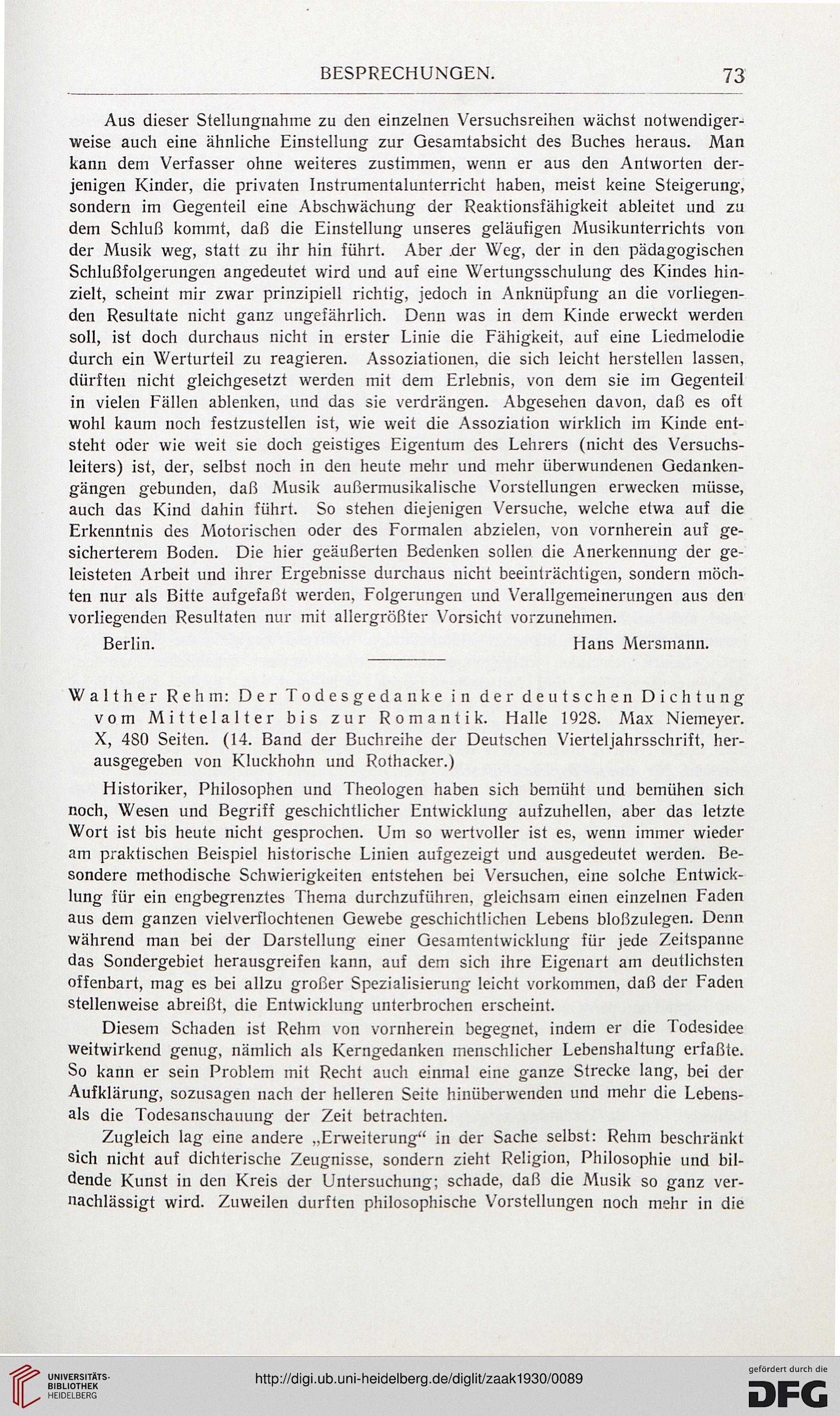BESPRECHUNGEN.
73
Aus dieser Stellungnahme zu den einzelnen Versuchsreihen wächst notwendiger-
weise auch eine ähnliche Einstellung zur Gesamtabsicht des Buches heraus. Man
kann dem Verfasser ohne weiteres zustimmen, wenn er aus den Antworten der-
jenigen Kinder, die privaten Instrumentalunterricht haben, meist keine Steigerung,
sondern im Gegenteil eine Abschwächung der Reaktionsfähigkeit ableitet und zu
dem Schluß kommt, daß die Einstellung unseres geläufigen Musikunterrichts von
der Musik weg, statt zu ihr hin führt. Aber .der Weg, der in den pädagogischen
Schlußfolgerungen angedeutet wird und auf eine Wertungsschulung des Kindes hin-
zielt, scheint mir zwar prinzipiell richtig, jedoch in Anknüpfung an die vorliegen-
den Resultate nicht ganz ungefährlich. Denn was in dem Kinde erweckt werden
soll, ist doch durchaus nicht in erster Linie die Fähigkeit, auf eine Liedmelodie
durch ein Werturteil zu reagieren. Assoziationen, die sich leicht herstellen lassen,
dürften nicht gleichgesetzt werden mit dem Erlebnis, von dem sie im Gegenteil
in vielen Fällen ablenken, und das sie verdrängen. Abgesehen davon, daß es oft
wohl kaum noch festzustellen ist, wie weit die Assoziation wirklich im Kinde ent-
steht oder wie weit sie doch geistiges Eigentum des Lehrers (nicht des Versuchs-
leiters) ist, der, selbst noch in den heute mehr und mehr überwundenen Gedanken-
gängen gebunden, daß Musik außermusikalische Vorstellungen erwecken müsse,
auch das Kind dahin führt. So stehen diejenigen Versuche, welche etwa auf die
Erkenntnis des Motorischen oder des Formalen abzielen, von vornherein auf ge-
sicherterem Boden. Die hier geäußerten Bedenken sollen die Anerkennung der ge-
leisteten Arbeit und ihrer Ergebnisse durchaus nicht beeinträchtigen, sondern möch-
ten nur als Bitte aufgefaßt werden, Folgerungen und Verallgemeinerungen aus den
vorliegenden Resultaten nur mit allergrößter Vorsicht vorzunehmen.
Berlin. Hans Mersmann.
Walther Rehm: Der Todesgedanke in der deutschen Dichtung
vom Mittelalter bis zur Romantik. Halle 1928. Max Niemeyer.
X, 480 Seiten. (14. Band der Buchreihe der Deutschen Vierteljahrsschrift, her-
ausgegeben von Kluckhohn und Rothacker.)
Historiker, Philosophen und Theologen haben sich bemüht und bemühen sich
noch, Wesen und Begriff geschichtlicher Entwicklung aufzuhellen, aber das letzte
Wort ist bis heute nicht gesprochen. Um so wertvoller ist es, wenn immer wieder
am praktischen Beispiel historische Linien aufgezeigt und ausgedeutet werden. Be-
sondere methodische Schwierigkeiten entstehen bei Versuchen, eine solche Entwick-
lung für ein engbegrenztes Thema durchzuführen, gleichsam einen einzelnen Faden
aus dem ganzen vielverflochtenen Gewebe geschichtlichen Lebens bloßzulegen. Denn
Während man bei der Darstellung einer Gesamtentwicklung für jede Zeitspanne
das Sondergebiet herausgreifen kann, auf dem sich ihre Eigenart am deutlichsten
offenbart, mag es bei allzu großer Spezialisierung leicht vorkommen, daß der Faden
stellenweise abreißt, die Entwicklung unterbrochen erscheint.
Diesem Schaden ist Rehm von vornherein begegnet, indem er die Todesidee
weitwirkend genug, nämlich als Kerngedanken menschlicher Lebenshaltung erfaßte.
So kann er sein Problem mit Recht auch einmal eine ganze Strecke lang, bei der
Aufklärung, sozusagen nach der helleren Seite hinüberwenden und mehr die Lebens-
ais die Todesanschauung der Zeit betrachten.
Zugleich lag eine andere „Erweiterung" in der Sache selbst: Rehm beschränkt
sich nicht auf dichterische Zeugnisse, sondern zieht Religion, Philosophie und bil-
dende Kunst in den Kreis der Untersuchung; schade, daß die Musik so ganz ver-
nachlässigt wird. Zuweilen durften philosophische Vorstellungen noch mehr in die
73
Aus dieser Stellungnahme zu den einzelnen Versuchsreihen wächst notwendiger-
weise auch eine ähnliche Einstellung zur Gesamtabsicht des Buches heraus. Man
kann dem Verfasser ohne weiteres zustimmen, wenn er aus den Antworten der-
jenigen Kinder, die privaten Instrumentalunterricht haben, meist keine Steigerung,
sondern im Gegenteil eine Abschwächung der Reaktionsfähigkeit ableitet und zu
dem Schluß kommt, daß die Einstellung unseres geläufigen Musikunterrichts von
der Musik weg, statt zu ihr hin führt. Aber .der Weg, der in den pädagogischen
Schlußfolgerungen angedeutet wird und auf eine Wertungsschulung des Kindes hin-
zielt, scheint mir zwar prinzipiell richtig, jedoch in Anknüpfung an die vorliegen-
den Resultate nicht ganz ungefährlich. Denn was in dem Kinde erweckt werden
soll, ist doch durchaus nicht in erster Linie die Fähigkeit, auf eine Liedmelodie
durch ein Werturteil zu reagieren. Assoziationen, die sich leicht herstellen lassen,
dürften nicht gleichgesetzt werden mit dem Erlebnis, von dem sie im Gegenteil
in vielen Fällen ablenken, und das sie verdrängen. Abgesehen davon, daß es oft
wohl kaum noch festzustellen ist, wie weit die Assoziation wirklich im Kinde ent-
steht oder wie weit sie doch geistiges Eigentum des Lehrers (nicht des Versuchs-
leiters) ist, der, selbst noch in den heute mehr und mehr überwundenen Gedanken-
gängen gebunden, daß Musik außermusikalische Vorstellungen erwecken müsse,
auch das Kind dahin führt. So stehen diejenigen Versuche, welche etwa auf die
Erkenntnis des Motorischen oder des Formalen abzielen, von vornherein auf ge-
sicherterem Boden. Die hier geäußerten Bedenken sollen die Anerkennung der ge-
leisteten Arbeit und ihrer Ergebnisse durchaus nicht beeinträchtigen, sondern möch-
ten nur als Bitte aufgefaßt werden, Folgerungen und Verallgemeinerungen aus den
vorliegenden Resultaten nur mit allergrößter Vorsicht vorzunehmen.
Berlin. Hans Mersmann.
Walther Rehm: Der Todesgedanke in der deutschen Dichtung
vom Mittelalter bis zur Romantik. Halle 1928. Max Niemeyer.
X, 480 Seiten. (14. Band der Buchreihe der Deutschen Vierteljahrsschrift, her-
ausgegeben von Kluckhohn und Rothacker.)
Historiker, Philosophen und Theologen haben sich bemüht und bemühen sich
noch, Wesen und Begriff geschichtlicher Entwicklung aufzuhellen, aber das letzte
Wort ist bis heute nicht gesprochen. Um so wertvoller ist es, wenn immer wieder
am praktischen Beispiel historische Linien aufgezeigt und ausgedeutet werden. Be-
sondere methodische Schwierigkeiten entstehen bei Versuchen, eine solche Entwick-
lung für ein engbegrenztes Thema durchzuführen, gleichsam einen einzelnen Faden
aus dem ganzen vielverflochtenen Gewebe geschichtlichen Lebens bloßzulegen. Denn
Während man bei der Darstellung einer Gesamtentwicklung für jede Zeitspanne
das Sondergebiet herausgreifen kann, auf dem sich ihre Eigenart am deutlichsten
offenbart, mag es bei allzu großer Spezialisierung leicht vorkommen, daß der Faden
stellenweise abreißt, die Entwicklung unterbrochen erscheint.
Diesem Schaden ist Rehm von vornherein begegnet, indem er die Todesidee
weitwirkend genug, nämlich als Kerngedanken menschlicher Lebenshaltung erfaßte.
So kann er sein Problem mit Recht auch einmal eine ganze Strecke lang, bei der
Aufklärung, sozusagen nach der helleren Seite hinüberwenden und mehr die Lebens-
ais die Todesanschauung der Zeit betrachten.
Zugleich lag eine andere „Erweiterung" in der Sache selbst: Rehm beschränkt
sich nicht auf dichterische Zeugnisse, sondern zieht Religion, Philosophie und bil-
dende Kunst in den Kreis der Untersuchung; schade, daß die Musik so ganz ver-
nachlässigt wird. Zuweilen durften philosophische Vorstellungen noch mehr in die