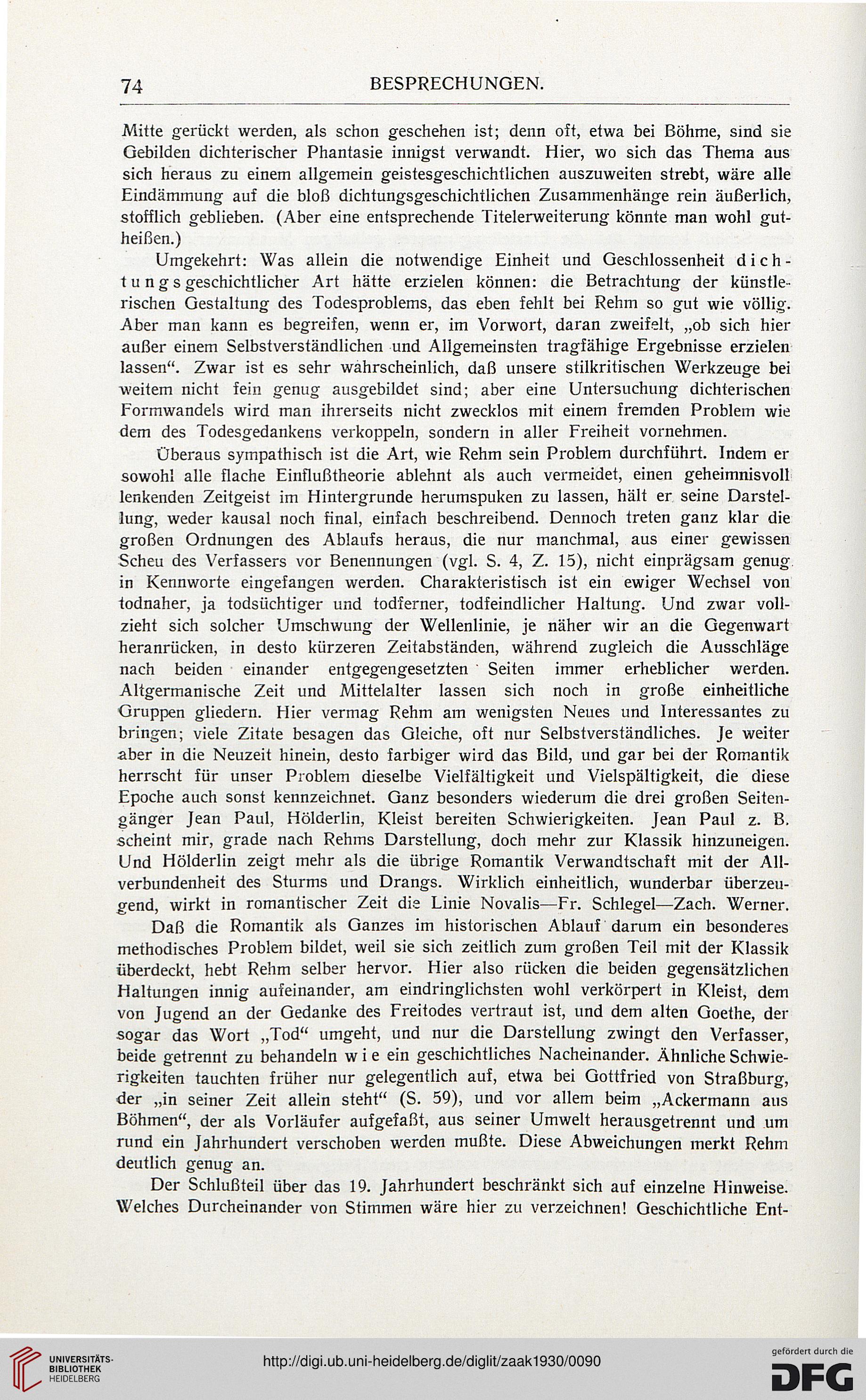74
BESPRECHUNGEN.
Mitte gerückt werden, als schon geschehen ist; denn oft, etwa bei Böhme, sind sie
Gebilden dichterischer Phantasie innigst verwandt. Hier, wo sich das Thema aus
sich heraus zu einem allgemein geistesgeschichtlichen auszuweiten strebt, wäre alle
Eindämmung auf die bloß dichtungsgeschichtlichen Zusammenhänge rein äußerlich,
stofflich geblieben. (Aber eine entsprechende Titelerweiterung könnte man wohl gut-
heißen.)
Umgekehrt: Was allein die notwendige Einheit und Geschlossenheit dich-
t u n g s geschichtlicher Art hätte erzielen können: die Betrachtung der künstle-
rischen Gestaltung des Todesproblems, das eben fehlt bei Rehm so gut wie völlig.
Aber man kann es begreifen, wenn er, im Vorwort, daran zweifelt, „ob sich hier
außer einem Selbstverständlichen und Allgemeinsten tragfähige Ergebnisse erzielen
lassen". Zwar ist es sehr wahrscheinlich, daß unsere stilkritischen Werkzeuge bei
weitem nicht fein genug ausgebildet sind; aber eine Untersuchung dichterischen
Formwandels wird man ihrerseits nicht zwecklos mit einem fremden Problem wie
dem des Todesgedankens verkoppeln, sondern in aller Freiheit vornehmen.
Überaus sympathisch ist die Art, wie Rehm sein Problem durchführt. Indem er
sowohl alle flache Einflußtheorie ablehnt als auch vermeidet, einen geheimnisvoll
lenkenden Zeitgeist im Hintergrunde herumspuken zu lassen, hält er seine Darstel-
lung, weder kausal noch final, einfach beschreibend. Dennoch treten ganz klar die
großen Ordnungen des Ablaufs heraus, die nur manchmal, aus einer gewissen
Scheu des Verfassers vor Benennungen (vgl. S. 4, Z. 15), nicht einprägsam genug
in Kennworte eingefangen werden. Charakteristisch ist ein ewiger Wechsel von
todnaher, ja todsüchtiger und todferner, todfeindlicher Haltung. Und zwar voll-
zieht sich solcher Umschwung der Wellenlinie, je näher wir an die Gegenwart
heranrücken, in desto kürzeren Zeitabständen, während zugleich die Ausschläge
nach beiden einander entgegengesetzten Seiten immer erheblicher werden.
Altgermanische Zeit und Mittelalter lassen sich noch in große einheitliche
Gruppen gliedern. Hier vermag Rehm am wenigsten Neues und Interessantes zu
bringen; viele Zitate besagen das Gleiche, oft nur Selbstverständliches. Je weiter
aber in die Neuzeit hinein, desto farbiger wird das Bild, und gar bei der Romantik
herrscht für unser Problem dieselbe Vielfältigkeit und Vielspältigkeit, die diese
Epoche auch sonst kennzeichnet. Ganz besonders wiederum die drei großen Seiten-
gänger Jean Paul, Hölderlin, Kleist bereiten Schwierigkeiten. Jean Paul z. B.
scheint mir, grade nach Rehms Darstellung, doch mehr zur Klassik hinzuneigen.
Und Hölderlin zeigt mehr als die übrige Romantik Verwandtschaft mit der All-
verbundenheit des Sturms und Drangs. Wirklich einheitlich, wunderbar überzeu-
gend, wirkt in romantischer Zeit die Linie Novalis~Fr. Schlegel—Zach. Werner.
Daß die Romantik als Ganzes im historischen Ablauf darum ein besonderes
methodisches Problem bildet, weil sie sich zeitlich zum großen Teil mit der Klassik
überdeckt, hebt Rehm selber hervor. Hier also rücken die beiden gegensätzlichen
Haltungen innig aufeinander, am eindringlichsten wohl verkörpert in Kleist, dem
von Jugend an der Gedanke des Freitodes vertraut ist, und dem alten Goethe, der
sogar das Wort „Tod" umgeht, und nur die Darstellung zwingt den Verfasser,
beide getrennt zu behandeln w i e ein geschichtliches Nacheinander. Ähnliche Schwie-
rigkeiten tauchten früher nur gelegentlich auf, etwa bei Gottfried von Straßburg,
der „in seiner Zeit allein steht" (S. 59), und vor allem beim „Ackermann aus
Böhmen", der als Vorläufer aufgefaßt, aus seiner Umwelt herausgetrennt und um
rund ein Jahrhundert verschoben werden mußte. Diese Abweichungen merkt Rehm
deutlich genug an.
Der Schlußteil über das 19. Jahrhundert beschränkt sich auf einzelne Hinweise.
Welches Durcheinander von Stimmen wäre hier zu verzeichnen! Geschichtliche Ent-
BESPRECHUNGEN.
Mitte gerückt werden, als schon geschehen ist; denn oft, etwa bei Böhme, sind sie
Gebilden dichterischer Phantasie innigst verwandt. Hier, wo sich das Thema aus
sich heraus zu einem allgemein geistesgeschichtlichen auszuweiten strebt, wäre alle
Eindämmung auf die bloß dichtungsgeschichtlichen Zusammenhänge rein äußerlich,
stofflich geblieben. (Aber eine entsprechende Titelerweiterung könnte man wohl gut-
heißen.)
Umgekehrt: Was allein die notwendige Einheit und Geschlossenheit dich-
t u n g s geschichtlicher Art hätte erzielen können: die Betrachtung der künstle-
rischen Gestaltung des Todesproblems, das eben fehlt bei Rehm so gut wie völlig.
Aber man kann es begreifen, wenn er, im Vorwort, daran zweifelt, „ob sich hier
außer einem Selbstverständlichen und Allgemeinsten tragfähige Ergebnisse erzielen
lassen". Zwar ist es sehr wahrscheinlich, daß unsere stilkritischen Werkzeuge bei
weitem nicht fein genug ausgebildet sind; aber eine Untersuchung dichterischen
Formwandels wird man ihrerseits nicht zwecklos mit einem fremden Problem wie
dem des Todesgedankens verkoppeln, sondern in aller Freiheit vornehmen.
Überaus sympathisch ist die Art, wie Rehm sein Problem durchführt. Indem er
sowohl alle flache Einflußtheorie ablehnt als auch vermeidet, einen geheimnisvoll
lenkenden Zeitgeist im Hintergrunde herumspuken zu lassen, hält er seine Darstel-
lung, weder kausal noch final, einfach beschreibend. Dennoch treten ganz klar die
großen Ordnungen des Ablaufs heraus, die nur manchmal, aus einer gewissen
Scheu des Verfassers vor Benennungen (vgl. S. 4, Z. 15), nicht einprägsam genug
in Kennworte eingefangen werden. Charakteristisch ist ein ewiger Wechsel von
todnaher, ja todsüchtiger und todferner, todfeindlicher Haltung. Und zwar voll-
zieht sich solcher Umschwung der Wellenlinie, je näher wir an die Gegenwart
heranrücken, in desto kürzeren Zeitabständen, während zugleich die Ausschläge
nach beiden einander entgegengesetzten Seiten immer erheblicher werden.
Altgermanische Zeit und Mittelalter lassen sich noch in große einheitliche
Gruppen gliedern. Hier vermag Rehm am wenigsten Neues und Interessantes zu
bringen; viele Zitate besagen das Gleiche, oft nur Selbstverständliches. Je weiter
aber in die Neuzeit hinein, desto farbiger wird das Bild, und gar bei der Romantik
herrscht für unser Problem dieselbe Vielfältigkeit und Vielspältigkeit, die diese
Epoche auch sonst kennzeichnet. Ganz besonders wiederum die drei großen Seiten-
gänger Jean Paul, Hölderlin, Kleist bereiten Schwierigkeiten. Jean Paul z. B.
scheint mir, grade nach Rehms Darstellung, doch mehr zur Klassik hinzuneigen.
Und Hölderlin zeigt mehr als die übrige Romantik Verwandtschaft mit der All-
verbundenheit des Sturms und Drangs. Wirklich einheitlich, wunderbar überzeu-
gend, wirkt in romantischer Zeit die Linie Novalis~Fr. Schlegel—Zach. Werner.
Daß die Romantik als Ganzes im historischen Ablauf darum ein besonderes
methodisches Problem bildet, weil sie sich zeitlich zum großen Teil mit der Klassik
überdeckt, hebt Rehm selber hervor. Hier also rücken die beiden gegensätzlichen
Haltungen innig aufeinander, am eindringlichsten wohl verkörpert in Kleist, dem
von Jugend an der Gedanke des Freitodes vertraut ist, und dem alten Goethe, der
sogar das Wort „Tod" umgeht, und nur die Darstellung zwingt den Verfasser,
beide getrennt zu behandeln w i e ein geschichtliches Nacheinander. Ähnliche Schwie-
rigkeiten tauchten früher nur gelegentlich auf, etwa bei Gottfried von Straßburg,
der „in seiner Zeit allein steht" (S. 59), und vor allem beim „Ackermann aus
Böhmen", der als Vorläufer aufgefaßt, aus seiner Umwelt herausgetrennt und um
rund ein Jahrhundert verschoben werden mußte. Diese Abweichungen merkt Rehm
deutlich genug an.
Der Schlußteil über das 19. Jahrhundert beschränkt sich auf einzelne Hinweise.
Welches Durcheinander von Stimmen wäre hier zu verzeichnen! Geschichtliche Ent-