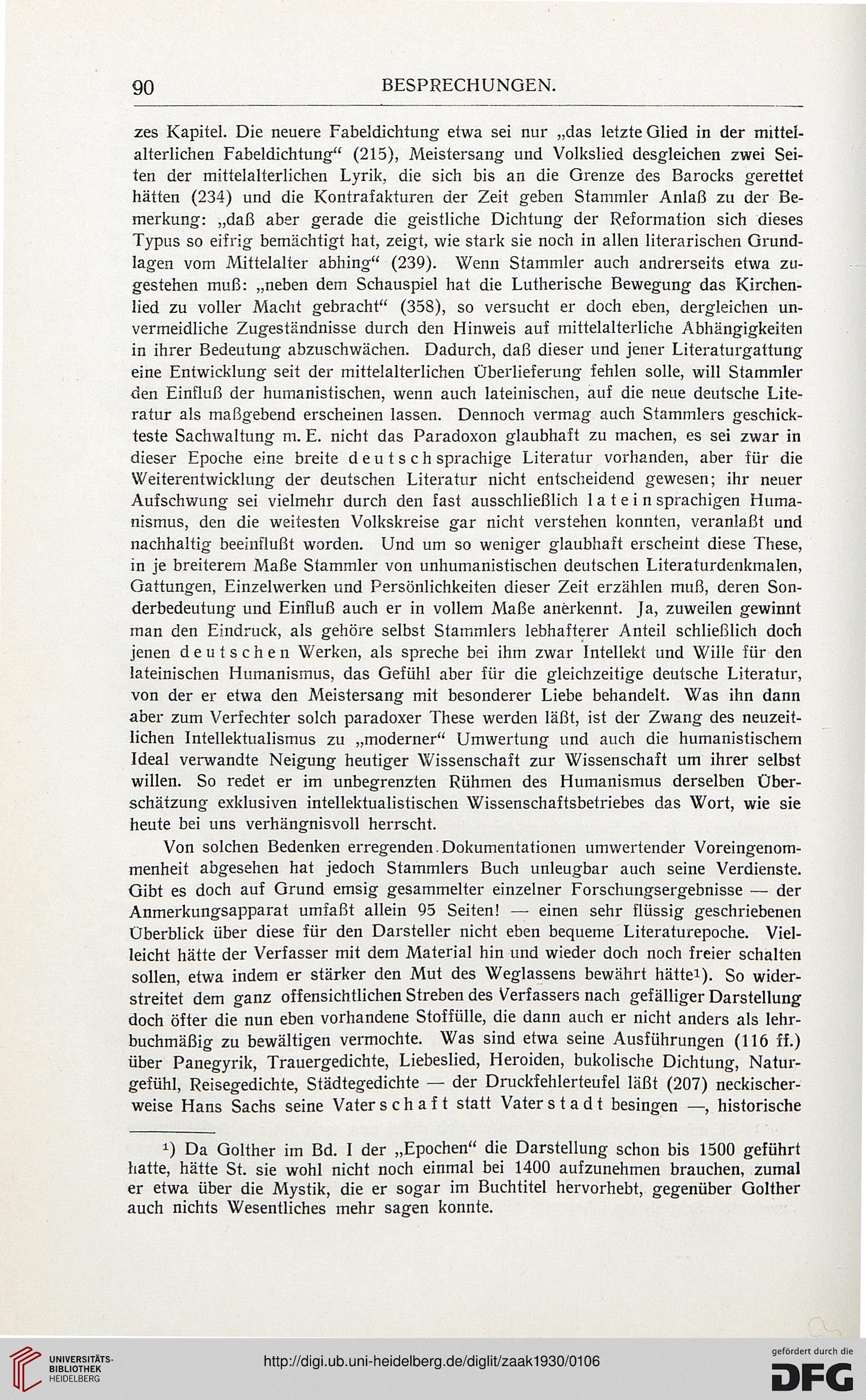90
BESPRECHUNGEN.
zes Kapitel. Die neuere Fabeldichtung etwa sei nur „das letzte Glied in der mittel-
alterlichen Fabeldichtung" (215), Meistersang und Volkslied desgleichen zwei Sei-
ten der mittelalterlichen Lyrik, die sich bis an die Grenze des Barocks gerettet
hätten (234) und die Kontrafakturen der Zeit geben Stammler Anlaß zu der Be-
merkung: „daß aber gerade die geistliche Dichtung der Reformation sich dieses
Typus so eifrig bemächtigt hat, zeigt, wie stark sie noch in allen literarischen Grund-
lagen vom Mittelalter abhing" (239). Wenn Stammler auch andrerseits etwa zu-
gestehen muß: „neben dem Schauspiel hat die Lutherische Bewegung das Kirchen-
lied zu voller Macht gebracht" (358), so versucht er doch eben, dergleichen un-
vermeidliche Zugeständnisse durch den Hinweis auf mittelalterliche Abhängigkeiten
in ihrer Bedeutung abzuschwächen. Dadurch, daß dieser und jener Literaturgattung
eine Entwicklung seit der mittelalterlichen Überlieferung fehlen solle, will Stammler
den Einfluß der humanistischen, wenn auch lateinischen, auf die neue deutsche Lite-
ratur als maßgebend erscheinen lassen. Dennoch vermag auch Stammlers geschick-
teste Sachwaltung m. E. nicht das Paradoxon glaubhaft zu machen, es sei zwar in
dieser Epoche eine breite deutsch sprachige Literatur vorhanden, aber für die
Weiterentwicklung der deutschen Literatur nicht entscheidend gewesen; ihr neuer
Aufschwung sei vielmehr durch den fast ausschließlich 1 a t e i n sprachigen Huma-
nismus, den die weitesten Volkskreise gar nicht verstehen konnten, veranlaßt und
nachhaltig beeinflußt worden. Und um so weniger glaubhaft erscheint diese These,
in je breiterem Maße Stammler von unhumanistischen deutschen Literaturdenkmalen,
Gattungen, Einzelwerken und Persönlichkeiten dieser Zeit erzählen muß, deren Son-
derbedeutung und Einfluß auch er in vollem Maße anerkennt. Ja, zuweilen gewinnt
man den Eindruck, als gehöre selbst Stammlers lebhafterer Anteil schließlich doch
jenen deutschen Werken, als spreche bei ihm zwar Intellekt und Wille für den
lateinischen Humanismus, das Gefühl aber für die gleichzeitige deutsche Literatur,
von der er etwa den Meistersang mit besonderer Liebe behandelt. Was ihn dann
aber zum Verfechter solch paradoxer These werden läßt, ist der Zwang des neuzeit-
lichen Intellektualismus zu „moderner" Umwertung und auch die humanistischem
Ideal verwandte Neigung heutiger Wissenschaft zur Wissenschaft um ihrer selbst
willen. So redet er im unbegrenzten Rühmen des Humanismus derselben Über-
schätzung exklusiven intellektualistischen Wissenschaftsbetriebes das Wort, wie sie
heute bei uns verhängnisvoll herrscht.
Von solchen Bedenken erregenden. Dokumentationen umwertender Voreingenom-
menheit abgesehen hat jedoch Stammlers Buch unleugbar auch seine Verdienste.
Gibt es doch auf Grund emsig gesammelter einzelner Forschungsergebnisse — der
Anmerkungsapparat umfaßt allein 95 Seiten! — einen sehr flüssig geschriebenen
Überblick über diese für den Darsteller nicht eben bequeme Literaturepoche. Viel-
leicht hätte der Verfasser mit dem Material hin und wieder doch noch freier schalten
sollen, etwa indem er stärker den Mut des Weglassens bewährt hätte1). So wider-
streitet dem ganz offensichtlichen Streben des Verfassers nach gefälliger Darstellung
doch öfter die nun eben vorhandene Stoffülle, die dann auch er nicht anders als lehr-
buchmäßig zu bewältigen vermochte. Was sind etwa seine Ausführungen (116 ff.)
über Panegyrik, Trauergedichte, Liebeslied, Heroiden, bukolische Dichtung, Natur-
gefühl, Reisegedichte, Städtegedichte — der Druckfehlerteufel läßt (207) neckischer-
weise Hans Sachs seine Vaterschaft statt Vaterstadt besingen —, historische
J) Da Golther im Bd. I der „Epochen" die Darstellung schon bis 1500 geführt
hatte, hätte St. sie wohl nicht noch einmal bei 1400 aufzunehmen brauchen, zumal
er etwa über die Mystik, die er sogar im Buchtitel hervorhebt, gegenüber Golther
auch nichts Wesentliches mehr sagen konnte.
BESPRECHUNGEN.
zes Kapitel. Die neuere Fabeldichtung etwa sei nur „das letzte Glied in der mittel-
alterlichen Fabeldichtung" (215), Meistersang und Volkslied desgleichen zwei Sei-
ten der mittelalterlichen Lyrik, die sich bis an die Grenze des Barocks gerettet
hätten (234) und die Kontrafakturen der Zeit geben Stammler Anlaß zu der Be-
merkung: „daß aber gerade die geistliche Dichtung der Reformation sich dieses
Typus so eifrig bemächtigt hat, zeigt, wie stark sie noch in allen literarischen Grund-
lagen vom Mittelalter abhing" (239). Wenn Stammler auch andrerseits etwa zu-
gestehen muß: „neben dem Schauspiel hat die Lutherische Bewegung das Kirchen-
lied zu voller Macht gebracht" (358), so versucht er doch eben, dergleichen un-
vermeidliche Zugeständnisse durch den Hinweis auf mittelalterliche Abhängigkeiten
in ihrer Bedeutung abzuschwächen. Dadurch, daß dieser und jener Literaturgattung
eine Entwicklung seit der mittelalterlichen Überlieferung fehlen solle, will Stammler
den Einfluß der humanistischen, wenn auch lateinischen, auf die neue deutsche Lite-
ratur als maßgebend erscheinen lassen. Dennoch vermag auch Stammlers geschick-
teste Sachwaltung m. E. nicht das Paradoxon glaubhaft zu machen, es sei zwar in
dieser Epoche eine breite deutsch sprachige Literatur vorhanden, aber für die
Weiterentwicklung der deutschen Literatur nicht entscheidend gewesen; ihr neuer
Aufschwung sei vielmehr durch den fast ausschließlich 1 a t e i n sprachigen Huma-
nismus, den die weitesten Volkskreise gar nicht verstehen konnten, veranlaßt und
nachhaltig beeinflußt worden. Und um so weniger glaubhaft erscheint diese These,
in je breiterem Maße Stammler von unhumanistischen deutschen Literaturdenkmalen,
Gattungen, Einzelwerken und Persönlichkeiten dieser Zeit erzählen muß, deren Son-
derbedeutung und Einfluß auch er in vollem Maße anerkennt. Ja, zuweilen gewinnt
man den Eindruck, als gehöre selbst Stammlers lebhafterer Anteil schließlich doch
jenen deutschen Werken, als spreche bei ihm zwar Intellekt und Wille für den
lateinischen Humanismus, das Gefühl aber für die gleichzeitige deutsche Literatur,
von der er etwa den Meistersang mit besonderer Liebe behandelt. Was ihn dann
aber zum Verfechter solch paradoxer These werden läßt, ist der Zwang des neuzeit-
lichen Intellektualismus zu „moderner" Umwertung und auch die humanistischem
Ideal verwandte Neigung heutiger Wissenschaft zur Wissenschaft um ihrer selbst
willen. So redet er im unbegrenzten Rühmen des Humanismus derselben Über-
schätzung exklusiven intellektualistischen Wissenschaftsbetriebes das Wort, wie sie
heute bei uns verhängnisvoll herrscht.
Von solchen Bedenken erregenden. Dokumentationen umwertender Voreingenom-
menheit abgesehen hat jedoch Stammlers Buch unleugbar auch seine Verdienste.
Gibt es doch auf Grund emsig gesammelter einzelner Forschungsergebnisse — der
Anmerkungsapparat umfaßt allein 95 Seiten! — einen sehr flüssig geschriebenen
Überblick über diese für den Darsteller nicht eben bequeme Literaturepoche. Viel-
leicht hätte der Verfasser mit dem Material hin und wieder doch noch freier schalten
sollen, etwa indem er stärker den Mut des Weglassens bewährt hätte1). So wider-
streitet dem ganz offensichtlichen Streben des Verfassers nach gefälliger Darstellung
doch öfter die nun eben vorhandene Stoffülle, die dann auch er nicht anders als lehr-
buchmäßig zu bewältigen vermochte. Was sind etwa seine Ausführungen (116 ff.)
über Panegyrik, Trauergedichte, Liebeslied, Heroiden, bukolische Dichtung, Natur-
gefühl, Reisegedichte, Städtegedichte — der Druckfehlerteufel läßt (207) neckischer-
weise Hans Sachs seine Vaterschaft statt Vaterstadt besingen —, historische
J) Da Golther im Bd. I der „Epochen" die Darstellung schon bis 1500 geführt
hatte, hätte St. sie wohl nicht noch einmal bei 1400 aufzunehmen brauchen, zumal
er etwa über die Mystik, die er sogar im Buchtitel hervorhebt, gegenüber Golther
auch nichts Wesentliches mehr sagen konnte.