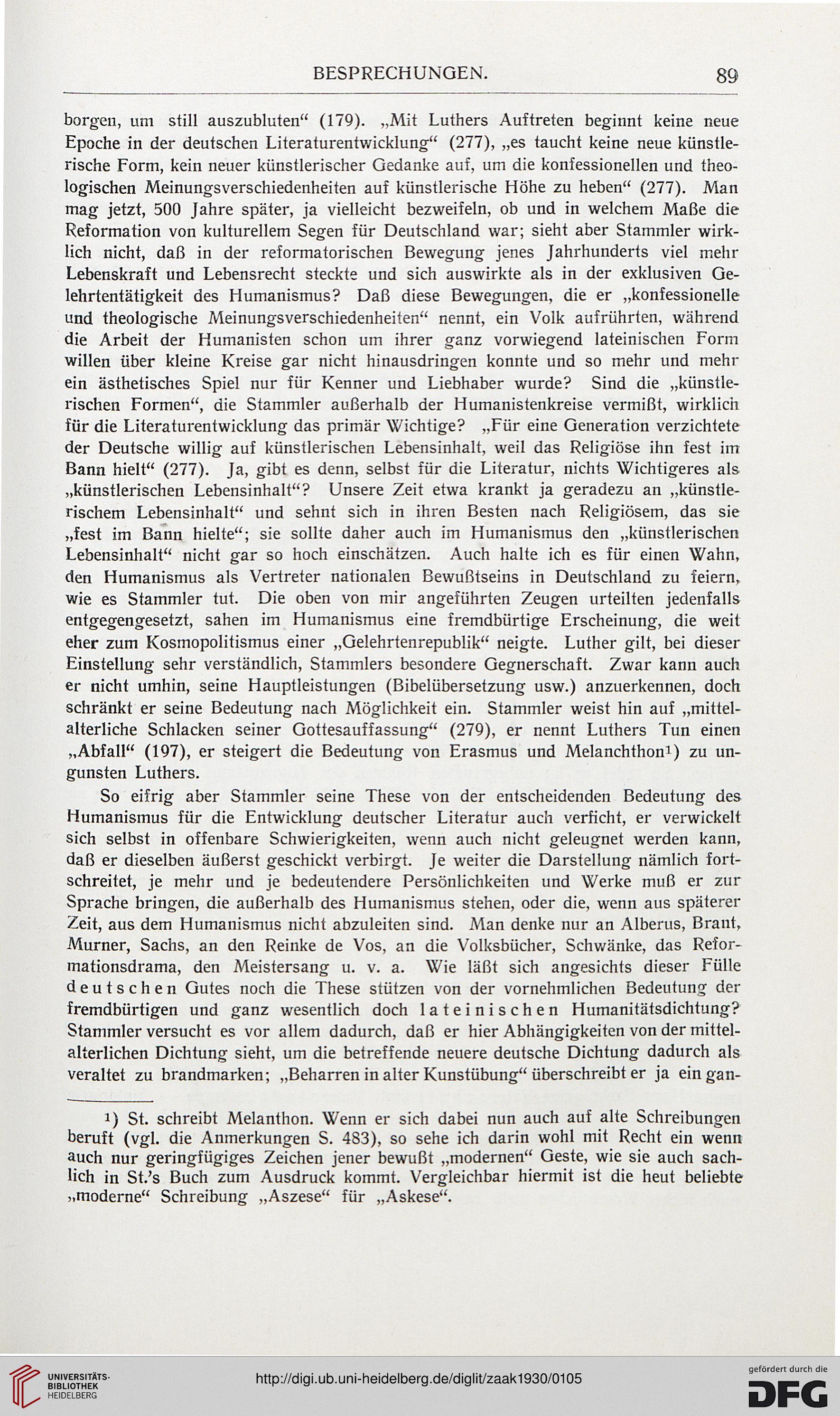BESPRECHUNGEN.
89
borgen, um still auszubluten" (179). „Mit Luthers Auftreten beginnt keine neue
Epoche in der deutschen Literaturentwicklung" (277), „es taucht keine neue künstle-
rische Form, kein neuer künstlerischer Gedanke auf, um die konfessionellen und theo-
logischen Meinungsverschiedenheiten auf künstlerische Höhe zu heben" (277). Man
mag jetzt, 500 Jahre später, ja vielleicht bezweifeln, ob und in welchem Maße die
Reformation von kulturellem Segen für Deutschland war; sieht aber Stammler wirk-
lich nicht, daß in der reformatorischen Bewegung jenes Jahrhunderts viel mehr
Lebenskraft und Lebensrecht steckte und sich auswirkte als in der exklusiven Ge-
lehrtentätigkeit des Humanismus? Daß diese Bewegungen, die er „konfessionelle
und theologische Meinungsverschiedenheiten" nennt, ein Volk aufrührten, während
die Arbeit der Humanisten schon um ihrer ganz vorwiegend lateinischen Form
willen über kleine Kreise gar nicht hinausdringen konnte und so mehr und mehr
ein ästhetisches Spiel nur für Kenner und Liebhaber wurde? Sind die „künstle-
rischen Formen", die Stammler außerhalb der Humanistenkreise vermißt, wirklich
für die Literaturentwicklung das primär Wichtige? „Für eine Generation verzichtete
der Deutsche willig auf künstlerischen Lebensinhalt, weil das Religiöse ihn fest im
Bann hielt" (277). Ja, gibt es denn, selbst für die Literatur, nichts Wichtigeres als
„künstlerischen Lebensinhalt"? Unsere Zeit etwa krankt ja geradezu an „künstle-
rischem Lebensinhalt" und sehnt sich in ihren Besten nach Religiösem, das sie
„fest im Bann hielte"; sie sollte daher auch im Humanismus den „künstlerischen
Lebensinhalt" nicht gar so hoch einschätzen. Auch halte ich es für einen Wahn,
den Humanismus als Vertreter nationalen Bewußtseins in Deutschland zu feiern,
wie es Stammler tut. Die oben von mir angeführten Zeugen urteilten jedenfalls
entgegengesetzt, sahen im Humanismus eine fremdbürtige Erscheinung, die weit
eher zum Kosmopolitismus einer „Gelehrtenrepublik" neigte. Luther gilt, bei dieser
Einstellung sehr verständlich, Stammlers besondere Gegnerschaft. Zwar kann auch
er nicht umhin, seine Hauptleistungen (Bibelübersetzung usw.) anzuerkennen, doch
schränkt er seine Bedeutung nach Möglichkeit ein. Stammler weist hin auf „mittel-
alterliche Schlacken seiner Gottesauffassung" (279), er nennt Luthers Tun einen
„Abfall" (197), er steigert die Bedeutung von Erasmus und Melanchthon1) zu Un-
gunsten Luthers.
So eifrig aber Stammler seine These von der entscheidenden Bedeutung des
Humanismus für die Entwicklung deutscher Literatur auch verficht, er verwickelt
sich selbst in offenbare Schwierigkeiten, wenn auch nicht geleugnet werden kann,
daß er dieselben äußerst geschickt verbirgt. Je weiter die Darstellung nämlich fort-
schreitet, je mehr und je bedeutendere Persönlichkeiten und Werke muß er zur
Sprache bringen, die außerhalb des Humanismus stehen, oder die, wenn aus späterer
Zeit, aus dem Humanismus nicht abzuleiten sind. Man denke nur an Alberus, Braut,
Murner, Sachs, an den Reinke de Vos, an die Volksbücher, Schwänke, das Refor-
mationsdrama, den Meistersang u. v. a. Wie läßt sich angesichts dieser Fülle
deutschen Gutes noch die These stützen von der vornehmlichen Bedeutung der
fremdbürtigen und ganz wesentlich doch lateinischen Humanitätsdichtung?
Stammler versucht es vor allem dadurch, daß er hier Abhängigkeiten von der mittel-
alterlichen Dichtung sieht, um die betreffende neuere deutsche Dichtung dadurch als
veraltet zu brandmarken; „Beharren in alter Kunstübung" überschreibt er ja ein gan-
i) St. schreibt Melanthon. Wenn er sich dabei nun auch auf alte Schreibungen
beruft (vgl. die Anmerkungen S. 483), so sehe ich darin wohl mit Recht ein wenn
auch nur geringfügiges Zeichen jener bewußt „modernen" Geste, wie sie auch sach-
lich in St.'s Buch zum Ausdruck kommt. Vergleichbar hiermit ist die heut beliebte
»moderne" Schreibung „Aszese" für „Askese".
89
borgen, um still auszubluten" (179). „Mit Luthers Auftreten beginnt keine neue
Epoche in der deutschen Literaturentwicklung" (277), „es taucht keine neue künstle-
rische Form, kein neuer künstlerischer Gedanke auf, um die konfessionellen und theo-
logischen Meinungsverschiedenheiten auf künstlerische Höhe zu heben" (277). Man
mag jetzt, 500 Jahre später, ja vielleicht bezweifeln, ob und in welchem Maße die
Reformation von kulturellem Segen für Deutschland war; sieht aber Stammler wirk-
lich nicht, daß in der reformatorischen Bewegung jenes Jahrhunderts viel mehr
Lebenskraft und Lebensrecht steckte und sich auswirkte als in der exklusiven Ge-
lehrtentätigkeit des Humanismus? Daß diese Bewegungen, die er „konfessionelle
und theologische Meinungsverschiedenheiten" nennt, ein Volk aufrührten, während
die Arbeit der Humanisten schon um ihrer ganz vorwiegend lateinischen Form
willen über kleine Kreise gar nicht hinausdringen konnte und so mehr und mehr
ein ästhetisches Spiel nur für Kenner und Liebhaber wurde? Sind die „künstle-
rischen Formen", die Stammler außerhalb der Humanistenkreise vermißt, wirklich
für die Literaturentwicklung das primär Wichtige? „Für eine Generation verzichtete
der Deutsche willig auf künstlerischen Lebensinhalt, weil das Religiöse ihn fest im
Bann hielt" (277). Ja, gibt es denn, selbst für die Literatur, nichts Wichtigeres als
„künstlerischen Lebensinhalt"? Unsere Zeit etwa krankt ja geradezu an „künstle-
rischem Lebensinhalt" und sehnt sich in ihren Besten nach Religiösem, das sie
„fest im Bann hielte"; sie sollte daher auch im Humanismus den „künstlerischen
Lebensinhalt" nicht gar so hoch einschätzen. Auch halte ich es für einen Wahn,
den Humanismus als Vertreter nationalen Bewußtseins in Deutschland zu feiern,
wie es Stammler tut. Die oben von mir angeführten Zeugen urteilten jedenfalls
entgegengesetzt, sahen im Humanismus eine fremdbürtige Erscheinung, die weit
eher zum Kosmopolitismus einer „Gelehrtenrepublik" neigte. Luther gilt, bei dieser
Einstellung sehr verständlich, Stammlers besondere Gegnerschaft. Zwar kann auch
er nicht umhin, seine Hauptleistungen (Bibelübersetzung usw.) anzuerkennen, doch
schränkt er seine Bedeutung nach Möglichkeit ein. Stammler weist hin auf „mittel-
alterliche Schlacken seiner Gottesauffassung" (279), er nennt Luthers Tun einen
„Abfall" (197), er steigert die Bedeutung von Erasmus und Melanchthon1) zu Un-
gunsten Luthers.
So eifrig aber Stammler seine These von der entscheidenden Bedeutung des
Humanismus für die Entwicklung deutscher Literatur auch verficht, er verwickelt
sich selbst in offenbare Schwierigkeiten, wenn auch nicht geleugnet werden kann,
daß er dieselben äußerst geschickt verbirgt. Je weiter die Darstellung nämlich fort-
schreitet, je mehr und je bedeutendere Persönlichkeiten und Werke muß er zur
Sprache bringen, die außerhalb des Humanismus stehen, oder die, wenn aus späterer
Zeit, aus dem Humanismus nicht abzuleiten sind. Man denke nur an Alberus, Braut,
Murner, Sachs, an den Reinke de Vos, an die Volksbücher, Schwänke, das Refor-
mationsdrama, den Meistersang u. v. a. Wie läßt sich angesichts dieser Fülle
deutschen Gutes noch die These stützen von der vornehmlichen Bedeutung der
fremdbürtigen und ganz wesentlich doch lateinischen Humanitätsdichtung?
Stammler versucht es vor allem dadurch, daß er hier Abhängigkeiten von der mittel-
alterlichen Dichtung sieht, um die betreffende neuere deutsche Dichtung dadurch als
veraltet zu brandmarken; „Beharren in alter Kunstübung" überschreibt er ja ein gan-
i) St. schreibt Melanthon. Wenn er sich dabei nun auch auf alte Schreibungen
beruft (vgl. die Anmerkungen S. 483), so sehe ich darin wohl mit Recht ein wenn
auch nur geringfügiges Zeichen jener bewußt „modernen" Geste, wie sie auch sach-
lich in St.'s Buch zum Ausdruck kommt. Vergleichbar hiermit ist die heut beliebte
»moderne" Schreibung „Aszese" für „Askese".