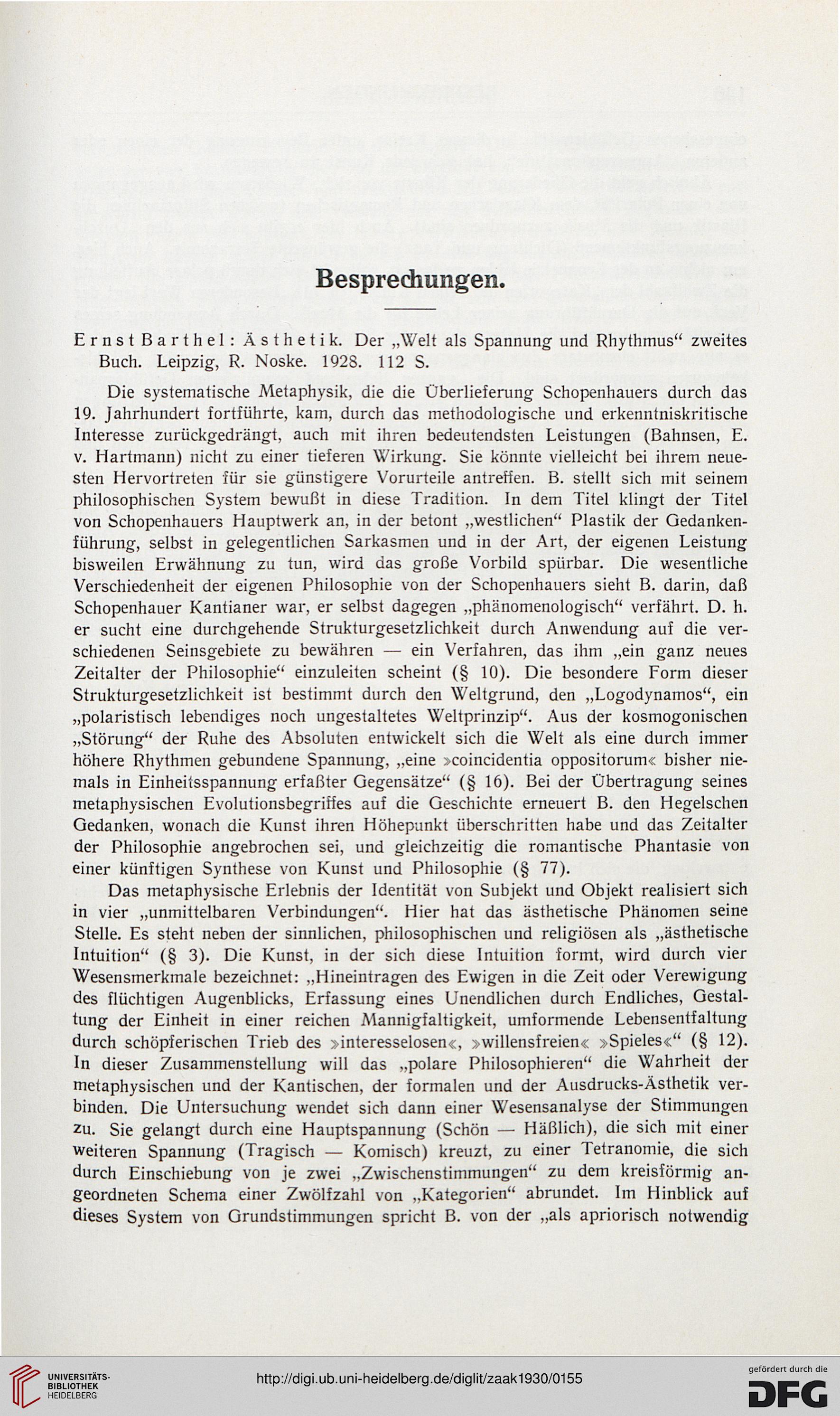Besprechungen.
ErnstBarthel: Ästhetik. Der „Welt als Spannung und Rhythmus" zweites
Buch. Leipzig, R. Noske. 1928. 112 S.
Die systematische Metaphysik, die die Überlieferung Schopenhauers durch das
19. Jahrhundert fortführte, kam, durch das methodologische und erkenntniskritische
Interesse zurückgedrängt, auch mit ihren bedeutendsten Leistungen (Bahnsen, E.
v. Hartmann) nicht zu einer tieferen Wirkung. Sie könnte vielleicht bei ihrem neue-
sten Hervortreten für sie günstigere Vorurteile antreffen. B. stellt sich mit seinem
philosophischen System bewußt in diese Tradition. In dem Titel klingt der Titel
von Schopenhauers Hauptwerk an, in der betont „westlichen" Plastik der Gedanken-
führung, selbst in gelegentlichen Sarkasmen und in der Art, der eigenen Leistung
bisweilen Erwähnung zu tun, wird das große Vorbild spürbar. Die wesentliche
Verschiedenheit der eigenen Philosophie von der Schopenhauers sieht B. darin, daß
Schopenhauer Kantianer war, er selbst dagegen „phänomenologisch" verfährt. D. h.
er sucht eine durchgehende Strukturgesetzlichkeit durch Anwendung auf die ver-
schiedenen Seinsgebiete zu bewähren — ein Verfahren, das ihm „ein ganz neues
Zeitalter der Philosophie" einzuleiten scheint (§ 10). Die besondere Form dieser
Strukturgesetzlichkeit ist bestimmt durch den Weltgrund, den „Logodynamos", ein
„polaristisch lebendiges noch ungestaltetes Weltprinzip". Aus der kosmogonischen
„Störung" der Ruhe des Absoluten entwickelt sich die Welt als eine durch immer
höhere Rhythmen gebundene Spannung, „eine »coincidentia oppositorum« bisher nie-
mals in Einheitsspannung erfaßter Gegensätze" (§ 16). Bei der Übertragung seines
metaphysischen Evolutionsbegriffes auf die Geschichte erneuert B. den Hegeischen
Gedanken, wonach die Kunst ihren Höhepunkt überschritten habe und das Zeitalter
der Philosophie angebrochen sei, und gleichzeitig die romantische Phantasie von
einer künftigen Synthese von Kunst und Philosophie (§ 77).
Das metaphysische Erlebnis der Identität von Subjekt und Objekt realisiert sich
in vier „unmittelbaren Verbindungen". Hier hat das ästhetische Phänomen seine
Stelle. Es steht neben der sinnlichen, philosophischen und religiösen als „ästhetische
Intuition" (§ 3). Die Kunst, in der sich diese Intuition formt, wird durch vier
Wesensmerkmale bezeichnet: „Hineintragen des Ewigen in die Zeit oder Verewigung
des flüchtigen Augenblicks, Erfassung eines Unendlichen durch Endliches, Gestal-
tung der Einheit in einer reichen Mannigfaltigkeit, umformende Lebensentfaltung
durch schöpferischen Trieb des »interesselosen«, »willensfreien« »Spieles«" (§ 12).
In dieser Zusammenstellung will das „polare Philosophieren" die Wahrheit der
metaphysischen und der Kantischen, der formalen und der Ausdrucks-Ästhetik ver-
binden. Die Untersuchung wendet sich dann einer Wesensanalyse der Stimmungen
zu. Sie gelangt durch eine Hauptspannung (Schön — Häßlich), die sich mit einer
weiteren Spannung (Tragisch — Komisch) kreuzt, zu einer Tetranomie, die sich
durch Einschiebung von je zwei „Zwischenstimmungen" zu dem kreisförmig an-
geordneten Schema einer Zwölfzahl von „Kategorien" abrundet. Im Hinblick auf
dieses System von Grundstimmungen spricht B. von der „als apriorisch notwendig
ErnstBarthel: Ästhetik. Der „Welt als Spannung und Rhythmus" zweites
Buch. Leipzig, R. Noske. 1928. 112 S.
Die systematische Metaphysik, die die Überlieferung Schopenhauers durch das
19. Jahrhundert fortführte, kam, durch das methodologische und erkenntniskritische
Interesse zurückgedrängt, auch mit ihren bedeutendsten Leistungen (Bahnsen, E.
v. Hartmann) nicht zu einer tieferen Wirkung. Sie könnte vielleicht bei ihrem neue-
sten Hervortreten für sie günstigere Vorurteile antreffen. B. stellt sich mit seinem
philosophischen System bewußt in diese Tradition. In dem Titel klingt der Titel
von Schopenhauers Hauptwerk an, in der betont „westlichen" Plastik der Gedanken-
führung, selbst in gelegentlichen Sarkasmen und in der Art, der eigenen Leistung
bisweilen Erwähnung zu tun, wird das große Vorbild spürbar. Die wesentliche
Verschiedenheit der eigenen Philosophie von der Schopenhauers sieht B. darin, daß
Schopenhauer Kantianer war, er selbst dagegen „phänomenologisch" verfährt. D. h.
er sucht eine durchgehende Strukturgesetzlichkeit durch Anwendung auf die ver-
schiedenen Seinsgebiete zu bewähren — ein Verfahren, das ihm „ein ganz neues
Zeitalter der Philosophie" einzuleiten scheint (§ 10). Die besondere Form dieser
Strukturgesetzlichkeit ist bestimmt durch den Weltgrund, den „Logodynamos", ein
„polaristisch lebendiges noch ungestaltetes Weltprinzip". Aus der kosmogonischen
„Störung" der Ruhe des Absoluten entwickelt sich die Welt als eine durch immer
höhere Rhythmen gebundene Spannung, „eine »coincidentia oppositorum« bisher nie-
mals in Einheitsspannung erfaßter Gegensätze" (§ 16). Bei der Übertragung seines
metaphysischen Evolutionsbegriffes auf die Geschichte erneuert B. den Hegeischen
Gedanken, wonach die Kunst ihren Höhepunkt überschritten habe und das Zeitalter
der Philosophie angebrochen sei, und gleichzeitig die romantische Phantasie von
einer künftigen Synthese von Kunst und Philosophie (§ 77).
Das metaphysische Erlebnis der Identität von Subjekt und Objekt realisiert sich
in vier „unmittelbaren Verbindungen". Hier hat das ästhetische Phänomen seine
Stelle. Es steht neben der sinnlichen, philosophischen und religiösen als „ästhetische
Intuition" (§ 3). Die Kunst, in der sich diese Intuition formt, wird durch vier
Wesensmerkmale bezeichnet: „Hineintragen des Ewigen in die Zeit oder Verewigung
des flüchtigen Augenblicks, Erfassung eines Unendlichen durch Endliches, Gestal-
tung der Einheit in einer reichen Mannigfaltigkeit, umformende Lebensentfaltung
durch schöpferischen Trieb des »interesselosen«, »willensfreien« »Spieles«" (§ 12).
In dieser Zusammenstellung will das „polare Philosophieren" die Wahrheit der
metaphysischen und der Kantischen, der formalen und der Ausdrucks-Ästhetik ver-
binden. Die Untersuchung wendet sich dann einer Wesensanalyse der Stimmungen
zu. Sie gelangt durch eine Hauptspannung (Schön — Häßlich), die sich mit einer
weiteren Spannung (Tragisch — Komisch) kreuzt, zu einer Tetranomie, die sich
durch Einschiebung von je zwei „Zwischenstimmungen" zu dem kreisförmig an-
geordneten Schema einer Zwölfzahl von „Kategorien" abrundet. Im Hinblick auf
dieses System von Grundstimmungen spricht B. von der „als apriorisch notwendig