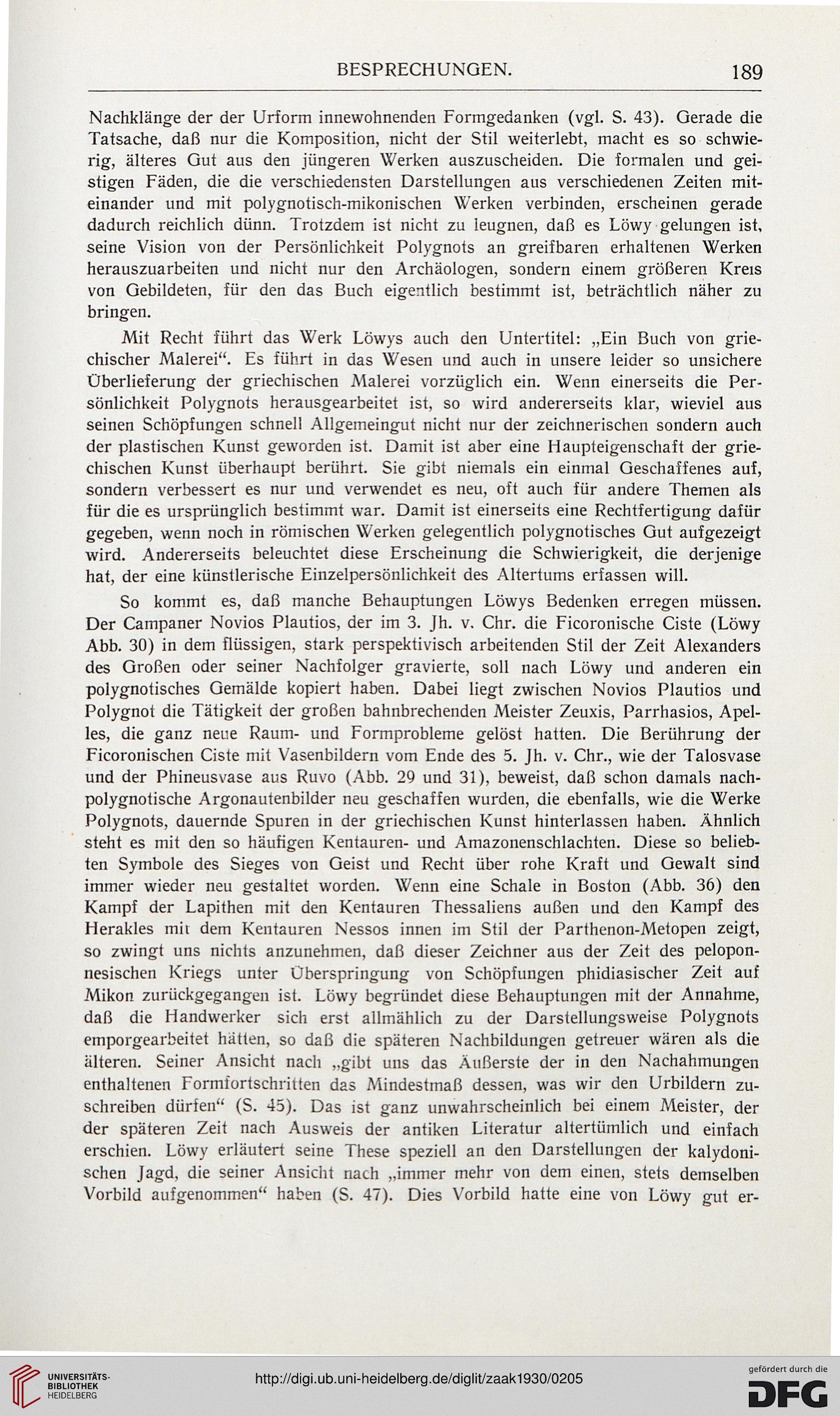BESPRECHUNGEN.
189
Nachklänge der der Urform innewohnenden Formgedanken (vgl. S. 43). Gerade die
Tatsache, daß nur die Komposition, nicht der Stil weiterlebt, macht es so schwie-
rig, älteres Gut aus den jüngeren Werken auszuscheiden. Die formalen und gei-
stigen Fäden, die die verschiedensten Darstellungen aus verschiedenen Zeiten mit-
einander und mit polygnotisch-mikonischen Werken verbinden, erscheinen gerade
dadurch reichlich dünn. Trotzdem ist nicht zu leugnen, daß es Löwy gelungen ist,
seine Vision von der Persönlichkeit Polygnots an greifbaren erhaltenen Werken
herauszuarbeiten und nicht nur den Archäologen, sondern einem größeren Kreis
von Gebildeten, für den das Buch eigentlich bestimmt ist, beträchtlich näher zu
bringen.
Mit Recht führt das Werk Löwys auch den Untertitel: „Ein Buch von grie-
chischer Malerei". Es führt in das Wesen und auch in unsere leider so unsichere
Überlieferung der griechischen Malerei vorzüglich ein. Wenn einerseits die Per-
sönlichkeit Polygnots herausgearbeitet ist, so wird andererseits klar, wieviel aus
seinen Schöpfungen schnell Allgemeingut nicht nur der zeichnerischen sondern auch
der plastischen Kunst geworden ist. Damit ist aber eine Haupteigenschaft der grie-
chischen Kunst überhaupt berührt. Sie gibt niemals ein einmal Geschaffenes auf,
sondern verbessert es nur und verwendet es neu, oft auch für andere Themen als
für die es ursprünglich bestimmt war. Damit ist einerseits eine Rechtfertigung dafür
gegeben, wenn noch in römischen Werken gelegentlich polygnotisches Gut aufgezeigt
wird. Andererseits beleuchtet diese Erscheinung die Schwierigkeit, die derjenige
hat, der eine künstlerische Einzelpersönlichkeit des Altertums erfassen will.
So kommt es, daß manche Behauptungen Löwys Bedenken erregen müssen.
Der Campaner Novios Plautios, der im 3. Jh. v. Chr. die Ficoronische Ciste (Löwy
Abb. 30) in dem flüssigen, stark perspektivisch arbeitenden Stil der Zeit Alexanders
des Großen oder seiner Nachfolger gravierte, soll nach Löwy und anderen ein
polygnotisches Gemälde kopiert haben. Dabei liegt zwischen Novios Plautios und
Polygnot die Tätigkeit der großen bahnbrechenden Meister Zeuxis, Parrhasios, Apel-
les, die ganz neue Raum- und Formprobleme gelöst hatten. Die Berührung der
Ficoronischen Ciste mit Vasenbildern vom Ende des 5. Jh. v. Chr., wie der Talosvase
und der Phineusvase aus Ruvo (Abb. 29 und 31), beweist, daß schon damals nach-
polygnotische Argonautenbilder neu geschaffen wurden, die ebenfalls, wie die Werke
Polygnots, dauernde Spuren in der griechischen Kunst hinterlassen haben. Ähnlich
steht es mit den so häufigen Kentauren- und Amazonenschlachten. Diese so belieb-
ten Symbole des Sieges von Geist und Recht über rohe Kraft und Gewalt sind
immer wieder neu gestaltet worden. Wenn eine Schale in Boston (Abb. 36) den
Kampf der Lapithen mit den Kentauren Thessaliens außen und den Kampf des
Herakles mit dem Kentauren Nessos innen im Stil der Parthenon-Metopen zeigt,
so zwingt uns nichts anzunehmen, daß dieser Zeichner aus der Zeit des pelopon-
nesischen Kriegs unter Überspringung von Schöpfungen phidiasischer Zeit auf
Mikon zurückgegangen ist. Löwy begründet diese Behauptungen mit der Annahme,
daß die Handwerker sich erst allmählich zu der Darstellungsweise Polygnots
emporgearbeitet hätten, so daß die späteren Nachbildungen getreuer wären als die
älteren. Seiner Ansicht nach „gibt uns das Äußerste der in den Nachahmungen
enthaltenen Formlortschritten das Mindestmaß dessen, was wir den Urbildern zu-
schreiben dürfen" (S. 45). Das ist ganz unwahrscheinlich bei einem Meister, der
der späteren Zeit nach Ausweis der antiken Literatur altertümlich und einfach
erschien. Löwy erläutert seine These speziell an den Darstellungen der kalydoni-
schen Jagd, die seiner Ansicht nach „immer mehr von dem einen, stets demselben
Vorbild aufgenommen" haben (S. 47). Dies Vorbild hatte eine von Löwy gut er-
189
Nachklänge der der Urform innewohnenden Formgedanken (vgl. S. 43). Gerade die
Tatsache, daß nur die Komposition, nicht der Stil weiterlebt, macht es so schwie-
rig, älteres Gut aus den jüngeren Werken auszuscheiden. Die formalen und gei-
stigen Fäden, die die verschiedensten Darstellungen aus verschiedenen Zeiten mit-
einander und mit polygnotisch-mikonischen Werken verbinden, erscheinen gerade
dadurch reichlich dünn. Trotzdem ist nicht zu leugnen, daß es Löwy gelungen ist,
seine Vision von der Persönlichkeit Polygnots an greifbaren erhaltenen Werken
herauszuarbeiten und nicht nur den Archäologen, sondern einem größeren Kreis
von Gebildeten, für den das Buch eigentlich bestimmt ist, beträchtlich näher zu
bringen.
Mit Recht führt das Werk Löwys auch den Untertitel: „Ein Buch von grie-
chischer Malerei". Es führt in das Wesen und auch in unsere leider so unsichere
Überlieferung der griechischen Malerei vorzüglich ein. Wenn einerseits die Per-
sönlichkeit Polygnots herausgearbeitet ist, so wird andererseits klar, wieviel aus
seinen Schöpfungen schnell Allgemeingut nicht nur der zeichnerischen sondern auch
der plastischen Kunst geworden ist. Damit ist aber eine Haupteigenschaft der grie-
chischen Kunst überhaupt berührt. Sie gibt niemals ein einmal Geschaffenes auf,
sondern verbessert es nur und verwendet es neu, oft auch für andere Themen als
für die es ursprünglich bestimmt war. Damit ist einerseits eine Rechtfertigung dafür
gegeben, wenn noch in römischen Werken gelegentlich polygnotisches Gut aufgezeigt
wird. Andererseits beleuchtet diese Erscheinung die Schwierigkeit, die derjenige
hat, der eine künstlerische Einzelpersönlichkeit des Altertums erfassen will.
So kommt es, daß manche Behauptungen Löwys Bedenken erregen müssen.
Der Campaner Novios Plautios, der im 3. Jh. v. Chr. die Ficoronische Ciste (Löwy
Abb. 30) in dem flüssigen, stark perspektivisch arbeitenden Stil der Zeit Alexanders
des Großen oder seiner Nachfolger gravierte, soll nach Löwy und anderen ein
polygnotisches Gemälde kopiert haben. Dabei liegt zwischen Novios Plautios und
Polygnot die Tätigkeit der großen bahnbrechenden Meister Zeuxis, Parrhasios, Apel-
les, die ganz neue Raum- und Formprobleme gelöst hatten. Die Berührung der
Ficoronischen Ciste mit Vasenbildern vom Ende des 5. Jh. v. Chr., wie der Talosvase
und der Phineusvase aus Ruvo (Abb. 29 und 31), beweist, daß schon damals nach-
polygnotische Argonautenbilder neu geschaffen wurden, die ebenfalls, wie die Werke
Polygnots, dauernde Spuren in der griechischen Kunst hinterlassen haben. Ähnlich
steht es mit den so häufigen Kentauren- und Amazonenschlachten. Diese so belieb-
ten Symbole des Sieges von Geist und Recht über rohe Kraft und Gewalt sind
immer wieder neu gestaltet worden. Wenn eine Schale in Boston (Abb. 36) den
Kampf der Lapithen mit den Kentauren Thessaliens außen und den Kampf des
Herakles mit dem Kentauren Nessos innen im Stil der Parthenon-Metopen zeigt,
so zwingt uns nichts anzunehmen, daß dieser Zeichner aus der Zeit des pelopon-
nesischen Kriegs unter Überspringung von Schöpfungen phidiasischer Zeit auf
Mikon zurückgegangen ist. Löwy begründet diese Behauptungen mit der Annahme,
daß die Handwerker sich erst allmählich zu der Darstellungsweise Polygnots
emporgearbeitet hätten, so daß die späteren Nachbildungen getreuer wären als die
älteren. Seiner Ansicht nach „gibt uns das Äußerste der in den Nachahmungen
enthaltenen Formlortschritten das Mindestmaß dessen, was wir den Urbildern zu-
schreiben dürfen" (S. 45). Das ist ganz unwahrscheinlich bei einem Meister, der
der späteren Zeit nach Ausweis der antiken Literatur altertümlich und einfach
erschien. Löwy erläutert seine These speziell an den Darstellungen der kalydoni-
schen Jagd, die seiner Ansicht nach „immer mehr von dem einen, stets demselben
Vorbild aufgenommen" haben (S. 47). Dies Vorbild hatte eine von Löwy gut er-