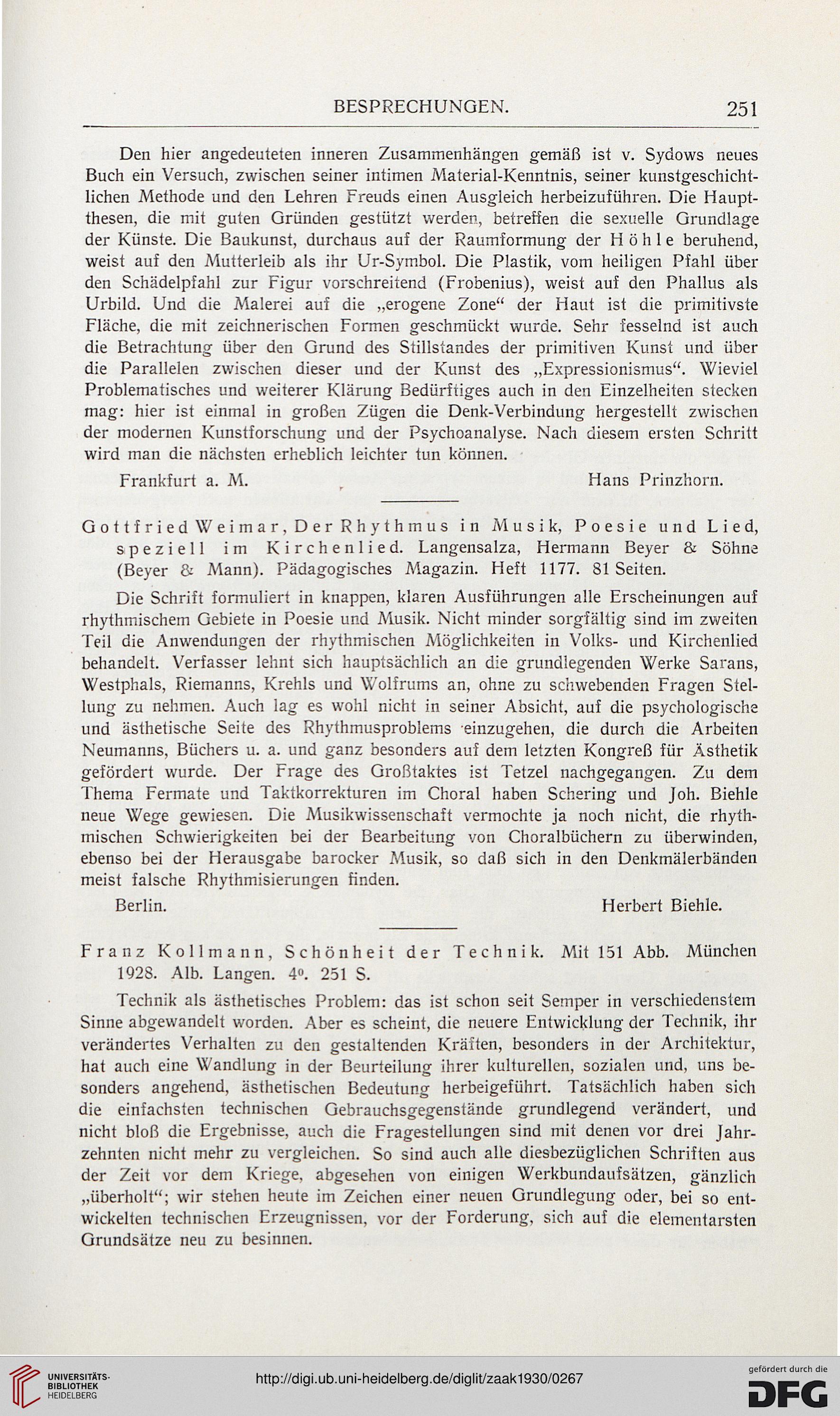BESPRECHUNGEN.
251
Den hier angedeuteten inneren Zusammenhängen gemäß ist v. Sydows neues
Buch ein Versuch, zwischen seiner intimen Material-Kenntnis, seiner kunstgeschicht-
lichen Methode und den Lehren Freuds einen Ausgleich herbeizuführen. Die Haupt-
thesen, die mit guten Gründen gestützt werden, betreffen die sexuelle Grundlage
der Künste. Die Baukunst, durchaus auf der Raumformung der Höhle beruhend,
weist auf den Mutterleib als ihr Ur-Symbol. Die Plastik, vom heiligen Pfahl über
den Schädelpfahl zur Figur vorschreitend (Frobenius), weist auf den Phallus als
Urbild. Und die Malerei auf die „erogene Zone" der Haut ist die primitivste
Fläche, die mit zeichnerischen Formen geschmückt wurde. Sehr fesselnd ist auch
die Betrachtung über den Grund des Stillstandes der primitiven Kunst und über
die Parallelen zwischen dieser und der Kunst des „Expressionismus". Wieviel
Problematisches und weiterer Klärung Bedürftiges auch in den Einzelheiten stecken
mag: hier ist einmal in großen Zügen die Denk-Verbindung hergestellt zwischen
der modernen Kunstforschung und der Psychoanalyse. Nach diesem ersten Schritt
wird man die nächsten erheblich leichter tun können.
Frankfurt a. M. r Hans Prinzhorn.
Gottfried Weimar, Der Rhythmus in Musik, Poesie und Lied,
speziell im Kirchenlied. Langensalza, Hermann Beyer & Söhne
(Beyer & Mann). Pädagogisches Magazin. Heft 1177. 81 Seiten.
Die Schrift formuliert in knappen, klaren Ausführungen alle Erscheinungen auf
rhythmischem Gebiete in Poesie und Musik. Nicht minder sorgfältig sind im zweiten
Teil die Anwendungen der rhythmischen Möglichkeiten in Volks- und Kirchenlied
behandelt. Verfasser lehnt sich hauptsächlich an die grundlegenden Werke Sarans,
Westphals, Riemanns, Krehls und Wolfrums an, ohne zu schwebenden Fragen Stel-
lung zu nehmen. Auch lag es wohl nicht in seiner Absicht, auf die psychologische
und ästhetische Seite des Rhythmusproblems einzugehen, die durch die Arbeiten
Neumanns, Büchers u. a. und ganz besonders auf dem letzten Kongreß für Ästhetik
gefördert wurde. Der Frage des Großtaktes ist Tetzel nachgegangen. Zu dem
Thema Fermate und Taktkorrekturen im Choral haben Schering und Joh. Biehle
neue Wege gewiesen. Die Musikwissenschaft vermochte ja noch nicht, die rhyth-
mischen Schwierigkeiten bei der Bearbeitung von Choralbüchern zu überwinden,
ebenso bei der Herausgabe barocker Musik, so daß sich in den Denkmälerbänden
meist falsche Rhythmisierungen rinden.
Berlin. Herbert Biehle.
Franz Kollmann, Schönheit der Technik. Mit 151 Abb. München
1928. Alb. Langen. 4°. 251 S.
Technik als ästhetisches Problem: das ist schon seit Semper in verschiedenstem
Sinne abgewandelt worden. Aber es scheint, die neuere Entwicklung der Technik, ihr
verändertes Verhalten zu den gestaltenden Kräften, besonders in der Architektur,
hat auch eine Wandlung in der Beurteilung ihrer kulturellen, sozialen und, uns be-
sonders angehend, ästhetischen Bedeutung herbeigeführt. Tatsächlich haben sich
die einfachsten technischen Gebrauchsgegenstände grundlegend verändert, und
nicht bloß die Ergebnisse, auch die Fragestellungen sind mit denen vor drei Jahr-
zehnten nicht mehr zu vergleichen. So sind auch alle diesbezüglichen Schriften aus
der Zeit vor dem Kriege, abgesehen von einigen Werkbundaufsätzen, gänzlich
„überholt"; wir stehen heute im Zeichen einer neuen Grundlegung oder, bei so ent-
wickelten technischen Erzeugnissen, vor der Forderung, sich auf die elementarsten
Grundsätze neu zu besinnen.
251
Den hier angedeuteten inneren Zusammenhängen gemäß ist v. Sydows neues
Buch ein Versuch, zwischen seiner intimen Material-Kenntnis, seiner kunstgeschicht-
lichen Methode und den Lehren Freuds einen Ausgleich herbeizuführen. Die Haupt-
thesen, die mit guten Gründen gestützt werden, betreffen die sexuelle Grundlage
der Künste. Die Baukunst, durchaus auf der Raumformung der Höhle beruhend,
weist auf den Mutterleib als ihr Ur-Symbol. Die Plastik, vom heiligen Pfahl über
den Schädelpfahl zur Figur vorschreitend (Frobenius), weist auf den Phallus als
Urbild. Und die Malerei auf die „erogene Zone" der Haut ist die primitivste
Fläche, die mit zeichnerischen Formen geschmückt wurde. Sehr fesselnd ist auch
die Betrachtung über den Grund des Stillstandes der primitiven Kunst und über
die Parallelen zwischen dieser und der Kunst des „Expressionismus". Wieviel
Problematisches und weiterer Klärung Bedürftiges auch in den Einzelheiten stecken
mag: hier ist einmal in großen Zügen die Denk-Verbindung hergestellt zwischen
der modernen Kunstforschung und der Psychoanalyse. Nach diesem ersten Schritt
wird man die nächsten erheblich leichter tun können.
Frankfurt a. M. r Hans Prinzhorn.
Gottfried Weimar, Der Rhythmus in Musik, Poesie und Lied,
speziell im Kirchenlied. Langensalza, Hermann Beyer & Söhne
(Beyer & Mann). Pädagogisches Magazin. Heft 1177. 81 Seiten.
Die Schrift formuliert in knappen, klaren Ausführungen alle Erscheinungen auf
rhythmischem Gebiete in Poesie und Musik. Nicht minder sorgfältig sind im zweiten
Teil die Anwendungen der rhythmischen Möglichkeiten in Volks- und Kirchenlied
behandelt. Verfasser lehnt sich hauptsächlich an die grundlegenden Werke Sarans,
Westphals, Riemanns, Krehls und Wolfrums an, ohne zu schwebenden Fragen Stel-
lung zu nehmen. Auch lag es wohl nicht in seiner Absicht, auf die psychologische
und ästhetische Seite des Rhythmusproblems einzugehen, die durch die Arbeiten
Neumanns, Büchers u. a. und ganz besonders auf dem letzten Kongreß für Ästhetik
gefördert wurde. Der Frage des Großtaktes ist Tetzel nachgegangen. Zu dem
Thema Fermate und Taktkorrekturen im Choral haben Schering und Joh. Biehle
neue Wege gewiesen. Die Musikwissenschaft vermochte ja noch nicht, die rhyth-
mischen Schwierigkeiten bei der Bearbeitung von Choralbüchern zu überwinden,
ebenso bei der Herausgabe barocker Musik, so daß sich in den Denkmälerbänden
meist falsche Rhythmisierungen rinden.
Berlin. Herbert Biehle.
Franz Kollmann, Schönheit der Technik. Mit 151 Abb. München
1928. Alb. Langen. 4°. 251 S.
Technik als ästhetisches Problem: das ist schon seit Semper in verschiedenstem
Sinne abgewandelt worden. Aber es scheint, die neuere Entwicklung der Technik, ihr
verändertes Verhalten zu den gestaltenden Kräften, besonders in der Architektur,
hat auch eine Wandlung in der Beurteilung ihrer kulturellen, sozialen und, uns be-
sonders angehend, ästhetischen Bedeutung herbeigeführt. Tatsächlich haben sich
die einfachsten technischen Gebrauchsgegenstände grundlegend verändert, und
nicht bloß die Ergebnisse, auch die Fragestellungen sind mit denen vor drei Jahr-
zehnten nicht mehr zu vergleichen. So sind auch alle diesbezüglichen Schriften aus
der Zeit vor dem Kriege, abgesehen von einigen Werkbundaufsätzen, gänzlich
„überholt"; wir stehen heute im Zeichen einer neuen Grundlegung oder, bei so ent-
wickelten technischen Erzeugnissen, vor der Forderung, sich auf die elementarsten
Grundsätze neu zu besinnen.