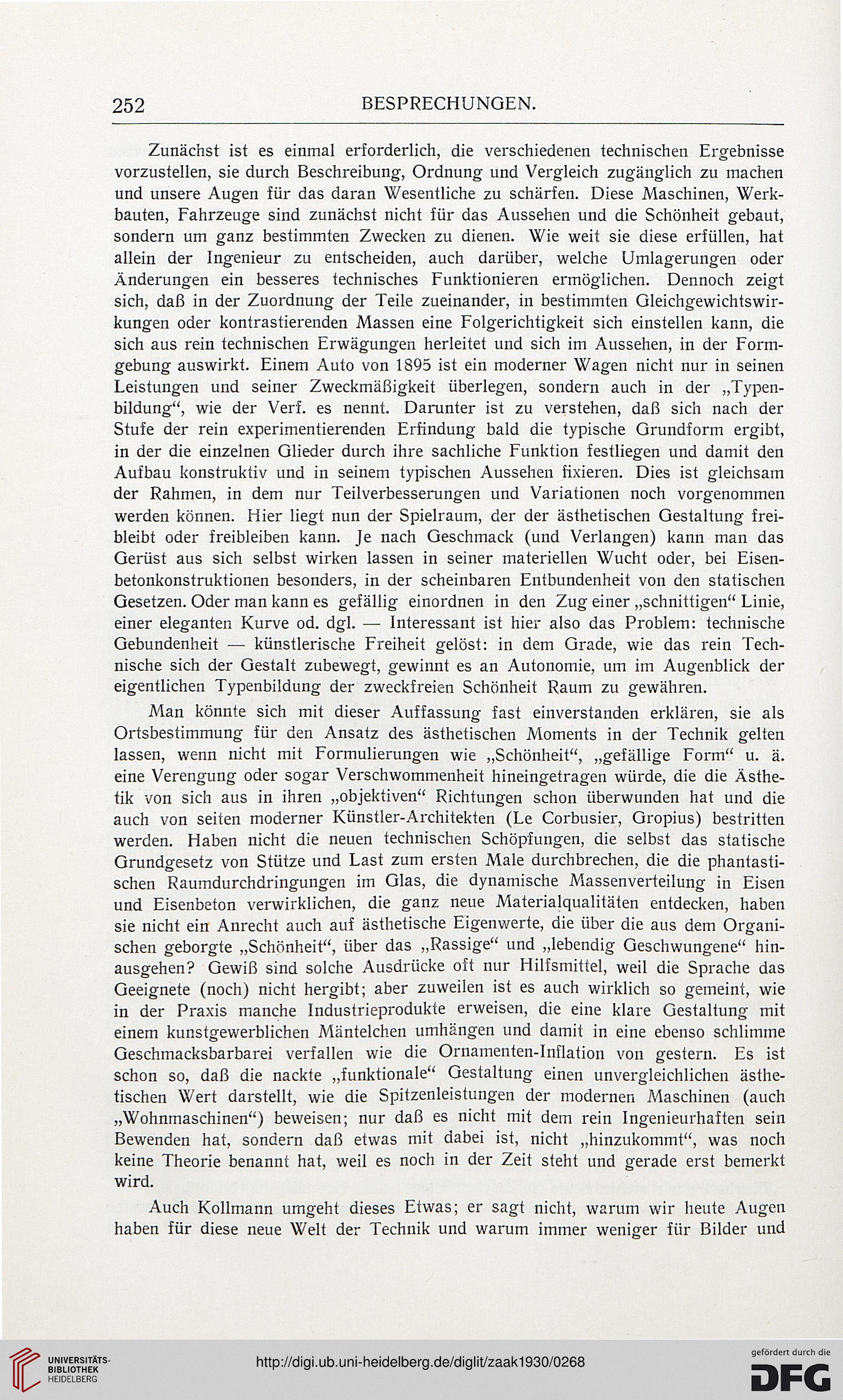252
BESPRECHUNGEN.
Zunächst ist es einmal erforderlich, die verschiedenen technischen Ergebnisse
vorzustellen, sie durch Beschreibung, Ordnung und Vergleich zugänglich zu machen
und unsere Augen für das daran Wesentliche zu schärfen. Diese Maschinen, Werk-
bauten, Fahrzeuge sind zunächst nicht für das Aussehen und die Schönheit gebaut,
sondern um ganz bestimmten Zwecken zu dienen. Wie weit sie diese erfüllen, hat
allein der Ingenieur zu entscheiden, auch darüber, welche Umlagerungen oder
Änderungen ein besseres technisches Funktionieren ermöglichen. Dennoch zeigt
sich, daß in der Zuordnung der Teile zueinander, in bestimmten Gleichgewichtswir-
kungen oder kontrastierenden Massen eine Folgerichtigkeit sich einstellen kann, die
sich aus rein technischen Erwägungen herleitet und sich im Aussehen, in der Form-
gebung auswirkt. Einem Auto von 1895 ist ein moderner Wagen nicht nur in seinen
Leistungen und seiner Zweckmäßigkeit überlegen, sondern auch in der „Typen-
bildung", wie der Verf. es nennt. Darunter ist zu verstehen, daß sich nach der
Stufe der rein experimentierenden Erfindung bald die typische Grundform ergibt,
in der die einzelnen Glieder durch ihre sachliche Funktion festliegen und damit den
Aufbau konstruktiv und in seinem typischen Aussehen fixieren. Dies ist gleichsam
der Rahmen, in dem nur Teilverbesserungen und Variationen noch vorgenommen
werden können. Hier liegt nun der Spielraum, der der ästhetischen Gestaltung frei-
bleibt oder freibleiben kann. Je nach Geschmack (und Verlangen) kann man das
Gerüst aus sich selbst wirken lassen in seiner materiellen Wucht oder, bei Eisen-
betonkonstruktionen besonders, in der scheinbaren Entbundenheit von den statischen
Gesetzen. Oder man kann es gefällig einordnen in den Zug einer „schnittigen" Linie,
einer eleganten Kurve od. dgl. — Interessant ist hier also das Problem: technische
Gebundenheit — künstlerische Freiheit gelöst: in dem Grade, wie das rein Tech-
nische sich der Gestalt zubewegt, gewinnt es an Autonomie, um im Augenblick der
eigentlichen Typenbildung der zweckfreien Schönheit Raum zu gewähren.
Man könnte sich mit dieser Auffassung fast einverstanden erklären, sie als
Ortsbestimmung für den Ansatz des ästhetischen Moments in der Technik gelten
lassen, wenn nicht mit Formulierungen wie „Schönheit", „gefällige Form" u. ä.
eine Verengung oder sogar Verschwommenheit hineingetragen würde, die die Ästhe-
tik von sich aus in ihren „objektiven" Richtungen schon überwunden hat und die
auch von Seiten moderner Künstler-Architekten (Le Corbusier, Gropius) bestritten
werden. Haben nicht die neuen technischen Schöpfungen, die selbst das statische
Grundgesetz von Stütze und Last zum ersten Male durchbrechen, die die phantasti-
schen Raumdurchdringungen im Glas, die dynamische Massenverteilung in Eisen
und Eisenbeton verwirklichen, die ganz neue Materialqualitäten entdecken, haben
sie nicht ein Anrecht auch auf ästhetische Eigenwerte, die über die aus dem Organi-
schen geborgte „Schönheit", über das „Rassige" und „lebendig Geschwungene" hin-
ausgehen? Gewiß sind solche Ausdrücke oft nur Hilfsmittel, weil die Sprache das
Geeignete (noch) nicht hergibt; aber zuweilen ist es auch wirklich so gemeint, wie
in der Praxis manche Industrieprodukte erweisen, die eine klare Gestaltung mit
einem kunstgewerblichen Mäntelchen umhängen und damit in eine ebenso schlimme
Geschmacksbarbarei verfallen wie die Ornamenten-Inflation von gestern. Es ist
schon so, daß die nackte „funktionale" Gestaltung einen unvergleichlichen ästhe-
tischen Wert darstellt, wie die Spitzenleistungen der modernen Maschinen (auch
„Wohnmaschinen") beweisen; nur daß es nicht mit dem rein Ingenieurhaften sein
Bewenden hat, sondern daß etwas mit dabei ist, nicht „hinzukommt", was noch
keine Theorie benannt hat, weil es noch in der Zeit steht und gerade erst bemerkt
wird.
Auch Kollmann umgeht dieses Etwas; er sagt nicht, warum wir heute Augen
haben für diese neue Welt der Technik und warum immer weniger für Bilder und
BESPRECHUNGEN.
Zunächst ist es einmal erforderlich, die verschiedenen technischen Ergebnisse
vorzustellen, sie durch Beschreibung, Ordnung und Vergleich zugänglich zu machen
und unsere Augen für das daran Wesentliche zu schärfen. Diese Maschinen, Werk-
bauten, Fahrzeuge sind zunächst nicht für das Aussehen und die Schönheit gebaut,
sondern um ganz bestimmten Zwecken zu dienen. Wie weit sie diese erfüllen, hat
allein der Ingenieur zu entscheiden, auch darüber, welche Umlagerungen oder
Änderungen ein besseres technisches Funktionieren ermöglichen. Dennoch zeigt
sich, daß in der Zuordnung der Teile zueinander, in bestimmten Gleichgewichtswir-
kungen oder kontrastierenden Massen eine Folgerichtigkeit sich einstellen kann, die
sich aus rein technischen Erwägungen herleitet und sich im Aussehen, in der Form-
gebung auswirkt. Einem Auto von 1895 ist ein moderner Wagen nicht nur in seinen
Leistungen und seiner Zweckmäßigkeit überlegen, sondern auch in der „Typen-
bildung", wie der Verf. es nennt. Darunter ist zu verstehen, daß sich nach der
Stufe der rein experimentierenden Erfindung bald die typische Grundform ergibt,
in der die einzelnen Glieder durch ihre sachliche Funktion festliegen und damit den
Aufbau konstruktiv und in seinem typischen Aussehen fixieren. Dies ist gleichsam
der Rahmen, in dem nur Teilverbesserungen und Variationen noch vorgenommen
werden können. Hier liegt nun der Spielraum, der der ästhetischen Gestaltung frei-
bleibt oder freibleiben kann. Je nach Geschmack (und Verlangen) kann man das
Gerüst aus sich selbst wirken lassen in seiner materiellen Wucht oder, bei Eisen-
betonkonstruktionen besonders, in der scheinbaren Entbundenheit von den statischen
Gesetzen. Oder man kann es gefällig einordnen in den Zug einer „schnittigen" Linie,
einer eleganten Kurve od. dgl. — Interessant ist hier also das Problem: technische
Gebundenheit — künstlerische Freiheit gelöst: in dem Grade, wie das rein Tech-
nische sich der Gestalt zubewegt, gewinnt es an Autonomie, um im Augenblick der
eigentlichen Typenbildung der zweckfreien Schönheit Raum zu gewähren.
Man könnte sich mit dieser Auffassung fast einverstanden erklären, sie als
Ortsbestimmung für den Ansatz des ästhetischen Moments in der Technik gelten
lassen, wenn nicht mit Formulierungen wie „Schönheit", „gefällige Form" u. ä.
eine Verengung oder sogar Verschwommenheit hineingetragen würde, die die Ästhe-
tik von sich aus in ihren „objektiven" Richtungen schon überwunden hat und die
auch von Seiten moderner Künstler-Architekten (Le Corbusier, Gropius) bestritten
werden. Haben nicht die neuen technischen Schöpfungen, die selbst das statische
Grundgesetz von Stütze und Last zum ersten Male durchbrechen, die die phantasti-
schen Raumdurchdringungen im Glas, die dynamische Massenverteilung in Eisen
und Eisenbeton verwirklichen, die ganz neue Materialqualitäten entdecken, haben
sie nicht ein Anrecht auch auf ästhetische Eigenwerte, die über die aus dem Organi-
schen geborgte „Schönheit", über das „Rassige" und „lebendig Geschwungene" hin-
ausgehen? Gewiß sind solche Ausdrücke oft nur Hilfsmittel, weil die Sprache das
Geeignete (noch) nicht hergibt; aber zuweilen ist es auch wirklich so gemeint, wie
in der Praxis manche Industrieprodukte erweisen, die eine klare Gestaltung mit
einem kunstgewerblichen Mäntelchen umhängen und damit in eine ebenso schlimme
Geschmacksbarbarei verfallen wie die Ornamenten-Inflation von gestern. Es ist
schon so, daß die nackte „funktionale" Gestaltung einen unvergleichlichen ästhe-
tischen Wert darstellt, wie die Spitzenleistungen der modernen Maschinen (auch
„Wohnmaschinen") beweisen; nur daß es nicht mit dem rein Ingenieurhaften sein
Bewenden hat, sondern daß etwas mit dabei ist, nicht „hinzukommt", was noch
keine Theorie benannt hat, weil es noch in der Zeit steht und gerade erst bemerkt
wird.
Auch Kollmann umgeht dieses Etwas; er sagt nicht, warum wir heute Augen
haben für diese neue Welt der Technik und warum immer weniger für Bilder und