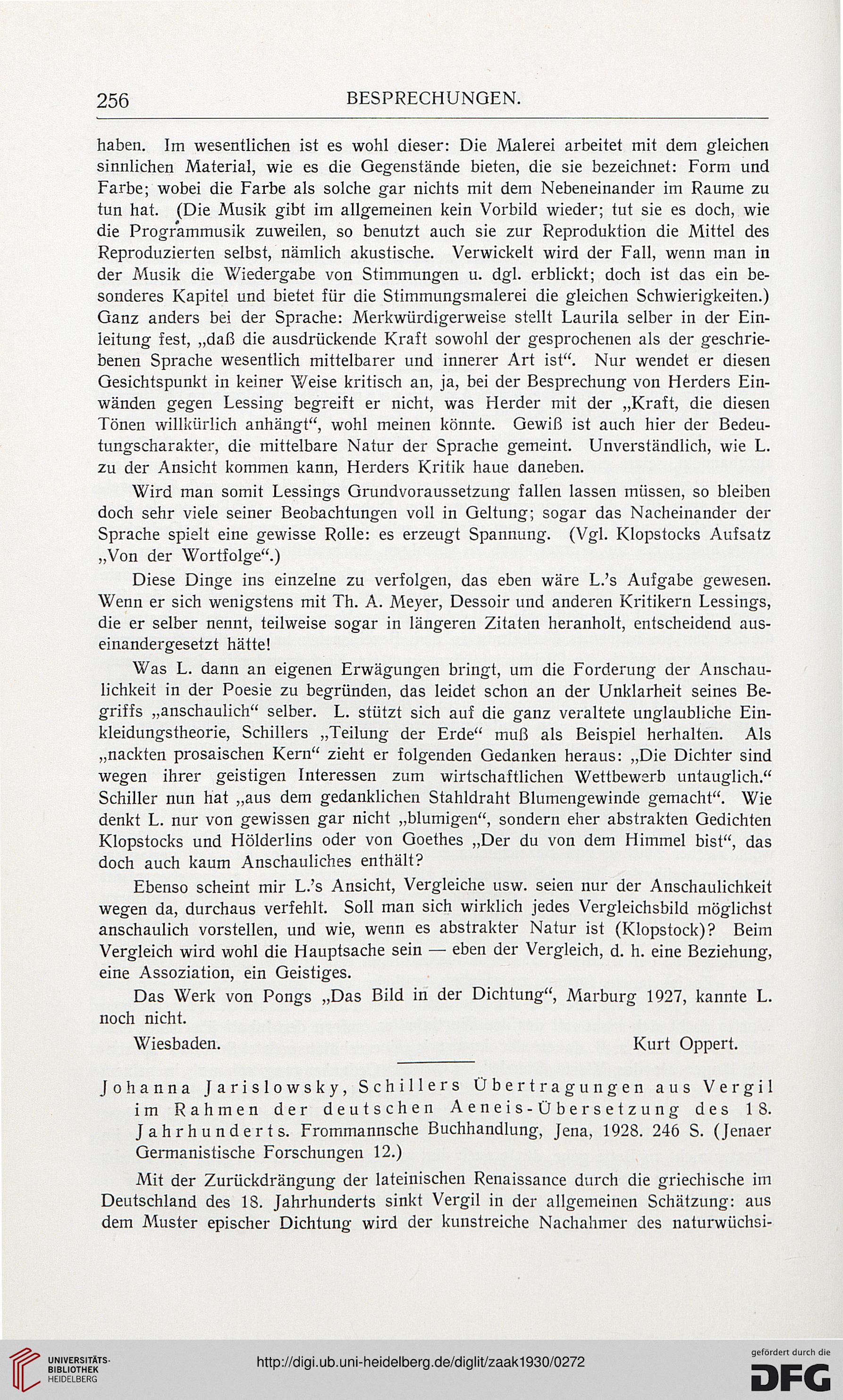256
BESPRECHUNGEN.
haben. Im wesentlichen ist es wohl dieser: Die Malerei arbeitet mit dem gleichen
sinnlichen Material, wie es die Gegenstände bieten, die sie bezeichnet: Form und
Farbe; wobei die Farbe als solche gar nichts mit dem Nebeneinander im Räume zu
tun hat. (Die Musik gibt im allgemeinen kein Vorbild wieder; tut sie es doch, wie
die Programmusik zuweilen, so benutzt auch sie zur Reproduktion die Mittel des
Reproduzierten selbst, nämlich akustische. Verwickelt wird der Fall, wenn man in
der Musik die Wiedergabe von Stimmungen u. dgl. erblickt; doch ist das ein be-
sonderes Kapitel und bietet für die Stimmungsmalerei die gleichen Schwierigkeiten.)
Ganz anders bei der Sprache: Merkwürdigerweise stellt Laurila selber in der Ein-
leitung fest, „daß die ausdrückende Kraft sowohl der gesprochenen als der geschrie-
benen Sprache wesentlich mittelbarer und innerer Art ist". Nur wendet er diesen
Gesichtspunkt in keiner Weise kritisch an, ja, bei der Besprechung von Herders Ein-
wänden gegen Lessing begreift er nicht, was Herder mit der „Kraft, die diesen
Tönen willkürlich anhängt", wohl meinen könnte. Gewiß ist auch hier der Bedeu-
tungscharakter, die mittelbare Natur der Sprache gemeint. Unverständlich, wie L.
zu der Ansicht kommen kann, Herders Kritik haue daneben.
Wird man somit Lessings Grundvoraussetzung fallen lassen müssen, so bleiben
doch sehr viele seiner Beobachtungen voll in Geltung; sogar das Nacheinander der
Sprache spielt eine gewisse Rolle: es erzeugt Spannung. (Vgl. Klopstocks Aufsatz
„Von der Wortfolge".)
Diese Dinge ins einzelne zu verfolgen, das eben wäre L.'s Aufgabe gewesen.
Wenn er sich wenigstens mit Th. A. Meyer, Dessoir und anderen Kritikern Lessings,
die er selber nennt, teilweise sogar in längeren Zitaten heranholt, entscheidend aus-
einandergesetzt hätte!
Was L. dann an eigenen Erwägungen bringt, um die Forderung der Anschau-
lichkeit in der Poesie zu begründen, das leidet schon an der Unklarheit seines Be-
griffs „anschaulich" selber. L. stützt sich auf die ganz veraltete unglaubliche Ein-
kleidungstheorie, Schillers „Teilung der Erde" muß als Beispiel herhalten. Als
„nackten prosaischen Kern" zieht er folgenden Gedanken heraus: „Die Dichter sind
wegen ihrer geistigen Interessen zum wirtschaftlichen Wettbewerb untauglich."
Schiller nun hat „aus dem gedanklichen Stahldraht Blumengewinde gemacht". Wie
denkt L. nur von gewissen gar nicht „blumigen", sondern eher abstrakten Gedichten
Klopstocks und Hölderlins oder von Goethes „Der du von dem Himmel bist", das
doch auch kaum Anschauliches enthält?
Ebenso scheint mir L.'s Ansicht, Vergleiche usw. seien nur der Anschaulichkeit
wegen da, durchaus verfehlt. Soll man sich wirklich jedes Vergleichsbild möglichst
anschaulich vorstellen, und wie, wenn es abstrakter Natur ist (Klopstock)? Beim
Vergleich wird wohl die Hauptsache sein — eben der Vergleich, d. h. eine Beziehung,
eine Assoziation, ein Geistiges.
Das Werk von Pongs „Das Bild in der Dichtung", Marburg 1927, kannte L.
noch nicht.
Wiesbaden. Kurt Oppert.
Johanna Jarislowsky, Schillers Übertragungen aus Vergil
im Rahmen der deutschen Aeneis-ÜberSetzung des 18.
Jahrhunderts. Frommannsche Buchhandlung, Jena, 1928. 246 S. (Jenaer
Germanistische Forschungen 12.)
Mit der Zurückdrängung der lateinischen Renaissance durch die griechische im
Deutschland des 18. Jahrhunderts sinkt Vergil in der allgemeinen Schätzung: aus
dem Muster epischer Dichtung wird der kunstreiche Nachahmer des naturwüchsi-
BESPRECHUNGEN.
haben. Im wesentlichen ist es wohl dieser: Die Malerei arbeitet mit dem gleichen
sinnlichen Material, wie es die Gegenstände bieten, die sie bezeichnet: Form und
Farbe; wobei die Farbe als solche gar nichts mit dem Nebeneinander im Räume zu
tun hat. (Die Musik gibt im allgemeinen kein Vorbild wieder; tut sie es doch, wie
die Programmusik zuweilen, so benutzt auch sie zur Reproduktion die Mittel des
Reproduzierten selbst, nämlich akustische. Verwickelt wird der Fall, wenn man in
der Musik die Wiedergabe von Stimmungen u. dgl. erblickt; doch ist das ein be-
sonderes Kapitel und bietet für die Stimmungsmalerei die gleichen Schwierigkeiten.)
Ganz anders bei der Sprache: Merkwürdigerweise stellt Laurila selber in der Ein-
leitung fest, „daß die ausdrückende Kraft sowohl der gesprochenen als der geschrie-
benen Sprache wesentlich mittelbarer und innerer Art ist". Nur wendet er diesen
Gesichtspunkt in keiner Weise kritisch an, ja, bei der Besprechung von Herders Ein-
wänden gegen Lessing begreift er nicht, was Herder mit der „Kraft, die diesen
Tönen willkürlich anhängt", wohl meinen könnte. Gewiß ist auch hier der Bedeu-
tungscharakter, die mittelbare Natur der Sprache gemeint. Unverständlich, wie L.
zu der Ansicht kommen kann, Herders Kritik haue daneben.
Wird man somit Lessings Grundvoraussetzung fallen lassen müssen, so bleiben
doch sehr viele seiner Beobachtungen voll in Geltung; sogar das Nacheinander der
Sprache spielt eine gewisse Rolle: es erzeugt Spannung. (Vgl. Klopstocks Aufsatz
„Von der Wortfolge".)
Diese Dinge ins einzelne zu verfolgen, das eben wäre L.'s Aufgabe gewesen.
Wenn er sich wenigstens mit Th. A. Meyer, Dessoir und anderen Kritikern Lessings,
die er selber nennt, teilweise sogar in längeren Zitaten heranholt, entscheidend aus-
einandergesetzt hätte!
Was L. dann an eigenen Erwägungen bringt, um die Forderung der Anschau-
lichkeit in der Poesie zu begründen, das leidet schon an der Unklarheit seines Be-
griffs „anschaulich" selber. L. stützt sich auf die ganz veraltete unglaubliche Ein-
kleidungstheorie, Schillers „Teilung der Erde" muß als Beispiel herhalten. Als
„nackten prosaischen Kern" zieht er folgenden Gedanken heraus: „Die Dichter sind
wegen ihrer geistigen Interessen zum wirtschaftlichen Wettbewerb untauglich."
Schiller nun hat „aus dem gedanklichen Stahldraht Blumengewinde gemacht". Wie
denkt L. nur von gewissen gar nicht „blumigen", sondern eher abstrakten Gedichten
Klopstocks und Hölderlins oder von Goethes „Der du von dem Himmel bist", das
doch auch kaum Anschauliches enthält?
Ebenso scheint mir L.'s Ansicht, Vergleiche usw. seien nur der Anschaulichkeit
wegen da, durchaus verfehlt. Soll man sich wirklich jedes Vergleichsbild möglichst
anschaulich vorstellen, und wie, wenn es abstrakter Natur ist (Klopstock)? Beim
Vergleich wird wohl die Hauptsache sein — eben der Vergleich, d. h. eine Beziehung,
eine Assoziation, ein Geistiges.
Das Werk von Pongs „Das Bild in der Dichtung", Marburg 1927, kannte L.
noch nicht.
Wiesbaden. Kurt Oppert.
Johanna Jarislowsky, Schillers Übertragungen aus Vergil
im Rahmen der deutschen Aeneis-ÜberSetzung des 18.
Jahrhunderts. Frommannsche Buchhandlung, Jena, 1928. 246 S. (Jenaer
Germanistische Forschungen 12.)
Mit der Zurückdrängung der lateinischen Renaissance durch die griechische im
Deutschland des 18. Jahrhunderts sinkt Vergil in der allgemeinen Schätzung: aus
dem Muster epischer Dichtung wird der kunstreiche Nachahmer des naturwüchsi-